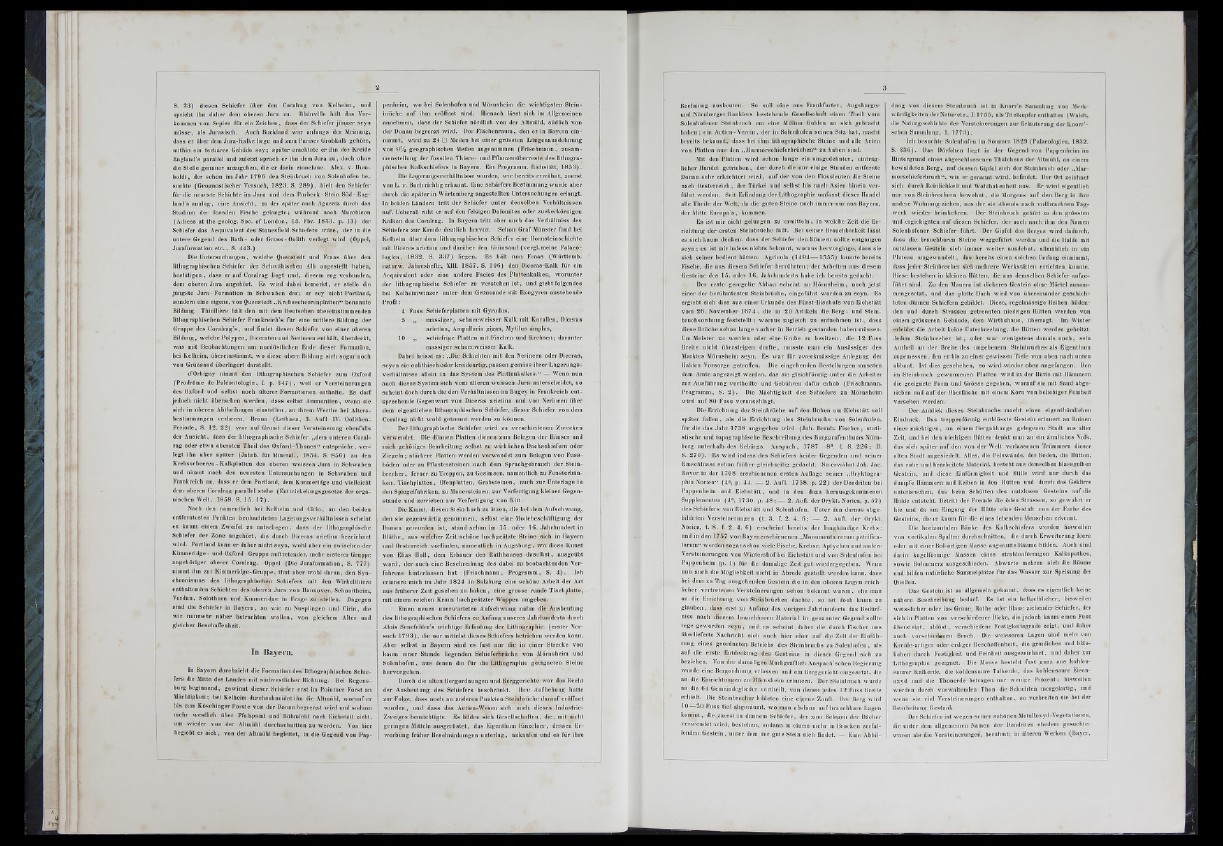
s. 23) diesen Schiefer über den Coratrag von K elh eiiu , und
spricht ihn daher dem oberen Ju ra zu. Ulainville liält das Vorkommen
von Sepien für ein Zeich en , dass der Sehiefer jü n g e r seyn
m ü sse , als Jurasisch . Auch Buckland w a r anfangs der Meinung,
d a ss er über dem Jura-Kalke liege und zum Pa rise r Grobkalk gehöre,
mithin ein lertiiires Gebilde s e y ; sp ä ter e rachtete er ihn der Kreide
Riiginnd’s parallel und zuletzt sprach e r ihn dem Ju ra z u , doch ohne
die Stelle g enauer anzugeben, die e r darin einnehme. Alex. v . Humbo
ld t, der schon im J a h r 1 796 den Steiiibrucli viiii Soleiihofen besu
ch te (Geognoslischer Versuch, 1823. S. 289) , hielt den Schiefer
für die neueste Sehiehte im Ju ra und dem Purbeek - Stein S ü d -E n g land’s
a n alo g , eine A n sich t, zu der sp ä ter auch Agassiz durch das
Studium der fossilen Fische g e lan g te ; während nach .Murchison
(Adre ss at the geolog. Soc. of London, 15. Fbr. 1833. p. 13) der
Schiefer das Aeqiiivalent des Stoneslield-Schiefers w ä re , der in die
untere Gegend des B a th - oder G ro s s - ü o lith v e rleg t wird (Oppel,
Juraformation e tc ., S. 4 4 3 .)
Die l/iifersucliimgen, welche Quensfedt und Fran s über den
lithographischen Schiefer der Schwäbischen Alb aiigesleilt haben,
b e s tä tig en , d a ss e r au f Coralrag liegt u n d , diesem eng verbunden,
dem oberen Ju ra nngehürt. Es wird dabei bemerkt, er stelle die
jü n g ste Ju ra -F o rm a tio n in Sd )waben d a r; er sey nicht Portland,
sondern eine eigene, vo n Quenstedt „Kreb s sch e eren p latlen “ benannte
Bildung. Thiollieru hält den mit dem Deutschen übereiuslimnienden
lithographischen Schiefer Frankreich’s für eine niittlere Bildung der
Gruppe des C o ra lra g 's , und findet diesen Schiefer von e iner oberen
Bildung, welche Poly p en , Diceraten und Nerinecn enthält, überdeckt,
w as mit Beobachtungen am nordöstlichen Ende dieser Formation,
bei Kelheim, übereinstimmt, wo diese obere Bildung sich so g a r noch
von Grünsand überlagert darstellt.
d 'ü rb ig n y nimmt den lithographischen Schiefer zum Oxford
(Prodröme de Paléontologie, I. p. 3 4 7 ) , weil e r Versteinerungen
des üxfoid und se lb st noch älterer Formationen enthalte. Es darf
jedoch nicht übersehen w e rd e n , dass se lbst Ammoniten, wenn sie
sich in oberen Abiheiitmgen e in ste llen , an ihrem Werthe bei .Altersbestimmungen
verlieren. Bronn (L elh a ea , 3. Aufl. IV. Oolithen-
P e riode, S. 12. 2 2 ) w a r a u f Grund dieser Versteinerung ebenfalls
der Ansicht, d a ss der lithographische Schiefer „dem unteren Coralrag
oder e twa obersten Theil des Oxfo rd -Th o n es“ e n tsp räch e, v e rlegt
ihn ab er sp ä ter (Jah rb . für .Mineral., 1 8 5 4 . S. 8 5 6 ) zu den
Krebsscheeren - K alkplatten des oberen wei.ssen Ju ra in Schwaben
und niinint nach den neuesten Untcrsucluingen in Schwaben und
Frankreich an. dass e r dem Portland, dem Kiinmeridge und vielleicht
dem oberen Coralrag parallel steh e (Entwiekelungsgesetze der organischen
Welt, 1 8 5 8 . S. 15. 1 7 ) .
Nach den namcnllich bei Kelheim und Cirin, an den beiden
entferntesten Punkten beobachteten Lagcrungsverliälliiissen scheint
es kaum einem Zweifel zu unte rlieg en , d a ss der lithographische
Schiefer der Zone an g eh ö rt, die durch Diceras nrietinn bezeichnet
wird. Portland kann er dah er nicht seyn, wohl aber ein zwischen der
Kimmeridge- und Oxford - Gruppe auftrelender, mehr e rs tc re r Gruppe
angehöriger oberer Coralrag. Oppei (Die Ju rafo rmatio n , S. 7 7 7 )
nimmt ihn zur Kimmeridge-Gruppe. Ihiit aber wohl da ran, den Sync
hronismus des lithographischen Schiefers mit den Wirbeltliiere
e nthaltenden Schichten des oberen Ju ra von Hannover, Schnaitheim,
Verdiin, Solothurn und Kimmeridge in Frage zu «feilen. Dagegen
sind die Schiefer in Bay ern , so wie zu Niispliiigen und Cirin, die
wir nunmehr näher betrachten w o llen , v on gleichem Alter und
gleicher BesclialTenheit.
In Bayern.
ln Bayern durchzieht die Formation des lilhographischcn Schiefers
die Milte des Landes mit südwes tlich er Richtung. Bei Regena-
burg beginnend, g ewin n t d ieser Schiefer e rs t im Poinlner Fo rst an
Mächtigkeit; bei Kelheim diirchschneidct ihn die Altmühl, w o ra u f er
bis zum Köschingcr Fo rste von der Donau begrenzt wird und sodann
mehr westlich über Pfalzpnint und' ßölimfeld nach Eichstätt zieht,
um wieder von der Altmühl durohsehiiitlen zu werden. Von hier
begicht e r s ie h , von der Altmühl begleitet, in die Gegend von Pap-
)ienheim, wo bei Solenliofcn und Mömsheim die w ich tig sten Stein-
brüche a u f iliin erölTnet sind. Hienach lä s s t sich im .Allgemeinen
annehmen, da ss der Schiefer nördlich von der Altmühl, südlich von
der Donau begrenzt wird. Der Fläehenraiim, den e r in Bayern einnimmt.
wird zu 2 4 □ Meilen bei einer g ro s s te n Längenausdehnung
von 9 ¡4 geographischen .Meilen angenommen (Frischm aiin , Zusammenstellung
der fossilen Thiere- und Pflanzeniiberreste des lithograp
hischen Kalksciiiefers in Bayern. Ein Programm. Eichstätt, 1 8 5 3 ) .
Die Lagcru n g sv erh ältiiis se wurden, wie bereits erwäh n t, zuerst
von L. V. Buch richtig erk an n t. Eine schärfere Bestimmung wurde aber
durch die sp ä ter in Würtemberg angestellten Untersuchungen erlangt.
In beiden Ländern tritt der Schiefer unter denselben Verhältnissen
auf. Uehcrall ruht er au f den felsigen Dolomiten oder zuckerköriiigen
Kalken des Coralrag. In Bayern tritt ab er aneli das Verhällniss des
Schiefers zur Kreide deutlich h e rvor. Schon Graf .Münster fand bei
Kelheim über dem litliograpliischcii Schiefer eine llornsteinschichtu
mit Díceres arie tin a und darüber den Grünsand (verg l.m e in e Palaeo-
lo g le a, 1 8 3 2 . S. 3 3 7 ) liegen. Es h ält mm F ra a s (Würticmb.
n nlurw. Jah re sh efte , XIII. 1 8 5 7 . S. 10 6 ) den Diccras-Kalk für ein
Aequivnlent oder eine andere Facies des Platten k a lk es , wo ru n ter
der litliograplüsehe Schiefer zu ve rsteh en is t , und g iebt folgendes
bei Kelheimwinzer unter dem Grtinaande mit Exogyren anstehende
Profil:
4 Fu s s Schicferplatlen mit Gyrodus,
5 „ m a s s ig e r, sc h n eewe isse r Kalk mit Korallen, Diceras
a rietina, Ampullaria gig a s, iMytiliis ainpliis,
10 „ schiefrige Platten mit Fischen und K reb sen ; darunter
m assiger s ch n eewe isse r Kalk.
Dabei h e isst e s : „Die Schieliteii mit den Nerinecn oder Diceras,
•seyeii sie oolithisch oder kreideartig, p a ssen gemäss ih rer Lagerungs-
Verhältnisse allein in das System des Plattenkalkes .'• — Wenn luio
auch dieses System sich vom älteren w eissen Ju ra unte rs ch e id et, so
scheint doch durch die den Verhältnissen im Bugey in Frankreich entsprechende
Gegenwart von Diceras a rie tin a und vo n Nerinecn über
dem eigentlichen lithographischen Schiefer, d ieser Schiefer vo n dem
Coralrag nicht w o h l g e tren n t »verden zu können.
Der lithographische Schiefer wird zu versch ied en en Zwecken
v e rwen d e t. Die dünnen Platten dienen zum Belegen der Häuser und
nach geh ö iig er Bearbeitung se lb st zu wirklichen Dachschiefern oder
Zieg eln ; stä rk ere Platten werden ve rwen d e t zum Belegen vo n Fn s s-
böden oder zu Pflastersteinen nach dem Sprachgebrauch der Steinb
rech er, ferner zu Treppen, zu Gesimsen, iiamenllich zu Fen ste rb än k
en, Tisch p latten , Ofenplatten, Grab ste in en , auch zur Unterlage in
den Spiegelfabriken, zu iMauersleinen, zur Verfertigung kleiner Gegenstände
und zerrieben zur Verfertigung von Kitt.
Die Kunst, diesen Stein hoch zu ätzen, die bei dem Aufschwung,
den sie geg enwärtig genommen, se lb st eine Modebeschäftigiing der
Damen g eworden is t, stand schon im 15. oder 16. Jah rh u n d e rt in
Blüthe, a u s welcher Zeit schöne hoehgeätzte Steine sich in Bayern
und Oesterreich vorfinden, namentlich in A u g sb u rg , w o diese Kunst
von Elias Holl, dem Erbauer des Rathliauaes d a s e lb s t, ausgeübt
w a rd , der auch eine Beschreibung des dabei zu beobachtenden Verfahrens
lü nlcrlassen hat (F risc hm an n , Pro g ram m, S. 4 ) . Ich
erinnere mich im J a h r 1 824 in Salzburg eine schöne Arbeit der Art
aus früherer Zeit gesellen zu h a b en , eine g ro sse runde Tischplatte,
mit einem reichen Kranz h o chgeätzter Wappen umgeben.
Einen neuen un e rwarte ten Aufschwung nahm die Ausbeutung
des lithographischen Schiefers zu Anfang u n s e re s Jah rh u n d e rts durch
Alois Sencfcider’s w ichtige Erfindung der Lithographie ( e rs te r Versuch
1 7 9 3 ) , die nur mittelst d ieses Schiefers betrieben werd en kann.
Aber se lb st in Bayern sind e s fast nur die in e iner Strecke von
kaum e iner Stunde liegenden Scliiefcrhriichc vo n Mörnshciin und
Solenhofen, a u s denen die für die Lithographie geeigneten Steine
he rvorgellen.
Durch die alten Bergordnungen und Berggerichte w a r das Recht
der Ausbeutung des Schiefers b eschränkt. Ihre Aufhebung Imtle
zur Folge, da ss noch an anderen Punkten Sleinbrüche da rau f erölTnet
w u rd e n , und d a ss das Aclien-Wesen sich auch d ieses Industriezw
e ig e s bemächtigte. Es bilden sich Gese lls ch a ften , die, mit niclit
geringen Mitteln a u sg e rü s te t, das Eigeiitliuni Einzelner, d e ssen Erw
erbung früher Beschränkungen u n te rlag , anknufen und es für ihre
Rechnung ausbeuten. So soll eine au s F ra n k fu rte r. Aiigsliurgcr
und Nürnberger Bankiers bestehende Gesellschaft einen Theil vom
Solenhofener Steinliruch um eine Alillion Gnlden an sich gebracht
h ab en ; ein Acticn -V ei'ein . der in Solenliofcn seinen Sitz h a t. macht
bereits b ek an n t, d a ss bei ihm lithographische Steine und alle Arten
von Platten aus den „.Marmorschieferbriichen“ zu haben sind.
.Mit den PIntlen wird schon lange ein a u sg ed e h n ter, e inträglicher
Handel g e trieb e n , der durch die nur einige Stunden entfernte
Donau s e h r e rleichtert w ird , a u f der von den Flossleuten die Steine
nach Oesterre ich , der Türkei und se lb st bis nach Asien hinein verführt
werden. Seit Erfindung der Litliographie umfasst d ieser Handel
alle Theile der Welt, da die guten Steine noch immer nur aus Bayern,
der Mitte E n ro p a 's , kommen.
Es ist mir nicht ge lungen zu e rm itte ln , in welche Zeit die Errichtung
der e rsten Sleinbrüche fällt. Bei seiner Brauclib.arkeit lässt
e s sich kaum denken, d a ss der Schiefer den Römern sollte entgangen
sey n ; es ist mir indess n ichts bekannt, w o ra u s hervorginge, d a ss sie
sich se in er bedient hätten. Agricola ( 1 4 9 4— 1 5 5 5 ) k annte bereits
Fische, die aus diesem Schiefer h e rrü h rten ; der Arbeiten aus diesem
Gesteine des 15. od e r 16. Jah rh u n d e rts liabe ich b e re its gedacht.
Der e rs te geregelte Abbau scheint zu Mömsheim, noch je tzt
e iner der berühmtesten Sleinbrüche, eingeführt worden zu seyn. Es
ergiebf sieh dies au s einer Urkunde des Fürst-Bischofs vo n Eichstätt
vom 2 6 . November 1 6 7 4 , die in 2 0 Artikeln die B e rg - und Slein-
b riichsonlnung feststcllt ; w o ra u s zugleich zu entnehmen i s t , dass
diese Brüche schon lange v o rh er in Betrieb g e standen haben müssen.
Um Meister zn werden oder eine Grube zu b e s itz en , die 12 Fuss
Breite niclit übersteigen d u rfte , mu sste man ein Ansäs sig er des
Marktes Mömsheim seyn. Es w a r für zweckmässige Anlegung der
Halden Vorsorge getroffen. Die eingehenden Bestellungen mussten
dem Amte angezeigt werd en , d a s sie gleichförmig u n te r die Arbeiter
zur Ausführung v e rfheilte und Gebühren dafür erhob (Frischmann,
Program m, S. 2 ) . Die .Mächtigkeit des Schiefers zu Mömsheim
wird au f 8 0 F a s s veran sch lag t.
Die Errichtung der Steinbrüche auf den Höhen um Eichstätt soll
sp ä te r fallen , a ls die Errichtung des Sieinbriichs von Solenhofcn,
für die das J a h r 1 7 3 8 angegeben wird (Jo b . Bernh. F isch e r, s ta tis
tis ch e lind to p o g raphische Beschreibung des Biirggrafentlnmis Nürnberg
unterhalb des Gebfli-gs. A n sp ach , 1 7 8 7 8 “. 1. S. 2 2 6 ; 11.
S. 2 7 0 ) . Es wird indess des Schiefers beider Gegenden und seiner
E inschlüsse schon früher gleichzeitig g edacht. So erw äh n t .loh. Jac.
Bayer in der 1 7 0 8 erschienenen e rsten Auflage se in er ,,Oryktogra-
phia Noriea-“ (4», p. 44. — 2 . Aufl. 1 7 58 . p. 2 2 ) der Dendriten bei
Pappenheiin und E ic lis lä tt, und in den dazu lierausgekoinmcnen
Supplementen ( 4 “, 1 7 30 . p. 4 8 ; — 2. Aufl. der Orykt. Noricn, p .5 7 )
des Schiefers von Eiclislätt und Solenhofen. Unter den daraus abge-
blldeteii Versteinerungen (t. 3. f. 2. 4. 6 ; - 2 . Aufl. der Orykt.
Norica, t. 8. f. 2. 4. 6 ) e rscheint b e re its der langhändige K reb s;
lind in den 1757 von Bayer erschienenen ...Monumenta rerum petrilìea-
ta riin r' werden so g a r schon viele Fische, K rebse, Aplycheii und andere
Versteinerungen von AVintcrshof bei E ichstätt und von Solenliofen bei
Pappeiihcim (p. 1) für die damalige Zeit gut wiedergegeben. Wenn
nun auch die Möglichkeit nicht in Abrede g e stellt werden kann, dass
bei dem zu Tag ausgehenden Gestein die in den oberen Lagen reichlicher
vertreleiieii Versteinerungen schon bekannt w a r e n . ehe man
an die Erriclitimg von Steinbrüchcn d a ch te , so is t doch kaum zu
g la u b en , da ss e rs t zu Anfang des vorigen Jah rh u n d e rts das Bedürf-
HISS nach diesem brauchbaren Material in gen an n te r Gegend sollte
rege geworden s e y n , und es scheint dah er die durch Fisclier uns
üherlieferle Nachricht sich auch hier eher auf die Zeit der Einführung
eines geordneten Betriebs des Steinbm chs zu Soleiihofen, als
a u f die e rste Enidecknng des Gesteins in dieser Gegend sich zu
beziehen. Von der damaligeti .Markgräflich Aiispnch’schen Regierung
wurde eine Bergordnung erla ssen mul ein Berggericht e ingesetzt, die
an die Eiiirichtiingen zu Mömsheim erinnern. Der Sleinlirneli wurde
an die 64 Gemeimleglieder vertlieilt. von denen Jedes 1 2 Fuss Breite
erhielt. Die Steinlircclier bildeten eine eigene Zunft. Der Berg wird
1 0—2 0 Fu s s lief abgeräiimt, wo man alsdann a u f braiichb.ire Lagen
kommt, die zu erst in dünnem Schie fe r, der zum Belegen der Dächer
v e rw en d e t wird, be stellen , sodann in einem mehr in Brocken zerfallenden
G e s te in , unter dem der gute Stein sich findet. — Eine Abbildnng
von diesem Steiiibrucli ist in Knorr’s Samnilimg von .Merkwürdigkeiten
der Natur etc., 1 .1755, als Titelkiipfer enthalten (Walch,
die Naturgeschichte der Verslehierungen zur Erläuterung der Knorr’-
schun Samiiiliiiig, 1. 1 7 7 3 ).
Ich besuchte Solenhofen im Sommer 1 829 (Palaeologica. 1832.
S. 3 3 6 ) . Das Dörfchen liegt in der Gegend von Pappenheim im
llinlergruiid eines abgeschlossenen Thälchens der Altmühl, an einem
bewaldeten Berg, auf dessen Gipfel sich der SCeinhmch oder ,,Mar-
morschicferbrneh'', wie er genannt wird, befindet. Der ü r t zeichnet
sich durch Reinlichkeit und Wohlhalienheil aus. Er wird eigentlich
nur von Steinbrechern bewo h n t, die Morgens auf den Berg in ihre
andere Wohnung ziehen, ans der sie Abends nach vollbrachtem Tagwerk
wieder heimkehren. Der Steinliruch gehört zu den grö ssten
und ergiebigsten auf diesen Schiefer, der auch nach ihm den Namen
Solenhofener Schiefer führt. Dev Gipfel des Berges wird dadurch,
d a ss die hraucliharen Steine weggeführt werden und die Halde mit
nutzlosem Gestein sich immer weiter aiisdehnl, allmählich in ein
Plateau nmgewandelt, das bereits einen solchen Umfang einnimmt,
dass jeder Steinbrecher sich mehrere Werkstätten errichten konnte.
Diese bestehen in kleinen Hätten, die aus demselben Schiefer aiifge-
fülirt sind. Zu den Mauern is t dickeres Gestein ohne Mörtel zusammengese
tz t, und das platte D.ach wird von übereinander geschichteten
dünnen Schiefern gebildet. Diese, regelmässige Reihen bildenden
und durch Strassen getrennten niedrigen Hütten werden von
einem grö sseren Gebäude, dem Wipihshau.s, überragt. Im Winter
erleidet die Arbeit keine Unlerbrecluing, die Hütten werden gehcitzt.
Jedem Steinbrecher i s t , oder w a r wenigstens damals n o c h , sein
Anlheil an der Breite des Ungeheuern Steinbruehes als Eigenthum
ziigemessen. den er bis zu einer gewissen Tiefe von oben nach unten
abhaut. Ist dies geschehen, so wird wieder oben angefangen. Den
im Steinbrueli gewonnenen Platten wird in der Hütte mit Hämmern
die geeignete Form und Grösse gegeben, worauf sie mit Sand abgerieben
und auf der Oberfläche mit einem Korn von beliebiger Feinheit
v e rseh en werden.
Der Anblick dieses Steinbruchs macht einen eigenthümlichen
Eindruck. Das treppenförmig entiilösste Gestein erinnert an Ruinen
e iner m.ächligen, an einem Bergnbhaiige gelegenen Stadt aus alter
Zeit, und bei den niedrigen Hütten denkt man an ein ärmliches Volk,
das sich sp ä ter au f den vo n der Well v e rlassenen Trümmern dieser
allen Stadt angesiedelt. Alles, die Felswände, der Boden, die Hütten,
das rohe und bearbeitete .Material, b esteht aus demselben blassgclben
Gestein , und diese Einförmigkeit und Stille wird nur durch d.is
dumpfe Hämmern und Reiben in den Hütten und durch das Geklirre
unterbrochen, das beim Schütten des nutzlosen Gesteins a u f die
Halde e n tsteh t. Betritt der Fremde die öden Stra ssen, so g ewa h rt er
hie und da am Eingang der Hütte eine Gestalt von der Farbe des
Gesteins, die er kaum für die eines lebenden Menschen erkennt.
Die horizontalen Bänke des Kalkschiefers werden bisweilen
von vertikalen Spalten durchschnitten, die durch Erweiterung leere
oder mit einer Bol-artigen .Masse nngeiuilte Räume bilden. Auch sind
darin kugelförmige .Massen eines strahlenförmigen Kalkspathes,
sow ie Bohnenerz aiisgeschieden. Abwärts mehren sieh die Räume
und bilden natürliche Sammelplätze für das Wasser z u r Speisung der
Quellen.
Das Gestein ist so allgemein g ek an n t, dass es eigentlich keine
nähere Beschreibung bedarf. Es ist ein heligelblicher, bisweilen
w eisslich er oder ins Grane, Rothe oder Blaue ziehender Schiefer, der
sich in IHatlcn von v e rschiedener Dicke, die jedoch kaum einen Fuss
ü b e rs te ig t, a lilö s t, verschiedene Festigkeilsgrade zeigt, und daher
auch vorsehiedsnen Bruch. Die w eisseren Lagen sind mehr von
Kreide-artiger oder erdiger Bcsehaffenheil, die graulichen und bläulichen
durch Festigkeit und Feinheit au sg ez eich n et, und daher zur
l..ifhograpliie geeignet. Die Masse b esteht fast ganz ans kohlen-
•saurcr Knikerde, die kohlens.uirc Tnlkerde, das kohlensaure Eisenoxyd
und die Thonerde betragen nur wenige Pro z en t: bisweilen
werden dnrcli v o rwa ltenden Thon die Schichten mergelartig, und
wenn sie viel Versteinerungen eiifhalten, so v erbleiten sie bei der
Bearbeitung Gestank.
Der Schiefer ist wegen seiner schönen Mclalloxyd-Vegelationen,
die u n te r dem allgemeinen Namen der Dendriten ehedem gesuchter
waren als die Versleinerungeh, berühmt; in älteren Werken (Bayer.