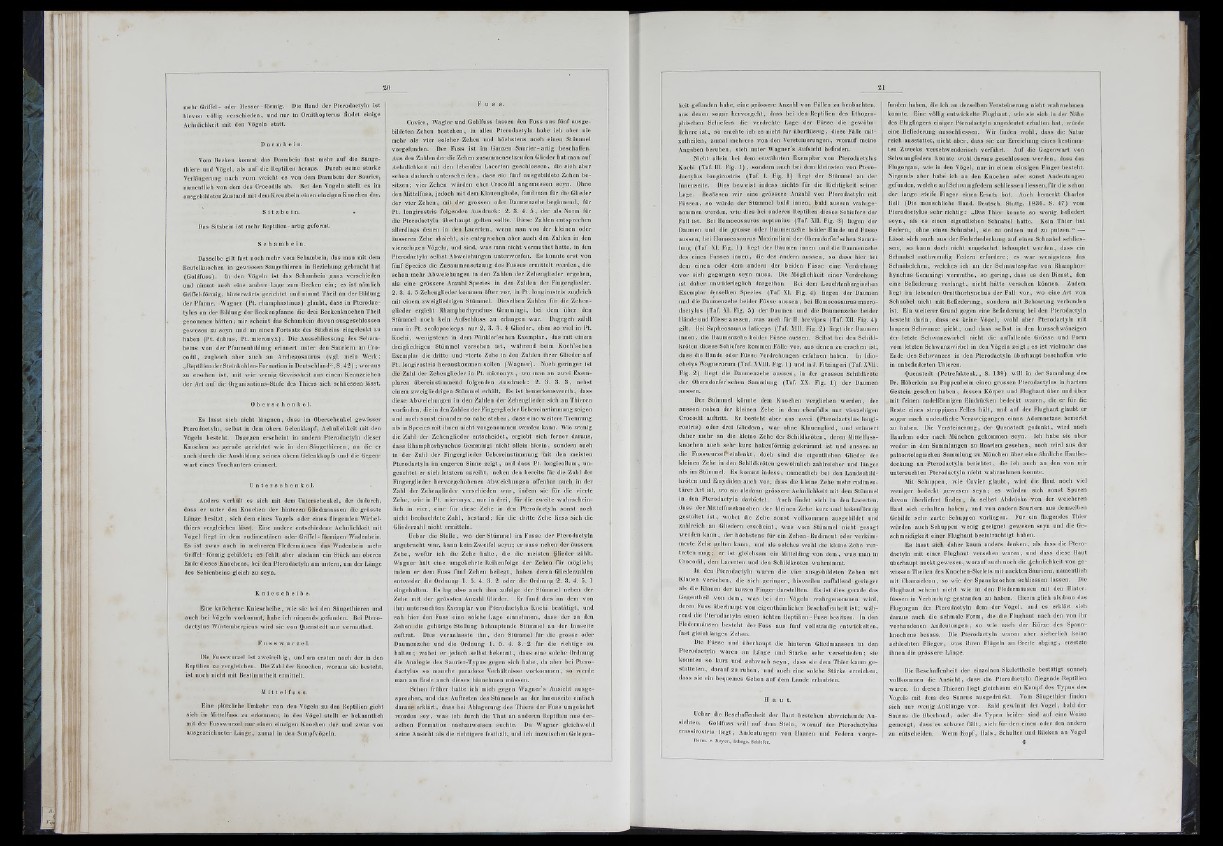
! r * .
I 1"
mehr GrllTel- oder Messer - förmig. Die flftiid der Pierodaclylu ist
hievoti völlig ve rsch ied en , und mir in Ornitiiopterus findet einige
Aehnlichkeit mit den Vögeln sta tt.
D a r m b e i n .
Vom Becken kommt das Darmbein fast mehr a u f die Säiige-
thiere und Vögel, als auf die Reptilien heraus. Durch seine starke
Vcriiingcnmg nach vo rn weicht cs von dem Darmbein der Saurier,
namcnllich von dem des Crocodils ah. Bei den Vögeln ste llt es im
ausgebildeleii Zustand mit dem Kreuzbein einen einzigen Knochen dar.
S i t z b e i n .
Das Sitzbein is t mehr Rep tilien-artig geformt.
S c h a m b e i n .
Dasselbe gilt fast noch mehr vom Schambein, das man mit dem
Beiitelkiiochen in g ewissen S.angelhieren in Beziehung g eb ra ch t hat
(Go ld fu ss ). ln den Vögein is t das Schambein ganz verschieden
«nd nimmt auch eine andere Lage zum Becken e ia ; es is t niimlicli
Grilfel-förniig, hin te rwä rts g e richtet und nimmt Theil an der Bildung
der Pfanne. W.qgner (P l. riiamphastinus) g lau b t, d a ss in Pterodacty
lu s an der Bildung der Bcckcnpfaniie die drei Beckenknochen Theil
genommen hätten ; mir scheint das Sch.imbein davon ausgeschlossen
gewesen zu seyn und an einen F o rtsa tz des Sitzbeins eingelenkt zu
haben (Pl. dubius, Pt. mic ro n y x ). Die Anssehliessiing des Schambeins
von der Pfannenbildnng erinnert unter den Sauriern an Crocodil,
zugleich aber aiieh an Archegosaurus (v g l. mein Werk:
„Reptilien derSleinkohlen-Form.ation in Deutschland“ , S. 4 2 ) ; woraus
zu ersehen is t, mH wie wenig Gewissheit aus einem Kennzeichen
der Art auf die Organisations-Stufe des Thiers sich schiiessen lä sst.
O b e r s c h e n k e l .
Es lä sst sich nicht lätignen, d a ss im Oberschenkel gewisser
Ptero d ac ly ln , se lbst in dem obern Geleukkopf, Aehnlichkeit mit den
Vögeln besteh t. Dagegen e rscheint in ändern Pterodactyin dieser
Knochen so gerade g e richtet wie in den Säugethieren, ao die er
auch durch die Ausbildung seines obern Gclcnkkopfs und die Gegenw
a r t eines Trochanters erinnert.
U n t e n k e l .
Anders v e rhält es sieh mit dem ü n te rs eh en k ei, der dadurch,
da ss er u n te r den Knochen der hinteren Gliedmaassen die g rö sste
l.änge b e s itz t, sich dem eines Vogels oder eines fliegenden Wirbel-
th lc rs vergleichen lä sst. Eine andere entschiedene Aehnlichkeit mit
Vogel liegt in dem rudimentären oder Griffel • förmigen Wadenbein.
Es is t zwa r auch in melireren Fledermäusen das Wadenbein mehr
Griffel-förmig g e b ild et; es fehit aber alsdann ein Stück am oberen
Ende dieses Knochens, bei den Pterodactyin am iinlern, um der Länge
des Schienbeins gleich zu seyn.
Eine knöcherne Kniescheibe, wie sie bei den Säugelhieren nnd
auch bei Vögeln vorkommt, habe ieh nirgends gefunden. Bei Pterod
actylus Wuilembergicus wird sic von Quenstedt nur vermuthet.
Die Fiisswiirzel ist zwe ireihig, und am e rsten noch der in den
Reptilien zu vergleichen. Die Zahl der Knochen, wo ian s sie besteht,
is t noch nicht mit Bestimmtheit ermittelt.
- M i t t e l f u s s .
Eine plötzliche Umkehr von den Vögeln zu den Reptilien giebt
sich im .Mitlelfuss zn erk en n en ; in den Vögel ste llt er bekanntlich
mit der Fiisswnrzel nur einen einzigen Knochen dar und zwar von
ausgezeichneter Län g e , zumal in den Sumpfvögeln.
Cu v ier, Wagler und Goldfuss lassen den Fn s s ans fünf an sg e-
biideten Zehen b e s te h e n , in allen Pterodactyin liabe ich aber nie
mehr a ls v ie r solcher Zehen und h ö chstens noch einen Stüminel
vorgefiinden. Der Fn s s is t im Ganzen S a u r ie r - a r tig beschaffen.
Ans den Zahlen der die Zehen zusammenselzenden Glieder h a t inan auf
Aehnlichkeit mit den lebenden Lacerten g e sclilo ssen , die sich aber
solion dadurch u n te rs ch e id en , d a s s sie fünf ansgcbildele Zehen bes
itz e n ; vier Zehen würden eher Crocodii angemessen seyn. Ohne
den Mittelfuss, jedoch mit dem Klauengliede, fand man für die Glieder
der v ie r Z eh e n , mit der g ro ssen oder Daumcnzehe b e g innend, für
Pt, lo n g iro stris foigenden Ausdruck: 2. 3. 4. 5 , der als .Norm für
die Pterodaclyln ü berhaupt gelten sollte. Diese Zahlen entsprechen
allerdings denen in den L ac erten , wenn man von der kleinen oder
ä u sseren Zehe nbsicht, sie en tsprechen aber aiicli den Zahlen in den
vierzehigen Vögeln, und sind, w a s man nicht vcrumtliet h atte, in den
Pterodaclyln se lb st Abweichungen unte rw o rfen . Es konnte e rs t von
fünf Species die Zusaininensetzung des F u s s e s ermittelt w e rd e n , die
schon mehr Abweichungen in den Zalilun der Zeilenglieder ergeben,
als eine g rö ssere Anzahl Species iu den Zahlen der Fingerglieder.
2. 3. 4. 5 Zth en g ü ed e r kommen ö fter vo r, in Pt. lo n g iro stris zugleich
mit einem zweigliedrigen Stümmel. Dieselben Zahlen für die Zeh en glieder
ei-giebt Rhamphorhynchns Gemmingi, bei dem über den
Stümmel noch kein Aufschluss zu erlangen war. Dagegen zählt
man in Pt, scolopaeiceps mir 2. 3. 3. 4 Glieder, eben so v ie l iu Pt.
Ko ch i, weniffstens iu dem Winkler’schen Ex em p lar, das mit einem
dreigliedrigen Stüminel v e rse h en i s t , wäh ren d beim Koch'.scheo
Exemplar die dritte und v ierte Zehe in den Zahlen ih rer Glieder auf
Pt. lo n g iro stris henuiskommeii sollen (W a g n er). Noch geringer ist
die Zahl der Zehenglieder in Pt. mic ro n y x , w o man an zwei Exemplaren
übereinstimmend folgenden Au sd ru ck : 2. 3. 3. 3 , nebst
einem zweigliedrigen Stümmel e rhält. E s is t bem erk en swe rlli, dass
diese Abweiclunigen in den Zahlen der Zelicnglieder sich an Thieren
vorfinden, die in den Zahlen der Fingergliedcr Uebereinstimmung zeigen
und auch so n s t einander so nahe s te h e n , d a ss eine w eitere Trennung
als in Species mit ihnen n icht vorgenomnien werden kann. Wie wenig
die Zahl der Zeheiiglieder en ts ch e id e t, ergiebt sich ferner daraus,
d a ss Rliampliorliyiicliiis Gemmingi n icht allein h ie rin , sondern auch
in der Zahl der Fingerglieder Uebereinstimmung mit den meisten
Pterodactyin im engeren Sinne z e ig t, und dass Pl. longicolium, unge
ach tet er sicli le tztem a n re ih t, neben den bereits für die Zahl der
Fiiigcrglieder liervorgehobenen Abweichungen offenbar aneli in der
Zahl der Zeliengiieder verschieden w a r , indem sie für die v ierte
Z eh e , wie in Pt. m icronyx, nur in d rei, für die zwe ite wah rsch ein lich
in v ie r, eine für diese Zehe in den Pterodaclyln so n s t noch
n icht beobachtete Z ah l, b e s tan d ; für die dritte Zehe lie ss sich die
GlieJcrzahl nicht ermitteln.
Deber die S te lle , w o der Stümmel im Fnsse der Pterodactyin
angebraclit w a r, kann kein Zweifel s e y n ; er s a s s neben der äu ssern
Z eh e , wofür ich die Zehe h a lte , die die meisten Glieder zählt.
Wagner hält eine umgekehrte Reihenfolge der Zehen für möglich;
indem er dem Fuss fünf Zehen be ileg t, haben deren Gliederzalilen
en tw ed e r die Ordnung I . 5. 4, 3. 2 oder die Oidining 2. 3. 4. 5. 1
eingehalten. Es lag also auch ihm zufolge der Sliimmei neben der
Zehe mit der g rö ssten Anzahl Glieder. Er fand dies an dem von
ihm untersuchten Exemplar von Pterodactylus Kochi b e s tä tig t, und
sah h ier den Fu s s eine solclie Lage ciniielinien, d a ss der zn den
Zehen diu gehörige Stellung helianptcndc Stümmel an der Innseitc
a u ftrat. Dies v e ra n la s s te ih n , den Stümmel für die g ro ase oder
Daiimenzche und die Ordnung 1. 5. 4. 3. 2 für die richtige zu
h a llen ; wobei er jedoch se ihst b ek en n t, d a s s eine .solche Ordnung
die Analogie des Saurier-Typus gegen sicli liiibe, da aber bei Pterod
actylus so manclie paradoxe Verhältnisse Vorkommen, so werde
man am Ende auch dieses hiniielimen müssen.
Schon frOlier h atte ich mich gegen Wugner's Ansicht ausgesprochen,
und das Auftreten des Stummels an der Innciiseilc einfach
darnns e rk lä rt, d a ss hei Abl.ageriing des Tliiers der Fnss unigckehrt
worden s e y , w a s ich durch die Th at an anderen Reptilien ans derselben
Formation naciiziiwciscn su ch te. Da Wagner gleiclnvnlil
seine Ansicht a ls die richtigere fealliäll, nnd ich iim v isch cn (ielegenlieit
gefunden habe, eine g rö ssere Anzahl von Fällen zn beobachten,
aus denen so g a r h e rv o ig e lit, d a ss bei den Reptilien des lithogra-
phisclien Schiefers die v e rdrehte Lage der Füs se die gewöhn-
liebere is t, so erachte ich es nicht für ü b e rflüssig, diese Fälle niil-
ziitheilen, znmai mehrere v on den Versteinerungen, wo rau f meine
Angaben b e ru h en , sich u n te r Wagner’s Aufsicht befinden.
Nicht allein bei dem erwäliiiteii Exemplar vo n Pterodactylus
Kochi (Tiif- III. Fig. I ) , sondern auch bei dein kleinsten von Ptero d
actylus longirostris (Taf. 1. Fig. 1) liegt der Stümmel an der
Innenseite. Dies bewe ist indess n ichts für die Richtigkeit seiner
Lage. Bcsässeii wir eine g rö s se re Anzahl von Pterodaclyln mit
F ü s s e n , so würde der Stümmel bald innen, bald aussen walirge-
uoinmcii werden, wie dies bei anderen Keplilicii d ieses Schiefers der
Fall ist. Bei Ilonioeosaurus neplunius (Taf. XII. Fig. 3 ) liegen der
Daumen und die g ro s se oder Daimieiizehe beider Bände und Füsse
a u ssen, bei llomoeosaurus .Maximilinni der Oberndorfer’schen Sammlung
(Taf XI- Fig. 1) liegt der Daumen innen und die Daiimenzehe
des einen Fn s ses in n e n , die des ändern a u s s e n , so d a ss hier bei
dem einen oder dein ändern der beiden Füsse eine Verdrehung
v o r sich gegangen seyn muss. Die Möglichkeit einer Verdrehung
is t daher unwiderleglich d a rgethan. Bei dem Leuchtenhcrgisclicn
Exemplar derselben Species (Taf. XI. Fig. 4 ) liegen der Daumen
und die Daiimenzche beider Füs se a u s s e n , bei llomoeosaiinis macro-
d aclyius (Taf. XI. Fig. 5 ) der Daumen nnd die Daumeiizehe beider
Hände und Füs se au ssen, w.is auch für H. brevipes (Taf. XII. Fig. 4)
gilt. Bei Sapheosanriis laticeps (Taf. XIII. Fig. 2 ) liegt der Daumen
in n e n , die Daiimenzehe beider F ü s se au ssen. Selbst bei den Schildkröten
d ieses Schiefers kommen Fälle vo r, au s denen zu ersehen ist,
d a ss die Hände oder Füs se Verdrehungen e rfahren haben, ln Idio-
chclys Wagnerorum (Taf. XVIll. Fig. 1) und in J. Filzingeri (Taf.XVH.
Fig. 2 ) liegt die Daiimenzehe a u s s e n , in der g ro ssen Schildkröte
der überiidorfer’schen Saiuniluiig (Taf. XX. Fig. 1) der Daumen
aiisson.
Der Stümmel könnte dem Knochen verglichen w e rd en , der
au ssen neben der kleinen Zehe in dem ebenfalls nur vierzehigen
Crocodil auftritt. Er be steh t aber au s zwei (Pte rodactylus longiro
s tris ) oder drei Gliedern, w a r ohne Klauenglied, und erinnert
daher mehr an die kleine Zehe der Sch ild k rö ten , deren Mittelfnss-
knochen aucli s e h r kurz hakenförmig gekrümmt is t und au ssen-an
die Fu s sw iirze l'‘ein len k t, doch sind die eigentlichen Glieder der
kleinen Zehe in den Schildkröten gewöhnlich zahlreicher und länger
a ls im Stümmel. Es koniuil in d e s s , namentlich bei den Landschildkröten
und Emydiden auch v o r, d.ass die kleine Zehe mehr rudimentä
re r Art is t, wo sie alsdann g rö ssere Aelinliclikeit mit dem Stümmel
in den Pterodactyin dnrbietet. Auch findet sich in den Laccrten,
d a ss der -Miltelfiissknoehen der kleinen Zehe kurz und hakenförmig
g e staltet i s t , wobei die Zehe so n st voilkommen ausgcbildet und
z ahlreicli an Gliedern e rs c h e in t, w a s vom Sliimmei nicht gesagt
werden k a n n , der h ö chstens für ein Zelieii-Riidimenl oder verkümmerte
Zelle gelten k a n n , nnd a ls solches wohl die kleine Zehe v e rtreten
m ag ; er is t gleichsam ein Mittelding vo n d em. w a s man in
Crocodil, den Laccrten und den Selüldkröten wahrnimml.
ln den Pterodaclyln waren die v ier aiisgebildeten Zehen mit
Klanen v o rseh e ti, die sich g e rin g e r, bisweilen auffallend geringer
a ls die Klauen der kurzen Finger darstelltcn. Es ist dies gerade das
Gegentlieil von dem, w a s bei den Vögeln walivgcnommeii wird,
deren Fnss überhaupt von eigenthüiiilicher Bescliaffenlieit i s t ; während
die Ptei odactyln einen ächten Reptilien - Fnss besitzen. In den
Fledermäusen be steh t der Fuss au s fünf v ollständig entwickelten,
fast gieichlangeii Zehen.
Die Füsse und überhaupt die hinteren Glicdmaassen in den
Pterodactyin waren an lAinge inid Stärke sc lir v e rsch ied en ; sie
konnten so kurz und sclnimch s e y n , d a s s sie dem Tliier kaum ge-
s la tlc le ii, da rau f zu n ilien , mul niicli eine solche Stärke erreichen,
d a ss sie ein bequemes Gehen a u f dem Lande erlaubten.
II a u t.
Ueber die Beschaffenheit der Haut bestehen abweichende Ansichten,
Goldfuss will auf dem S te in , w o ra u f der Pterodactylus
e ra ssiro stris lieg t, AiideiKiingen von Haaren und Federn vorgellfim.
V. .Mcjvr, Ilihogr. Schlcfur.
fanden haben, die ich an derselben Versteinerung nicht wahrnehmen
konnte. Eine völlig entwickelte Flu g h au t, wie sie sich in der Nähe
des Flugfingers einiger Pterodactyin angedeutet erhalten h a t, würde
eine Befiederung ntisschliessen. Wir linden w o h l, d a ss die Natur
reich a u s s ln tte i, nicht ab er, d a ss sie zur Erreichung eines bestimmten
Zwecks verschwenderisch v erfährt. Auf die Gegenwart von
Schwungfedern könnte wohl daraus g e schlossen w erd en , dass das
Fliigorgan, wie in den Vögel, nur in einem einzigen Finger besieht.
Nirgends aber habe ich an den Knochen oder so n s t Andeutungen
gefunden, weiche auf Schwnngfedurn schliessen liessen, für die schon
der lange steife Finger einen Ersatz bol. Auch bemerkt Charles
Bell (Die menschliche ilnnd. Deutsch. Stultg. 1836. S. 4 7 ) vom
Pterodactylus se h r rich tig : „Das Thier konnte so wenig befiedert
s e y n , a ls es einen eigentlichen Schnabel h alle. Kein Thier hat
Fed e rn , ohne einen Schnabel, sie zu ordnen nnd zu putzen.“ —■
Lässt sich auch aus der Federbedeckung auf einen Schnabel schlic.s-
s e n , so kann doch nicht umgekehrt behauptet werd en , dass ein
Schnabel notiiweiidig Federn e rfordere; cs war wenigstens das
Sehnäbelclien, welches ich an der Sclinautzspitze von Rhamplior-
h ynchus Gemmingi ve rm u th c, so g e rin g , dass cs den Dienst, den
eine Befiederung v e rla n g t, nicht h ä tte v e rsehen können. Zudem
liegt im lebenden Ornithorliynchus der Fall v o r , wo eine Art von
Schnabel iiielil mit Befiederung, sondern mit Behaarung verbunden
ist. Ein weiterer Grund gegen eine Befiederung bei den Pterodaclyln
b esieht d a rin , d a ss es keine Vögel, wohl aber Pterodaclyln mit
langem Schwänze g ie b t, und dass se lb st in den kurzschwänzigen
der letzte Schwanzwirbel nicht die auffallende Grösse und Form
vom letzten Schwanzwirbel in den Vögeln z e ig t; es is t vielmehr das
Ende des Schwanzes in den Pterodaclyln überhaupt beschaffen wie
in iinbefiederteii Tliieren.
Quenstedt (Pe trefak ten k ., S. 13 9 ) will in der Sammlung des
Dr. Häberlcin zu Pappenheiin einen grossen Pterodactylus in hartem
Gestein ge.sehen h a b en , dessen Körper und Flughaut über und über
mit feinen nadelförmigen Eindrücken bedeckt w a ren , die er für die
Reste eines struppigen Felles h ä lt, und au f der Flughaut glaubt er
so g a r noch undeutliche Verzweigungen cinns Adernnetzes bemerkt
zu haben. Die Versteinerung, der Quenstedt g ed en k t, wird nach
Haarlem oder naeh München gekommen seyn. Ich habe sie aber
weder in den Sammlungen zn Haarlem g c sciien , noch wird aus der
paläontologisehen Sammlung zu München über eine .ähnliche Hautbe-
deckuiig an Ptcrodactyln b e ric h te t, die ich auch an den von mir
u n tersuchten Pterodactyin nicht wahrnehmen konnte.
Mit Schuppen, wie Cuvier g lau b t, wird die Haut noch viel
weniger bedeckt gewe sen s e y n ; es würden sich so n s t Spuren
davon überliefert finden, da se lb st Abdrücke von der weicheren
Haut sich erhalten h ab en , und von ändern Sauriern aus demselben
Gebilde se h r z arte Schuppen vorliegen. Für ein fliegendes Thier
würden auch Schuppen wenig geeignet gewe sen sey n und die Geschmeidigkeit
einer Flughaut beeinträchtigt haben.
Es lä s s t sich daher kaum anders denken, als dass die P te ro dactyin
mit einer Fiugliaut v e rsehen w a ren , und dass diese Haut
überhaupt nackt gewe sen, worauf auch noch die Heimlichkeit von g e w
issen Theilen des K nochen-Skclels mit nackten Sauriern, namentiich
mit Chamneleon, so wie der Spannknochen schliessen lassen. Die
Flughaut scheint nicht wie in den Fledermäusen mit den llinter-
füssen iu Vcrbimiung gestanden zu haben, liierin glich alsdann das
Fhigorgan der Pterodactyin dem der Vögel, und es erklärt sieh
daraus auch die schmale Fo rm, die die Flughaut nach den von ihr
vorliniidenen Andeutungen, so wie nach der Kürze des Spann-
kiiochens besass. Die Pterodactyin «'a ren aber sicherlich keine
schlechten Flieg e r, w a s ihren Flügeln an Breite abging, ersetzte
ihnen die g rö ssere Lange.
Die Beschaffenheit der einzelnen Skelettheile b e stätig t sonach
vollkommen die An sic h t, dass die Pterodactyin fliegende Reptilien
waren. In diesen Thieren liegt gleichsam ein Kampf des Typus des
Vogels mit dem des Saurus aiisgedrüokl. Vom Säugethier linden
sich nur wenig Anklänge vor. Bald g ewinnt der Vogel, bald der
Saums die Oberhand, oder die Typen beider sind auf eine Weise
g em en g t, dass es sc hwe r fä llt, sich für den einen oder den ändern
zu entscheiden- Wenn K o p f, Hals, Scluilter und Rucken au Vogel
■riii