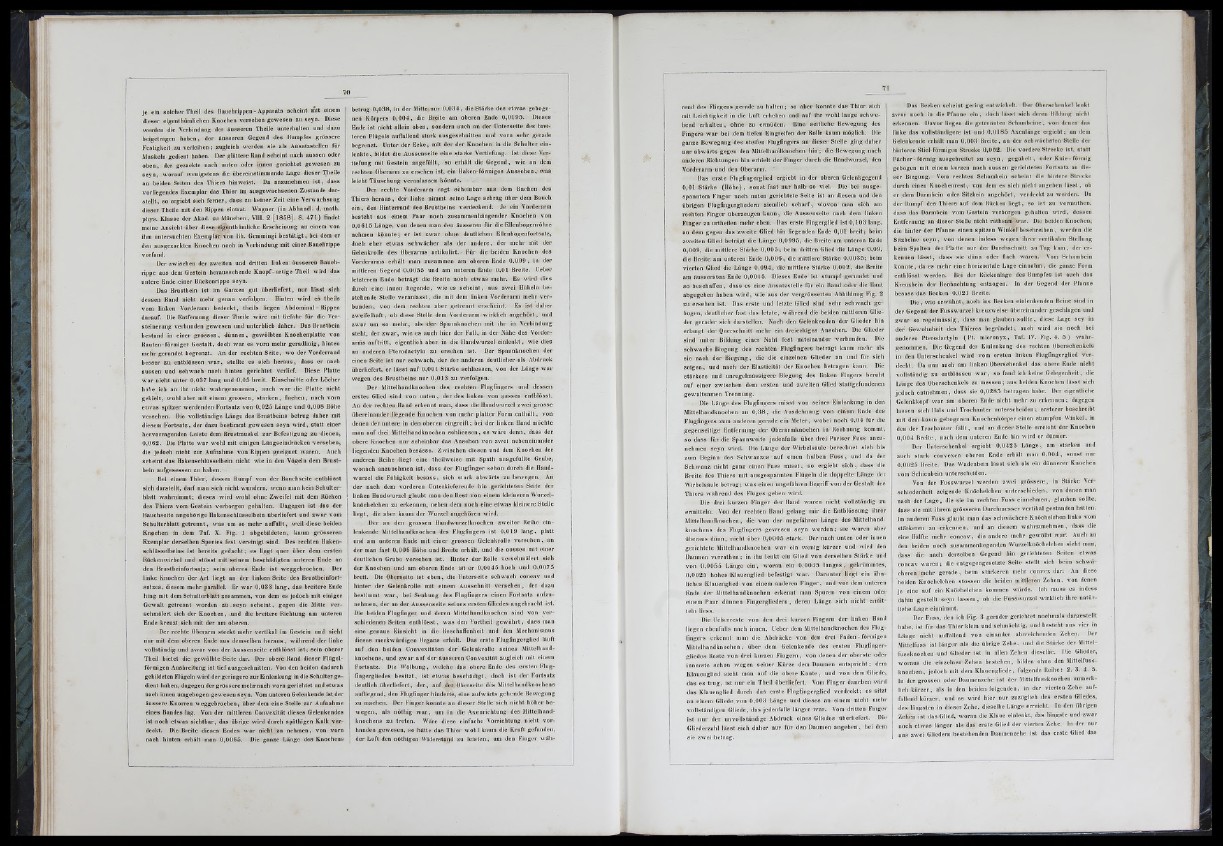
je ein solcher Theil des Banehrippen - Apparats scheint mit einem
dieser cigeiilhiimlichen Knochen versehen gewe sen zu seyn. Diese
werden die Verbindung der äusseren Theile u nterhalten und dazu
beigetrftgen h a b en , der ä u sseren Gegend des lliiropfes g rö ssere
Festigkeit zu ve rle ih en ; zugleich werden sie als Ansalzstellen für
.Muskeln gedient haben. Der glä tte re Band scheint nach au ssen oder
o b e n , der gezackte nach unten oder innen g e richtet gewe sen zu
s e y n , wo rau f wen ig sten s die übereinstimmende Lage dieser Theile
an beiden Seiten des Thiers h inwe ist. Da anzunehmen i s t , dass
vorliegendes E.xemplar das Thier im ausgewachsenen Zustande dnr-
s le llt, so ergiebt sich fe rn e r, dass zu keiner Zeit eine Verwachsung
dieser Theile mit den Kippen e in trat. Wagner (in Abhandl. d. malh.
phys. K lasse der Akad. zn Münclien, Vlll. 2 [1 8 5 8 ]. S. 4 7 1 ) findet
meine Ansicht über diese eigenthiimliche Erscheinung au einem von
ihm untersuchten Exemplar von Kh. Gemmingi b e s tä tig t, bei dem er
deu ausgezackten Knochen noch in Verbindung mit e iner Baiichrippe
vorfand.
Der zwischen der zweiten und dritten linken ä u sseren Baiichrippe
aus dem Gestein hevaussehende K n o p f-a rtig e Theil wird das
untere Ende einer Rückenrippe seyn.
Das Brustbein is t im Ganzen gut ü b e rliefert, n u r lä s s t sich
dessen Rand nicht mehr genau verfolgen. Hinten wird e s theils
vom linken Vorderarm b ed eck t, th e ils liegen Abdominal-Rippen
darauf. Die Entfernung dieser Theile wäre mit Gefahr für die Versteinerung
verbunden gewe sen und unterblieb daher. Das Brustbein
bestand in einer g ro s s e n , d ü n n e n , gewölbten Knochenplalte von
Raulen-föriiüger G estalt, doch w a r es vo rn mehr geradlinig, hinten
mehr gerundet begrenzt. An der rechten S e ite , wo der Vorderrand
besser zu entblössen w a r , stellte e s sich h e ra u s , d a ss er nach
aussen und schwa ch nach hinten g e richtet verlief. Diese Piatte
w a r n icht u n te r 0,0.37 lang und 0 ,0 5 breit. Einschnitte oder Löcher
habe ich an ih r nicht wahrgenommen, auch w a r die Platte nicht
g ek ielt, wohl aber mit einem g ro s s e n , s ta rk e n , flach en , nach vorn
e tw as spitzer werdenden Fo rtsa tz von 0 ,0 2 5 Länge und 0 ,0 0 8 Höhe
ve rseh en . Die voflsländige Länge des Brustbeins betrug daher mit
diesem F o rts a tz , der dazu bestimmt g ewe sen seyn w ird , s ta tt einer
hervorragenden Leiste dem Brustmuskel zur Befestigung zu dienen,
0 ,0 6 2 . Die Platte w a r wohl mit einigen Längseindrücken v e rs e h en ,
die jedoch nicht zur Aufnahme vo n Rippen geeignet w a ren . Auch
scheint das Hakenschlüsselbein n icht wie in den Vögeln dem Brustbein
aufgesessen zu haben.
Bei einem T h ie r, dessen Rumpf von der Bauchseite eniblösst
sich darslellt, darf man sich n icht wundern, wenn man kein Schulterblatt
wahrnimmt; dieses wird wohl ohne Zweifel mit dem Rücken
des Thiers vom Gestein v erborgen gehalten. Dagegen is t das der
Bauchseite angehörige Hakenschlüsselbein überliefert und zw a r vom
Schulterblatt g e tre n n t, w a s um so mehr auffällt, weil diese beiden
Knochen in dem Taf. X. Fig. 1 ab gebildeten, kaum g rö sseren
Exemplar derselben Species fest vereinigt sind. Des rechten Haken-
schlüsselbeins is t b e re its g e d a c h t; e s liegt quer über dem e rsten
Rückenwirbel nnd s tö s s t mit seinem beschädigten unteren Ende an
den K ru s lbeinfortsatz; sein oberes Ende is t weggebrochen. Der
linke Knochen der Art liegt an der linken Seite des Brustbeinfortsa
tz e s , diesem mehr parallel. Er w a r 0 ,0 3 3 lan g , das breitere Ende
hing mit dem Schulterblatt zusammen, von dem es jedoch mit einiger
Gewalt g e tren nt worden zu sey n s c h e in t, gegen die Mitte v e rschmälert
sich der Knochen, und die breitere Richtung am unteren
Ende kreuzt sieh mit der am oberen.
Der rechte Oberarm ste ck t mehr v e rtik al im Gestein und sielit
nur mit dem oberen Ende aus demselben h e ra u s , während der linke
vollständig und zwa r von der .Aussenseite en tb lö sst is t ; sein oberer
Theil bietet die gewölbte Seite dar. Der obere Band d ieser Flügel-
förmigen Ausbreitung ist tie f au sgeschnitten. Von den beiden dadurch
gebildeten Flügeln wird der geringere zur E inlenkung in die S chulter gedient
haben, dagegen der g rö s s e re mehr nach vorn gerichtet und e tw as
nach innen umgebogen gewe sen seyn. Vom unteren Geienkende is t der
ä u ssere Knorren w eg gebrochen, über dem eine Stelle zur Aufnahme
eines Bandes lag. Von der mittleren Convexität d ieses Gelenkcndes
is t noch e tw as s ic h tb a r, das übrige wird durch späthigen Kalk v e rdeckt.
Die Breite dieses Endes w a r nicht zu n ehmen , vo n vorn
nach hinten e rh ä lt man 0 ,0 0 6 5 . Die ganze Länge des Knochens
betrug 0 ,0 3 8 , in der Mitte nur 0 ,0 3 4 , die Stärke des e tw a s gebogenen
Körpers 0 ,0 0 4 , die Breile am oberen Ende 0 ,0 1 9 5 . Dieses
Ende is t nicht allein o b en , sondern auch an der Unterseite des breiteren
Flügels auffallend sta rk auagescliiiilteu uud vo rn s e h r ger.ide
begrenzt. Unter der Ecke, mit der der Knochen in die Schulter ein-
leiikte, bildet die Au ssen seite eine sta rk e Vertiefung. Ist diese Vertiefung
mit Gestein an g efü lll, so e rh ä lt die Gegend, wie an dem
rechten überarm zu ersehen is t, ein ü a k en -föiiniges A u sseh en , was
leicht Täuschung v e ran las sen könnte.
Der rechte Vorderarm rag t sch einbar a u s dem Rachen des
Thiers h e ra u s , der linke nimmt seine Lage sch räg über dem Bauch
e in , den Hinterrnnd des Brustbeins verdeckend. Je ein Vorderarm
be steh t a u s einem Pa a r noch zusammenhängender Kuochen von
0 ,0 6 1 5 Länge, von denen man den äu sseren für die Ellenbogenröhre
nehmen k ö n n te ; e r is t zwa r o hne deutlichen Eilenbogeiifortsnlz,
doch eh er e tw a s s chwä ch e r a ls der a n d e re , der mehr mit der
Gelenkrolle des Oberarms a rtikiilirt. Für die beiden Knochen des
Vorderarms e rhä lt man zusainmeu am oberen Ende 0 ,0 0 » . iu der
initiieren Gegend 0 ,0 0 5 5 und am unteren Ende 0,01 Breite, lieber
letzterem Ende b e tragt die Breile noch e tw a s inelir. Es wird dies
durch eine iuiien liegende , wie e s s c h e in t, ans zwe i Hübelu bestehende
Stelle v e ra n la s s t, die mit dem linken Vorderarm mehr v e rb
u nden, von dem recliten ab er g e tren n t ersch ein t. Es ist daher
zw'eifelhaft, ob diese Stelle dem Vorderarm wirklich a n g eh ö rt, und
zwa r um so m e h r, als der Spannkuoelieii mit ihr in Verbindung
s te h t, der zw a r, wie es auch h ier der Fa ll, in der Nähe des Vorderarms
a u ftritt, eigentlich aber in die Handwurzel e in len k t, wie dies
an anderen Pierodaclylu zu e rseh en ist. Iler Spannknochen der
einen Seite is t uur s c hwa ch , der der anderen deiitliclier a ls Abdruck
überliefert, e r lä sst a u f 0,001 Starke sch lie ssen , von der Länge w a r
wegen des Brustbeins nur 0 ,0 1 3 zu verfolgen.
Der Mittelhandknochen des rechten Flugfiiigers und dessen
e rs te s Glied sind von u n te n , der des iiuken vo n au ssen en tblösst.
An der rechten Hand erkennt man, d a ss die Handwurzel zw'ei g ro sse
ü bereinander liegende Kuochen von mehr p la tte r Form e n th ä lt, von
denen der un te re in den oberen e in g re ift; bei der linken llaiid möchte
man a uf drei .Mittelhandknochen s c h lie s s en , es wäre d e n n , d a ss der
obere Knochen n u r sch ein b a r das Ansehen von zwei nebeneinander
liegeiideii Knochen b e sässe . Zwischen diesen und dem Knochen der
anderen Keilie liegt eine th e ilw eise mit Spatii ausgefullte Grube,
w onach anzuneiinien is t , d a ss der Fluglinger schon durch die ilaiid-
wiirze! die Fähigkeit b e s a s s , sich s ia rk a bw ä rts zu bewegen. An
der nach dem vorderen Unterkieferende hin g e richteten Seite dev
linken Handwurzel glaubt man den Rest vo n einem kleineren Wurzel-
k nöeheleben zu erkennen, neben dem noch eine e tw a s kleinere Steile
lie g t, die aber kaum der Wurzel angehöreu wird.
Der an den g ro ssen Ilandwurzelkiiochen zwe ite r Reihe ein-
leiikeude .Miltelhandknoclien des Fiugfingers is t 0 ,0 1 9 la n g , platt
und am unteren Ende mit einer g ro s s en Gelenkrollc v e rs e ile n , an
der man fast 0 ,0 0 6 Höhe und Breite erh ä lt, und die au ssen mit einer
deutlichen Grube ve rseh en ist. Hinter der Rolle ve rschmä lert sich
der Knochen und am oberen Ende is t er 0 ,0 0 4 5 hoch und 0 ,0 0 7 5
breit. Die Überseite is t eb en , die Unterseite schwacli concav und
hinter der Gelenkrolle mit einem A u sschnitt v e rs e h e n , der dazu
bestimmt w a r , bei Senkung des Flugiiugers einen F o rtsa tz aufzunehmen,
der an der Au ssenseite se in es e rsten Gliedes an gebracht ist.
Die beiden Flugfinger uud deren .Mitlelhandknoelien sind vo n v e rschiedenen
Seilen e n tb lö s s t, w a s den Vortlieil g ew a h rt, d a ss mau
eine genaue Einsicht in die Beschaffenheit und den Meehaiiisiiius
d ieses merkwürdigen Ürgans erliält. Das e rste Fiugfingerglicd läuft
auf den beiden Convexitäten der Gelenkrolle seines Mittelliaiid-
k nochens, und zw a r auf der äu sseren Convexität z.ugleich mit einem
Fortsatz. Die Wölbung, welche das obere Ende des e rsten Fliig-
fiiigergliedes b e s itz t, is t e tw a s bc scliäd ig t, doch ist der Fo rtsa tz
deutlich übe rliefert, d e r, a u f der Oberseite des Mitlelhaiidknciclieiis
flulliegeiid, den Flugfiiiger hinderte, eine au fw ärts gehende Bewegung
zu machen. Der Finger konnte an d ieser Stelle sich n icht höher bew
e g e n , a ls nöthig w a r , um in die Axenrii-Iitung des Millellinnd-
kiiochens zu treten . Ware diese einfache Vorriciitung iiic-lit v o rhanden
gewe sen, so h.ätte d a s Thier wolil kaum die Kraft gefiindeu,
der Luft den iiöfhigen Widerstand zn le is te n , um den Finger w äh rend
des Fliegens gerade zu h a lfen ; so aber k o nnte das Thier sieh
mit Leichtigkeit in die Luft erheben und au f ihr wohl lange schwe bend
e rh a lte n , ohne zu ermüden. Eine seitliche Bewegung des
Fin g ers w a r bei dem tiefen Eingreifen der Rolle kaum möglich. Die
g anze Bewegung des steifen Flugfiiigers an dieser Stelle ging daher
nur a bw ä rts gegen den Miltelhandknoehen h in ; die Bewegung naeli
anderen Richtungen hin erhielt der Finger durch die Handwurzel, den
Vorderarm und den Oberarm.
Das e rs te Flugfingergiied e rgiebt in der oberen Geleiikgegend
0 ,01 Stärke (H ö h e ), so n s t fast nur halb so viel. Die bei ausge-
spanntem Finger naeh unten g e rich te te Seite is t an diesem und den
übrigen Flugfingergliedern ziemlich s c h a r f, \vovon man sich am
rechten Finger überzeugen k a n n , die Au ssen seite nach dem linken
Finger zu urtheilen mehr eben. Das e rste Fingcrglied is t 0 ,1 0 3 lang,
an dem gegen das zwe ite Glied hin liegenden Ende 0,01 b re it; beim
zweiten Glied b eträgt die Länge 0 ,0 9 9 5 , die Breite am unteren Ende
0 ,0 0 9 , die mittlere Stärke 0 ,0 0 5 ; beim dritten Glied die Länge 0 ,0 9 ,
die Breite nm unteren Eude 0 ,0 0 6 , die mittlere Stärke 0 ,0 0 3 5 ; beim
vie rten Glied die Länge 0 ,0 9 4 , die mittlere Stärke 0 ,0 0 2 , die Breite
am ä n sserste n Ende 0 ,0 0 1 5 . Dieses Ende is t stumpf gerundet und
so b e schaffen, d a ss cs eine Ansatzstelle für ein Band oder die Baut
abgegeben haben w ird , wie aus der v e rg iü s se rte n Abbildung Fig. 2
zu erselieii ist. Das e rste und letzte Glied sind seh r sc ln v ach ge-
liogcii, deullieiicr fast das le tzte, wälirend die beiden mittleren Glieder
ge rad er sich darstellen. Nach den Gelenkenden der Glieder hin
e rlangt der Querschnitt mehr ein dreieckiges Ansehen. Die Glieder
sind u n te r Bildung e iner Naht fe s t miteinander verbunden. Die
s chwa ch e Biegung des rech ten Flugfingers be träg t kaum melir als
sie nach der B iegung, die die einzelnen Glieder an uud für sich
z eig en , und nach der E la stic itä t der Knochen betragen kann. Die
s tä rk e re uud uiiregeimässigere Biegung des linken Fingers beruht
a u f e iner zwisch en dem e rsten und zweiten Glied staltgefiindeneii
g ewaltsamen Trennung.
Die Länge des Fiugfingers misst vo u se in er Einienkung in den
Mittelhandknochen an 0 ,3 8 , die Ausdehnung von einem Ende des
Fiugfingers zum anderen ge rade ein .Meter, wobei noch 0 ,0 4 für die
g eg en se itig e Eiitfeniung der Überarniknochen in Rechnung kommt,
so da ss für die Spannweite jedenfalls über drei Pa rise r Fu s s anzu-
nehmen sey n wird . Die Länge der Wirbelsäule berechnet sich bis
zum Beginn des Schwanzes auf einen halben F n s s , uiiil da der
Schwanz nicht ganz einen Fu s s m is s t, so ergiebt s ic h , d a ss die
Breite des Th ie rs mit aiisgcspaniiteii Flügeln die doppelte Länge der
Wirbelsäule be tru g ; w a s einen ungefähren Begriff vou der Gestalt des
T h ie rs w ährend des Fluges geben wird.
Die drei kurzen Finger der Ilaiid waren n icht v ollständig zu
ermitteln. Von der rech ten Band gelang mir die Eniblössung ihrer
Mittelhandknochen, die vo n der ungefähren Länge des .Mittelhand-
knochens des Flugfingers g ew e sen sey n w e rd en ; sie waren aber
ü b eraus dünn, nicht über 0 ,0 0 0 5 sta rk . Der nach unten oder innen
g e lich tete .M ittelhaiidknochen w a r ein wen ig kürzer und wird den
Dniiineu v e rra th e n ; iu ihn lenkt ein Glied vo n derselben Stärke und
vou 0 .0 0 5 5 Länge e in , woran ein 0 ,0 0 4 5 la n g e s , gekrümmtes,
0 ,0 0 2 5 h ohes Klauenglied befestigt tva r. Darunter liegt ein ähnliches
Klauenglied von einem aiidereii F in g er, und v o r dem uiilereu
Ende der .Mittcllinndknocheii evkemil man Spuren vo n einem oder
eiiioui Pa a r düuiien Fin g erg lied ern , deren Länge sich n ich t ermitteln
liess.
Die Ueberreste vo n den drei kurzen Fingern der linken Hand
liegen ebenfalls nach innen. Ueber dem .Miltelhaiidkuochcn des Fliig-
iingers erk en n t mau die Abdrücke von den drei Faden - förmigen
Milleliiiiudknoelien, über dem Gelenkende des e rsten Flugfingergliedes
Reste vou drei kurzen F in g e rn , vou denen der ob e rste oder
innerste schon weg en se in er Kürze dem Damnen e n tsp rich t; dem
Klaiiouglied sie lit man a u f die obere K an te, und vo n dem Gliede,
d as e s tru g , is t nur ein Tlieil überliefert. Vom Finger daneben wird
d a s Klauenglied durch das e rste Flugfingergiied v e rd e ck t; es sitzt
au einem Gliede v on 0 ,0 0 3 Länge und d ieses an einem n icht mehr
vollsläudigeii Gliede, das jedenfalls länger w a r. Vom dritten Finger
is t mir der unvollständige Abdruck eines Gliedes überliefert. Die
Gliederzalii lä sst sich daher uur für den Daumen a iigeb en , bei dem
sie zwei betrug.
Das Recken scheint gering entwickelt- Der Oberschenkel lenkt
zwar noeh in die Pfanne e in , diieh la sst sieh deren Bildung nichl
e rkennen. Davor liegen die gelreiiiiten Schambeine, von denen das
linke das vollständigere is t und 0 .0 1 8 5 Axeiilängc e rg ieb t; an dem
Gelenkende erhält man 0 ,0 0 3 Bre ite, an der sehwä eh s len Stelle der
hinteren Stiel-förmigen Strecke 0 ,0 0 2 . Die v o rdere Strecke ist, sla tt
F ä c h e r-fö rm ig nasgebreitet zu s e y n , g e g ab e lt, oder Knie • föiniig
gebogen mit einem kurzen nach au ssen gericlitelen Fortsatz an diese
r Biegung. Vom rechten Schambein scheint die hintere Strecke
durch einen Kn oclieiirest, von dem cs sich nicfit aiigeben lä s s t, ob
er dem Darmbein oder Sitzbein an g eh ö rt, verdeckt zu weiden. Da
der Rumpf des Tliiers au f dem Rücken lie g t, so ist zu vermulhen,
d a ss das Darmbein vom Gestein verborgen gehalten w ird , dessen
Eiitfeniung an d ieser Stelle nicht rathsam war. Die beiden Kiiocheii,
die liiiiter der Pfanne einen spitzen Winkel be sch reib en , werden die
Sitzbeine s e y n , vo n denen indess wegen ih rer vertikalen Slellung
beim Spalten dev Platte nur der Durchschnitt za Tag kam, der e rkennen
lä s s t , d a s s sie dünn oder Ilach waren. Vom ScliHiiibein
k o n n te , da es mehr eine horizontale Lage eiiiiiahm, die ganze Form
e n iblösst werden. Bei der Rückenlage des Rumpfes ist auch das
Kreuzbein der Beobachtung eiilzogeii. lu der Gegend der Pfanne
besass das Becken 0,021 Breite.
Die, wie e rw äh n t, noeh ins Becken einicnkcuden Beine sind in
der Gegend der Fusswurzel k reuzweise übereinander geschlagen uud
zwa r so reg e lm ä ssig , da ss mau glauben so llte , diese Lage se y in
dev Gewohnheit des Thieres begründet; auch wird sie noeh hei
anderen Pterodactyin ( P t . micronyx, Taf. IV. Fig. 4. 5 ) w ah i-
genomnien. Die Gegend der Einienkung des rechien ü b erschenkeis
in den Unterschenkel wird vom e rsten linken Flugfingergiied v e rdeckt.
Da nun auch am linken Oberschenkel das obere Eude nicht
vollständig zu entblössen w a r , so fand ich keine Gelegenheit, die
Länge des Oberschenkels zu m e ssen ; aus beiden Kuochen lä sst sich
Jedoch entnehmen, d a ss sie 0 ,0 2 8 5 betragen habe. Der eigentliche
Gelenkkopf w a r am oberen Eude nicht mehr za erk en n en ; dagegen
la ssen sieh II.ils und Trochanter un te rsch e id en ; e rs te re r beschreibt
mit dem kaum gebogenen Knocheiikörper einen stumpfen Winkel, in
den der Trochanter fä llt, und an dieser Stelle erreicht der Knochen
0 ,0 0 4 Bre ite, nach dem unteren Ende hin wird er dünner.
Der Unterschenkel ergiebt 0 ,0 4 2 5 L än g e , am sta rk en und
auch sta rk convexen oberen Ende e rhä lt m.iii 0 ,0 0 4 , so n st nur
0 .0 0 2 5 Breite. Das Wadenbein lä s s t sich als ein dünnerer Knochen
Von der Fu s swu rz el werden zwei g rö s s e r e , in Stärke Verschiedenheit
zeigende Knöchelchen u n te rsch ied en , von denen man
nach der L ag e , die sie im rechten Fu s s einnehmen, glauben sollte,
d a ss sie mit ihrem grö sseren Durchmesser vertikal gestanden hätten.
Im anderen Fnss glaubt man das schwächere Knöchelchen links vom
s tä rk eren zu e rk e n n en , und an diesem wah izu n ehm en , d a ss die
eine Hälfte mehr c o n c a v , die andere mehr gew'ölhl war. Auch an
den beiden noch zusammenlicgencien W'urzelknöchelchen sieh t man,
d a ss die nach der.selben Gegend hin gcrichleteii Seilen e tw as
concav w a re n ; die en tgegengesetzte Seite ste llt sich beim schwä cheren
melir g e ra d e , beim s tä rk eren mehr convex dar; An diese
beiden Knöchelchen sto ss en die beiden mittleren Zeh en , von denen
je eine auf ein Knöchelchen kommen würde. Ich muss es indess
dahin ge steh t seyn la s s e n , ob die F iissu iirz e! wirklich ihre natürliche
Lage einnimmt.
Der Fuss. den ich Fig. 3 gerader gerichtet nochmals dargestellt
h abe, ist für das Thier klein und schmächtig, nnd be steh t aus vier in
Länge n icht aiiffalleiid vo n einander abweichenden Zehen. Der
.Miilelfiiss is t länger als die übrige Zehe, und die Stärke der Miltel-
fiisskuoeheii und Glieder is t in allen Zehen dieselbe. Die Glieder,
w o ra u s die einzelnen Zehen be steh en , bilden ohne den Mittelfuss-
k n o c h en , jedoch mit dem Klauengliede. folgende Reihe: 2 . 3. 4. 5.
In der g ro ssen oder Dauraenzehe is t der Mitlelfussknochen unmerklich
k ü rze r, als in den beiden folgenden, in der v ierten Zehe auffallend
k ü rze r, mid es wird hier nur zuzüglich des e rsten Gliedes,
des längsten iu dieser Zehe, dieselbe Länge erreicht. In den übrigen
Zehen is t das Glied, wo ran die Klaue einlenkt, das längste und zwar
noch e tw as länger a ls das e rste Glied der vierten Zehe. In der nur
ans zwei Gliedern bestehenden Dancieiizehe is t das e rste Glied das