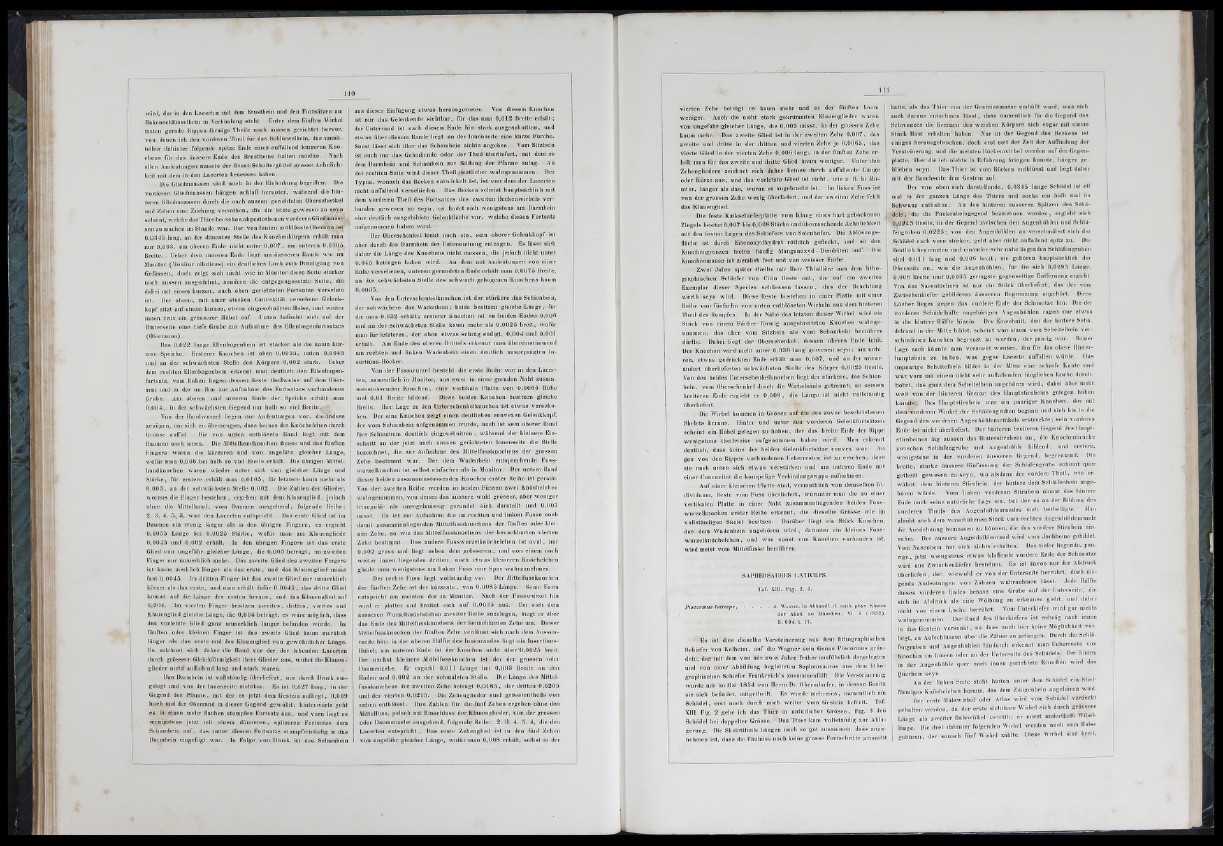
wirii, der 1 den Lacerlim mit dem Bnistbein und den Fortsätzen am
sselbein in Vcrbiiidiiiig steh t. Unter dem fünften Wirbel
treten gerade Rippen-föriuige Theile nach au ssen gerichtet hervor,
von denen ich den vorderen Tlieil für das Schlüsselbein, das «nmil-
lelbnr dahinter folgende spitze Ende e ines (iiiffnllend kürzeren Knochens
iTir das äussere Ende des Brustbeins halten möchte. Nach
allen Andeutungen musste der Brust-Scliultergiirlel g ro s s e Aehnlichkeit
mit dem in den Lacerten b e sessen haben.
Die Gliedmaassen sind noeh in der Einienkung begrilTen. Die
v orderen Gliedmaassen hängen sclitnff h e ru n te r, während die hinteren
Gliedmaassen durch die nach aussen gerichleten Oberschenkel
und Zehen eine Znckiiiig v e rra th en , die die le tzte.g ewe sen zu seyn
scheint, welche das Thier bei schon abgestorbenen vorderen Gliedinana-
seii zn machen im Stande war. Der von hinten en tb lö sste Oberarm ist
0 ,ü 3 4 5 lang, an der dünnsten Stelle des Knochenkörpers erhalt man
mir 0 ,0 0 3 , am oberen Ende nicht unler 0 ,0 0 7 . am unteren Ü.OlOü
Breite. Ueber dem unteren Ende liegt am ä u sseren Rande wie im j
Monitor (.Monitor niloticus) ein Jentliehes Loch zum Durchgang von ;
Gefäs sen , doch zeigl sich nicht wie in Monitor diese Seite stä rk er
nach an ssen au sg ed eh n t, sondern die en tgegengesetzte S e ite , die
dabei mit einem ku rzen , nach oben geriehtelen Fo rtsa tz e verseilen
ist. Der o b e re , mit einer sta rk en Uonve.xilät v e rsehene Geienkkopf
sitzt auf einem kurzen, e tw as eingeschuurfen Halse, und weiter
innen tritt ein g rö ssere r Hübel auf. Unten befindet sich auf der
Hinterseite eine tiefe Grube zur Aufnahme des Ellenbogenfoilsatzes
(Uiecraiioii) .
Das 0 ,0 2 2 lange Ellenbogenbein is t stä rk er als die kaum kürzere
Speiche. Erstere r Knochen ist oben 0 ,0 0 ö 5 , unten 0 ,0 0 4 5
und an der schwaeiisten Stelle des Körpers 0 ,0 0 2 sta rk . Ueber
dem rechten Ellenbogeiibeiii erkeiiut man deutlich den Elleiibogen-
forlsatz. vom linken liegen d e ssen Reste th e ilweise a u f dem Oberarm
und in der an ihm zur .Aufnahme des F o rtsa tz es vorhandenen
iirnbe. .Am oberen und unteren Ende der Speiche erhält man
0 ,0 0 4 , in der sc hwä ch s ten Gegend nur halb so viel Breite.
Von der Handwurzel liegen nur Andeutungen v o r , die indess
genügen, um sich zu überzeugen, dass keines der Knöchelchen durch
Grösse auffiel. Die von unten en tb lö sste Hand liegt mit dem
Daumen naeh innen. Die Mittelhandknochen dieses und des fünften
Fingers waren die kürzeren und von ungefähr gleicher Länge,
wofür man 0 ,00 6 bei halb so viel Breile erh ä lt. Die übrigen .Mittelhandknochen
waren wieder unter sieh von gleicher Länge nnd
Stärk e, für e rstere erhält man 0 ,0 1 0 5 . für le tztere kaum mehr als
0 ,0 0 3 , an der schwä ch s ten Stelie 0 .0 0 2 . Oie Zahlen der Glieder,
wo rau s die Finger b e steh en , ergeben mit dem Klauenglied, jedoch
ohne diu Millelhand, vom Daumen a u sg eh en d , folgende Reihe;
2. 3. 4. 5.. 3, w a s den Lacerten en tsp rich t. Das e rste Glied isl im
Daumen ein wenig länger a ls in den übrigen Fingern, es ergieht
0,0 0 5 5 Länge bei 0 ,0 0 2 5 S tärk e, wofür man am Klauengliede
0,0 0 4 5 und 0 .0 0 2 erhält. In den übrigen Fingern isl das e rste
Glied von ungefähr gleicher L än g e , die 0 ,0 0 5 b e trä g l, im zweiten
Finger nnr unmerklich mehr. Das zweite Glied des zweiten Fingers
is t kaum uierküch länger a ls das e rs te , und das Klauenglied misst
fast 0 ,0 0 4 5 . Im dritten Finger is t das zwe ite Glied nur unmerklich
kürzer als das e rste, und man erhält dafür 0 ,0 0 4 5 . das ilrilte Glied
kommt a u f die Lunge des e rsten h e ra u s , und das Klauenglied auf
0 .0 0 4 . Im vierten Finger besitzen zw e ite s , d r itte s , v ie rtes nnd
Klanenglied gleiche Länge, die 0 ,0 0 4 b e träg t; es w äre möglicli, dass
das v o rletzte Glied ganz unmerklich länger befunden würde. Im
fünften oder kleinen Finger is t das zweite Glied kaum merklich
länger als das e rste und das Klauenglied von gewöhnlicher Länge.
Es zeichnet sich dah er die Hand v o r der der lebenden Lacerten
durch g rö ssere Gleichförmigkeit ihrer Glieder au s, wobei die Klauenglieder
nicht aulTallend lang und sta rk waren.
Das Darmbein is l v ollständig ü b e rliefert, nur durch Druck umgelegt
und von der Innenseite sichtbar. Es is t 0 .0 2 7 la n g , in der
Gegend der Pfan n e, mit der es je tz t dem Gestein auOiegt, 0 ,0 0 9
hoch und der Oberrand in d ieser Gegend g ewö lb t; h iiilerwärts geht
es in einen mehr flachen stumpfen Fortsatz a u s . und vorn liegt es
w en ig sten s je tz t mit einem d ü n n e ren , spitzeren Fo rtsa tz e dem
Seliambein a u f, das u n te r diesem Fo rtsä tz e stumpfwinkelig in das
Darmbein eingefügt war. ln Folge von Druck ist das Schambein
aus d ieser Einfügung e tw a s h e ra iisg e trelen . Von diesem Knochen
ist nur das Gelenkende s ic h tb a r, für das man 0 ,0 1 2 Breite e rh ä lt;
der Unterrand is t nach diesem Ende hin s ta rk a u sg esch n itten , und
e tw a s über diesem Rande liegt an der Innenseite eine kurze Furche.
Sonst lä s s t sich über das Seliambein nichts angeben. Vom Sitzbein
ist auch nur das Gelenkende oder der Theil ü b e rliefert, mit dem es
dem Darmbein und Schambein zur Bildung der Pfanne anlag. An
der rechten Seite wird dieser Theil deutlicher wahrgenommen. Der
Typus, wonach d a s Becken entwickelt ist, is t von dem der Lacerten
n icht auffallend verschieden. Das Becken scheint hauptsächlich mit
dem vorderen Theil des Fortsatzes des zwe iten Beckenwirbels v e rbunden
gewe sen zu s e y n , e s findet sieh wen ig sten s am Darmbein
eine deutlich ausgebildelc Geienkiläche v o r , welche diesen Forlsalz
aufgeuomineü haben wird.
Der Oberschenkel, leukt noch e in . sein oberer Gelenkkopf ist
aber durch das Darmbein der Untersuchung entzogen. Ea lä sst sieh
daher die Länge des Knochens nieht m e ssen , die jedoch n icht unter
0 ,0 4 3 betragen haben wird. An dem mit Aiideulmigen von einer
Rolle ve rseh en en , unteren geniiideleii Ende erhalt man 0 ,0 0 7 5 Breite,
an der sc liw äch sten Stelle des schwa ch gebogenen Knochens kaum
0 ,0 0 3 5 .
Von den Unterschenkelkiiocheii is l der s tä rk e re das Schienbein,
der schwä ch e re das Wadenbein; beide besitzen gleiche L au g e , für
die man 0 ,0 3 2 e rh ä lt; e rs tc re r Knochen ist an beiden Enden 0 ,0 0 6
nnd an der sc liwäciisten Stelle k.mm mehr a ls 0 .0 0 2 5 b re it, wofür
man für le tzteren , der oben e tw a s sch räg endigt, 0 ,0 0 4 um! 0,001
erh a lt. Am Ende des ol'ereii Drittels erkenul man übereiiistinnncml
am rechten und linken Wadenbein einen deutlich au sg ep räg ten In-
serlions-Höcker.
Von der Fu s sw u rz el be steh t die e rste Reihe wie in den Lac erten
, namentiich in .Monitor, a u s zwe i in einer g e raden Naht zusaiii-
iiieiistossenden Kn o ch en , eine v e rtikale Platte von 0 ,0 0 6 5 Höhe
und 0 ,01 Breile bildend. Diese beiden Knoclien besitzen gleiche
Breite. Ihre Lage zu den Unterschenkelknochcn is t e tw a s v e rs c h o ben.
Der eine Knochen zeigt einen deutlichen conv ex en Geienkkopf,
der vom Schienbein aiifgenommen wurde, auch is t sein ob e re r Rand
fürs Schienbein deutlich ein g esc lin itte ii, während der kleinere Einsch
n itt an der je tz t nach au ssen g e rich te ten Innenseite die Stelie
b e zeichnet, die zur Aufnahme des Mittelfussknochens der g ro ssen
Zehe bestimmt w a r. Der dem Wadenbein entsprechende F u s swurzelknochen
is t se lbst einfacher als in .Monitor. Der u n te re Rand
d ieser beiden zusammeiistossenden Knochen e rs te r Reihe ist gerade.
Von der zweiten Reihe werden In beiden Fü ssen zwei Knöchelchen
wahrgenommen, von denen das ä u ssere wohl g rö s s e r, ab er wen ig er
triangulär a ls unregelmässig gerundet sich darstellt nnd 0 ,0 0 3
misst. Es is t zur Aufnahme des im rechten und linken F u s se noch
damit ziisainmenliegeiideo Mittellüs.sknocliens der fünften oder kleinen
Zehe, so wie des .Mittelfussknochens der b enachbarten vierten
Zehe bestimmt. Das andere Fusswnrzelknöchelchen is t o v a l, nur
0 .0 0 2 g ro s s und liegt neben dem g iö s s e r e n , und von einem noch
weiter innen liegenden d r itte n , noch e tw a s kleineren Knöchelchen
g laubt man w en ig sten s am linken Fu s s eine Spur wahizunehmen.
Der rechte Fu s s liegt v ollständig v o r. Der Mittelfussknoclien
der fünften Zehe is t der k ü rz e s te , von 0 .0 0 8 3 Länge. Seine Form
en tspricht am meisten der in Monitor. Nach der Fusswurzel hin
wird er platter und breitet sich au f 0 ,0 0 3 5 aus. Um sich dem
ä u sseren Wurzelknöchelehcii zwe ite r Reihe nnzulegen, hicgt er über
d as Ende des Mittelfussknochens der beiiaehharten Zehe um. Dieser
Mitlelfussknochen der fünften Zehe v e rdünnt sieh naeh dem Aussenrande
h in ; in der oberen Hälfte des Innenrandes liegt ein liiseriions-
llühel; am unteren Ende is t der Knochen nicht über 0 ,0 0 2 5 breit.
Der n ä ch st kleinere .Mitleirussknocheii isl der der g ro ssen oder
Daumenzehe. Er ergiebt 0,011 Länge bei 0 ,0 0 3 Breile an den
Enden und 0 .0 0 2 an der schmälsten Stelle. Die Länge des .Mittelfussknochens
der zweiten Zehe b e trägt 0 ,0 1 6 5 , d e r dritten 0 ,0 2 0 5
und der v ierten 0 ,0 2 1 5 . Die Zehenglieder sind g rö ssten th eils von
neben en ib lö sst. Ihre Zahlen fiir die fünf Zulien ergeben ohne den
.Mittelfuss, jedocdi mil Einschluss der Kiauenglieder, von der grossen
oder Daumenzehe ausgehend, folgende Reihe: 2. 3. 4. 5. 4, die den
Laccrten ent.sprichl.. Das e rste Zehenglied isl in den fünf Zehen
vo n ungefähr gleicher Länge, wofür man 0 ,0 0 8 erh ä lt, se ih st in der
111
v ie rten Zehe b eträgt es kaum mehr und in der fünften kaum
weniger. .Auch die nicht sta rk gekrümmten Klauenglieder waren
von ungefähr gleicher Länge, die 0 ,0 0 5 m is s t, in der g ro ssen Zehe
kaum mehr. Das zweite Glied is t in der zweiten Zehe 0 ,0 0 7 . das
zwe ite lind dritte in der dritten und v ierten Zehe je 0 ,0 0 6 3 , das
v ie rte Glied in der v ierten Zehe 0 ,0 0 6 lan g ; in der fünften Zehe erhält
man fiir das zweite nnd d ritte Glied kaum weniger. Unter den
Zehengliedern zeichnet sich daher keines durch auffallende Länge
oder Kürze a u s , und das vorletzte Glied is t n ic h l. wie z. B. In -Monitor,
l.änger als das, woran es an gebracht ist. Im linken Fuss ist
von der g ro ssen Zehe wenig überliefert, und der zweiten Zehe fehlt
das Klauenglied.
Die feste Kalkschieferplalte vom Klang eines h art gebackenen
Ziegels besitzt 0 ,0 0 7 bis 0 ,0 0 8 Stärke und überraschende Aehnlielikeit
mil den festen l.agen des Schiefers von Solenliofen. Die Ablösungsfläche
is t durch Eisenoxydhydrat röthlich gefleckt, und an den
Knochengrenzen treten häufig -Manganoxyd - Dendriten auf. - Die
Ktiocheomasse is l ziemlich fest und von w eisser Farbe-
Zwei J a h re sp ä te r theilte mir Herr Thiolliere au s dem lithograp
h is ch en Schiefer von Cirin Reste mil, die auf ein zweites
Exemplar d ieser Species schliessen la s s e n , das der Beachtung
werlh sey n wird. Diese Reste bestehen in e iner Platte mit einer
Reihe von fünfzehn vo n unten entblössten Wirbeln a u s dem hinteren
Theil des Rumpfes. In der Nähe des letzten d ie ser Wirbel wird ein
Stück von einem Fä ch er-fö rmig au sg eb reileten Knochen wah rg e-
iiommen, das eh er vom Sitzbein als vom Schambein herrüliren
dürfte. Dabei liegt der Ob erschenkel, d e ssen ob e re s Ende fehlt.
Der Knochen wird nicht unter 0 .0 3 9 lang g ewe sen s e y n : am u n te ren,
e tw a s gedriieklen Ende e rh ä lt man 0 ,0 0 7 , und an der u n v e rän
d ert überlieferten sc hwä ch s ten Stelle des Körper 0 ,0 0 2 5 Breite.
Von den beiden Unterschenkelknocheii liegt der s tä rk ere, das Schienbein,
vom Oberschenkel durch die Wirbelsäule g e tre n n t; an .seinem
breiteren Ende ergiebt e r 0 .0 0 9 , die Länge is l nicht vollständig
überliefert.
Die Wirbel kommen in Grösse auf die des zu vor beschriebenen
Skelets he rau s. Hinter und u n te r den v o rderen Gelenkfortsälzeii
sch ein t ein Hübel gelegen zu h a b en , der das breite Ende der Kippe
wen ig sten s th e ilw eise aufgenonimen haben .vird. Man erkennt
deutlich, d a ss keine der beiden Gelenkfortsälze co n v ex war. An
den vo n den Rippen v o rhandenen Ueberresten 1st zu e rse h en , dass
i nach unten sich e tw a s v e rstärk en und
1 unteren Ende mit
ler Concavität die knorpelige Verb
Auf e iner kleineren Platle sind, vermuthlich vo n demselben In dividuum,
Reste vom F u s s übe rliefert, wo ru n ter man die zu einer
vertikalen Platte in e iner Naht ziisammeniiegenden beiden F u s s wurzelknochen
e rs te r Reihe e rk e n n t, die dieselbe Grösse wie im
vollständigen Skelet besitzen. Darüber liegt ein Stück Knochen,
d a s dem Wadenbein augehören wird , d a ru n te r ein kleines Fiiss-
wiirzelknöclielchen. und w a s so n s t von Knoclien vorhanden ist,
wird meist vom Mittclfusse h e rrühren.
Piocormus Ialiceps
. . . . A. W.MìYEii, ill Abhniiill. (I. math. phy». KIa.'se
C185Í).
SAPHEOSAURUS LATICEPS.
Taf. Xlll. Fig. 2. 3.
t. 17,
Es ist dies dieselbe Versleinerung au s dem lithographischen
Schiefer vo n Kolheim, a u f die Wagner sein Genus Piocormus gründete.
das mit dem v on mir zwei J a h re früher ausführlich dargeleglen
und von einer Abbildung begleiteten Sap lieosaunis aus dem litiio-
graphischeii Schiefer Frniikreicii’s ziisaminenfälil- Die Versleinerung
wu rd e mir im Mai 1 854 von Herrn Dr. Oberndorfer, in dessen Besitz
sie sich befindet, mitgelheilt. Es wu rd e m e h re re s , namenllich am
Sch äd el, erst noch durch mich w eiter vom Gestein beficit. Taf.
Xlll. Fig. 2 gebe ich das Thier in n a türlicher G rö s se , Fig. -3 den
Schädel bei doppelter Grösse. Das Thier kam v ollständig zur Ahla-
ge rung. Die Skelettheile hängen noch so gut zusammen, d a ss »tizii-
nehmen ist. dass die Ffltdiiiss noch keine g ro sse F o rtsc h ritte gemacht
h a lte, als das Thier von der Gesteinsmasse umhüllt ward, w a s sich
auch darau.s entuehmeii lä s s t, dass namentlich für die Gegend des
Schwanzes die Grenzen des weichen Körpers sich sogar mit einem
Stück Haut erhalten haben. Nur iu der Gegeud des Beckens ist
einiges lierausgehroclien, doch e rs t se it der Zeit der Auffindung der
Versteinerung, uud die meislen Rückenwirbel w erden auf der Gegen-
platte, (Iber die ich nichts in Erfahrung bringen konnie, hängen g e blieben
seyn. Das Thier isl vom Rücken en ib lö sst und liegt daher
mit der Bauchseite dem Gestein auf.
Der von oben sich d a rstellen d e, 0 ,0 3 4 5 lange Schädel ist elf
mai in der ganzen Länge des Tliiers und se ch s ein halb mal im
Schwanz entli.ilten. An den hinteren äusseren Spitzen des Schäd
e ls , die die Paiikeiibeingegend hezeicliiien w e rd en , ergiebt sich
0 .0 2 4 5 Breile, in der Gegend zwischen den Augenhöhlen und Sclilä-
fengruben 0 ,0 2 2 5 ; von den Augenhöhlen au versc-limälert sich der
Schädel nach vorn stä rk er, geht aber nicht auffallend spitz zu. Die
deutlich begrenzten und einander seh r nahe liegenden Schläfengniben
sind ü . ü l l lang und 0 ,0 0 6 lire it; sie gehören hauptsächlich der
Oberseite a n . wie die Augenhöhlen, für die sich 0 ,0 0 9 5 Länge.
0 .0 0 6 Breite und 0 ,0 0 3 5 geringste gegenseitige Entfernung ergiebt.
Von den Nasenlöchern is t nur ein Slück überliefert, das der vom
Zwischenkiefer gebildeten ä u sseren Begrenzung angehört. Diese
Löcher liegen gegen das vordere Ende der Sehnautze hin. Die der
vorderen Schädelhäfte angehörigen Augenhöhlen lagen nur e twas
in die hintere Häifle hinein. Der Einschnill, den der hintere Schä-
■ delrantl in der Mitte bildet, scheint von einem vom Scheitelbein ver-
I schiedenen Knochen begrenzt zu w e rd en , der paarig war. Seiner
\ Lage nach könnte man v e rsu ch t werd en , ihn für das obere Hinterhauptsbein
zu ha llen , w a s gegen Lacerte auffallen würde. Das
u npaarige Scheitelbein bildet iu der Mitte eine scharfe Kante und
w a r vorn mil einem nicht seh r auffallenden länglichen Loche durcli-
bolirt, das ganz dem Scheitelbein angeboren w ird , dabei aber nicht
weit von der hinteren Grenze des Hauptstirnbeins gelegen haben
konnte. Das Hauptstirnbein war ein paariger Kiiiichen, der mil
dem vorderen Winkel der Scliläfengruben begann und sich bis in die
Gegend des vorderen Aiigenhöhlenwinkels e rstre ck te ; sein vorderes
Ende is t nicht überliefert- Der hinteren breiteren Gegend des Itaupt-
stirnheines lag au ssen das Hinterstirnbein a n , die Knochenbrücke
zwischen Sehläfengnibe uud Augenhöhle bildend, und e rstere.
wen ig sten s in der vorderen ä u sseren Gegend, begrenzend. Die
b reite, s ta rk e ä ussere Einfassung der Scliläfengrube scheint quer
getlieilt g ewe sen zu s e y n , wo alsdann der vordere T h eil, wie erw
äh n t. dem hinteren Stirnbein, der liintere dem Schläfenbein aiige-
hören würde. Vom linken vorderen Stirnbein nimmt das hintere
Ende noch seine natürliche Lage ein, bei der es an der Bildung des
v o rderen Theils des Augenhöhleiiraudes sich betheiligle. .Mau
glaubt nach dem ve rschobenen Slück vom rechien Auffeiihöhlenraude
die .Ausdehnung bemessen zu können, die das vordere Stirnbein einnahm.
Der ä ussere Augenhöhienrand wird vom Jochbeine gebildet.
Vom Nasenbein hat sieh n ichts erhalten. Das tiefer liegende, paar
ig e , je tz t wen igsten s e tw a s klaffende v o rdere Ende der Sehnautze
wird aus Zwischenkiefer b estehen. Es isl davon nur der Abdruck
überliefert, der. wiewoiil er vo n der Unterseite herrü h ri, doch nirgends
Andeutungen von Zähnen wahrnehmen lä sst. Jed e Häifle
d ieses vorderen Endes b e sass eine Grube auf der Un te rse ite , die
sich im Abdruck als eine Wölbung zu erkennen gieb t. und daher
nichl von einem l.oehe herrülirt. Vom Unterkiefer wird g a r nichts
wahrgenommen. Oer Rand des Oberkiefers ist sch räg nach innen
in (las Gestein v e rs e n k t, so d a ss auch hier keine Möglichkeit v o rliegt,
zu Aufschlüssen über die Zähne zu gelangen. Durch die Schläfengruben
nnd Augenhöhlen liindurcli erkennt man Ueherreste von
Knochen im Innern oder an der üiKerseile des Schädels. Der hinten
in der Augenhöhle quer nach innen gerichtete Knochen wird das
Querbein seyn.
All der linken Seite ste h t hinten unler dem Schädel ein Stiel-
fdrmigcs Knöchelchen h e raus, das dem Zungenbein angehören wird
Der e rste Halswirbel oder Atlas wird vom Schädel verdeckt
gehalten werd en , da der e rste sichtbare Wirbel sich durch g rö ssere
Länge als zweiter Halswirbel v e rrä th : e r mis st anderthalb Wibel-
länge. Die drei dahinter folgenden Wirbel werden noeh zum Halse
g e h ö re n , der sonach fünf Wirbel zählte. • Wirbel sind breit.