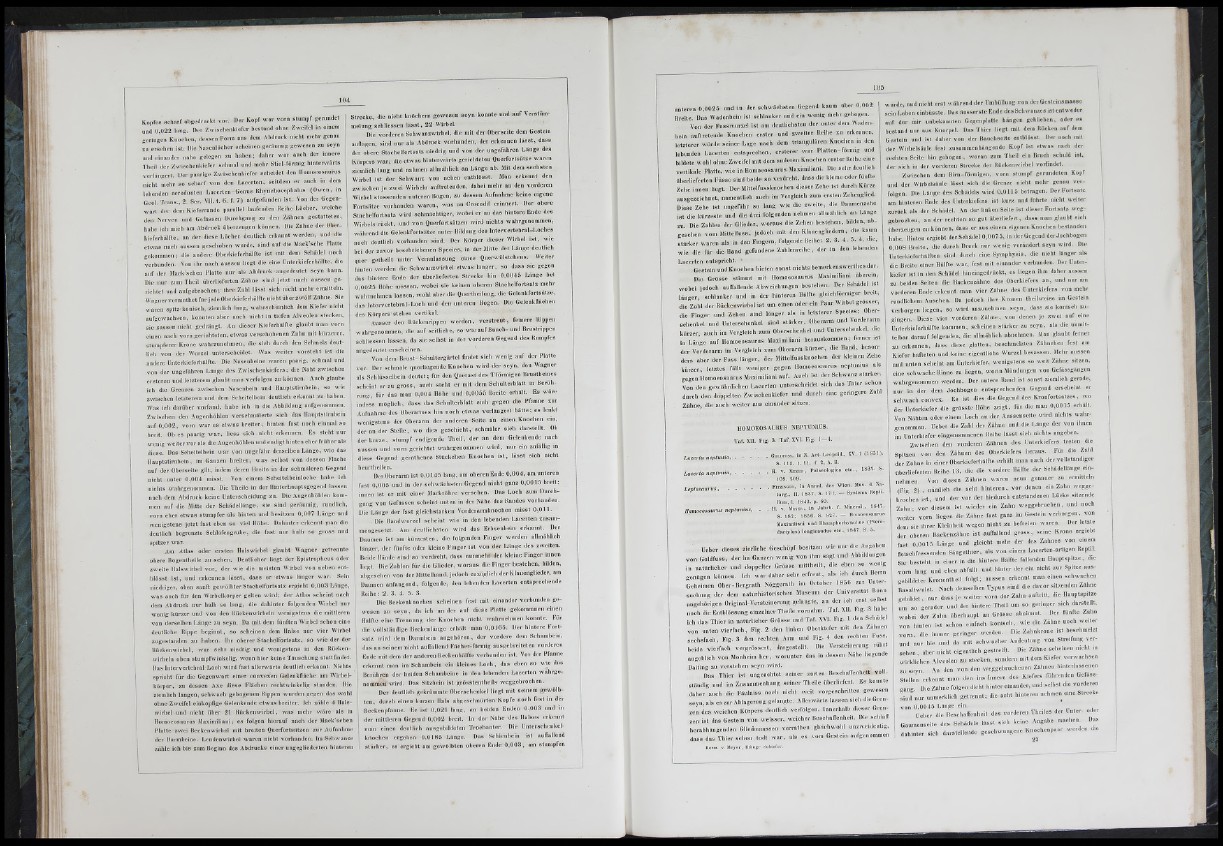
Kopfes sch arf nhgodriickt vor. Der Kopf n stumpf gerundet
«nd 0 .0 2 2 lang. Der Zwischenkiefer hcstand ohne Zweifel in einem
geringen Knochen, dessen Form ans dem Abdruck n icht mehr genau
zu ersehen ist. Die iNiiseiildcher scheinen gcriinmig g ewe sen zn seyn
nnd einander nahe gelegen zu hab en ; daher w a r anch der innere
Theil der Zwischenkiefer schmal nnd mehr Stiel-förmig h in te rwä rts
v erl«n.wrt. Der paarige Zwischenkiefer scheidet den IJo.noeosanrns
n icht mehr so s c h a rf von den Lac erten . seitdem er auch in dem
lebenden acroilontcn L ac erten -G en n s Khynchocephalns (Owen, in
Heol. Trans., 2, Ser. VII. t. 6. f. 7 ) aiifgefunden isl. Von der Gegenwart
der dem Kieferrande parallel laufenden Reihe Löcher, welche
den Nerven nud Gefässen » n rchgang zn den Zähnen g e statteten ,
habe ich mich nm Abdruck überzeugen können. Die Zähne der Ober-
kieferhäirte. an der diese Löcher deullich erkannt w erd en , und die
e tw as nach au ssen geschoben wurde, sind auf die Mack’sclie Platte
gekommen; die andere Oherkieferhälfte is t mit dem Schädel noeh
verbunden. Von ihr oach an ssen liegt die eine Unlerkieferhälfte. die
anf der Mack’schcn Platte nur a ls Abdruck angedentet sey n kann.
Die nur zum Theil überlieferten Zähne sind je tzt nach aussen gerichtet
nnd aufgebrochen; ihre Zahl lä s s t sich nicht mehr ermitteln.
Wag n e rv e rm uth etfü rjed eOb erk ie fe rh ä lfle nicht über zwölf Z ähne. Sic
waren spitz konisch, ziemlich lang, wahrscheiniich dem Kiefer nicht
anfgcwachsen. konnten aber auch nicht in tiefen Alveolen stecken,
sie s a ssen nicht gedrängt. An d ieser Kieferhälfle glaubt man vorn
einen nach vorn gerichteten, e tw a s verscliobenen Zahn mit kürzerer,
stumpferer Krone wah rzu n ehmen , die sich durch den Schmelz deullieh
von der Wurzel u nterscheidet. Was weiter v o rs te h t is l die
Strecke, die nicht knöchern g ewe sen sey n konnte imd au f Verstuni-
melimg schliessen lä s s t, 2 2 Wirbel.
andere Unterkieferhälfte. Die Nasenbeine w aren paarig, schmal und
von der ungefähren Läuge des Zw isclienkiefers; die Naht zwischen
c rsteren und letzterem glaubt man verfolgen zu können. Auch glaube
ich die Grenzen zwischen Nasenbein und Hauplstirnbein, so wie
zwischen letzterem und dem Seheitelhein deutlich erk an n t zn haben.
Was ich darüber v o rfa n d , habe ich in die Abbildung aufgenommeii.
Zwischen den Augenhöhlen v e rschmälerte sich das Haiiptstirnbein
auf 0 ,0 0 2 , vorn w a r es e tw a s b reiter, hinten fast noch einmal so i
breit. Ob es paarig w a r , liess sich n icht e rkennen. Es s te h t uur
wenig weiter v o r als die Augenhöhlen nnd endigt hinten eher frü h e r als |
diese. Das Scheitelbein w a r vo n ungefähr derselben Länge, wie das
Haiiptstirnbein, im Ganzen b re ite r, w a s se lb st vo n d e ssen Fläche |
auf der Überseite gilt, indem deren Breite in der schmäleren Gegend j
nicht unter 0,00-1 misst. Von einem Seheitelbcinloche habe ich ,
nichts wahrgenommen. Die Theile in der Hinterhaiiptsgegend lassen
nach dem Abdruck keine Unterscheidung zn. Die Augenhöhlen kom- :
men auf die .Mitte der Schädellänge, sic sind geräumig, rundlich, ,
vo rn eher e tw a s stumpfer a ls hinten und besitzen 0 ,0 0 7 Länge und
wen ig sten s je tz t fast eben so viel Höhe. Dahinter erk en n t man die
deutlich begrenzte Schläfengrube, die fast nur halb so g ro s s und
sp itzer w ar, j
Am Atlas oder e rsten Halswirbel glaubt Wagner getren n te '
obere Bogentheile zu seh en . Deutlicher liegt der Epistropheiis oder |
zwe ite Halswirbel v o r , der wie die meisten Wirbel von neben entblösst
i s t , und erkennen lä s s t, d a ss er e tw a s länger w ar. Sein |
niedriger, oben san ft g ewölbter Stacheifortsatz ergiebt 0 ,0 0 3 Länge,
w a s auch für den Wirbelkörper gelten w ird ; der Atlas sch ein t nach
dem Abdruck nur halb so la n g , die dahinter folgenden Wirbel nur
wenig kürzer und von den Rückenwirbeln w en ig sten s die mittleren
v o n derselben Länge zu sey n . Da mit dem fünften Wirbel schon eine
deutliche Rippe beg in n t, so scheinen dem Halse n u r v ie r Wirbel
zugestanden zu habeu. Ihr oberer Stach eifo rtsa tz, so wie der der
Rückenwirbel, w a r seh r niedrig und w en ig sten s in den Rückenwirbeln
oben stumpfwinkelig, wenn hier keine Täuschung stattfindet.
Das lu te rv ertebral-Loch wird fast a llerwärts deutlich erkannt. Nichts
sp richt für die Gegenwart e iner convexen Geienkiläche am Wirhel-
k ö rper, zu dessen Axe dièse Flächen rechtwinkelig standen. Die
ziemlich langen, schwa ch gebogenen Rippen wurden gegen das wohl
olme Zweifel einköpfige Geienkende e tw a s breiter. Ich zähle 4 Halswirbel
und nichl über 21 Rückenwirbel, w a s mehr wäre als in
Homocosaurns .Maximiliani; es folgen hierauf nach der .Maek’schen
' Platle zwei Beckenwirbel mit breiten Querfortsätzen zur Aiifiiahme
der Darmbeine. Lendenwirbel w aren nicht vorhanden. Im Schwänze
; zähle ich bis zum Beginn des Abdrucks einer ungegliederten hinteren
Die vorderen Schwanzwirbel, die mit der Oberseite dem Gestein
anflagen, sind nur als Abdruck v o rh an d e n , der e rkennen lä s s t, dass
der obere Stnchelforlsotz niedrig und vou der migefäliren Länge des
Körpers w a r ; die e tw a s h in te rwä rts g e richteten Querfortsätze waren
zieniücli lang und nahmen allmählich an Länge ab. Mit dem s e ch sten
Wirbel ist der Schwanz von neben en tb lö sst. Man erk en n t den
zwischen je zwei Wirbeln anftretcnden, dabei mehr an den vorderen
Wirbel sto ss en d en unteren Bogen, zu d e ssen Aufnahme keine eigene
Fo rtsä tz e vorhanden w a ren , r a s an Crocodil e rin n e rt. Der obere
Stacheifortsatz wird schmächtiger, wobei er an das hintere Ende des
Wirbels rü ck t, und von Querfortsätzen wird n ichts wahrgenommen,
wälirend die Gelenkforlsätze u n te r Bildimg des Interv e rteh ral-Lo ch e s
noch deutlich vorhanden sind. Der Körper d ieser Wirbel is t . wie
bei der zuvor beschriebenen Species, in der Mitte der Länge deutlich
quer getlieill u n te r Veranlassung e ines Querwiilstchens. Weiter
hinten werden die Schwanzwirbel e tw a s län g er, so d a ss sie gegen
d as h intere Ende der überlieferten Stre ck e liin 0 ,0 0 4 5 Länge bei
0 ,0 0 2 5 Höhe messen, wobei sie keinen oberen Stacheifortsatz mehr
wahriiehiiien la ssen , wohl aber die Qnertheiluiig, die Gelenkfortsatze,
das Interv e rte b ral-L o ch und den unteren Bogen. Die Gelenkflächen
des Körpers steh en vertikal.
Ausser den Kückeiirippen w e rd en , v e rs tre u t, feinere Kippen
wahrgenommen, die a u f seitliche, so wie auf Bauch- und Bnistrippen
schliessen la ssen , da sie se lb st in der v o rderen Gegend des Rumpfes
angedentet erscheinen.
Von dem B ru st-Sch iilterg firlel findet sich wenig auf der Platte
vo r. Der schmale queriiegendc Knoelicn wird der seyn, den Wagner
als Schlüsselbein d e u te t; für den Qiierast des Tlörniigeii Brustbeines
scheint er zu g ro s s , auch s te h t er mit dem Sch ulterblatt in Berüii-
ru n g , für das man 0 ,0 0 4 Höhe und 0 ,0 0 5 5 Breite erh ä lt. E s wäre
indess möglich, d a ss das Sch ulterblatt sich gegen die Pfanne zur
Aufnahme des Überarnies hin noch e tw a s v e rläu g ert h ä tte ; c s lenkt
w en ig sten s der Oberarm der anderen Seite an einen Knochen ein.
der an der S telle, wo dies g e s ch ie h t, schmäler Sich darslellt. Oh
der k u rze , stumpf endigende Th eil, der an dem Geienkende nach
au ssen und vo rn gerich te t wahrgenommen w ird , n u r ein zufällig m
I diese Gegend g e ra th eu e s Stückchen Knochen i s t , lä s s t sich nicht
j beurtheilen. I DerOberarni is t 0 ,0 1 4 5 lang, am oberen Ende 0 ,0 0 4 , am unteren
fast 0 ,0 0 5 und in der sc hwä ch s ten Gegend nicht g anz 0 ,0 0 1 5 breit;
! innen is t er mil e iner Markrölire ve rseh eo . Das Loch zum Durchg
ang von Gelassen scheint un ten in der Nähe des Kandes vorhanden.
Die Länge der fast g ie ieh s lark en Vorderarmknoclien misst 0,0 1 1 .
Die Handwurzel sch ein t wie in den lebenden Lacerten zusammengesetzt,
Am deutlichsten wird das Erbsenbein e rk an n t. Der
. Damnen is t am k ü rz e s te n , die folgenden Fin g er weid en allmählich
! länger, der fünfte oder kleine Finger is t von der Länge des zweiten,
i Beide Hände sind so v e rd reh t, d a s s nnnmelir der kleine Finger innen
' liegt. Die Zahlen fiir die Glieder, w o ra u s die Finger b e stehen, bilden,
I abgesehen von der Mittelhand, jedoch zuzüglich der Klauenglieder, am
Daumen anfan g cn d , folgende, den lebenden Lacerten cntsp ic ch en d c
! Reihe: 2. 3. 4. 5. 3.
i Die Beckenknoehcn scheinen fest mit einander verbunden ge-
I wesen zu s e y n , da ich an der au f diese Platte gekommnen einen
! Hälfte eine Trennung der Kiiothen nicht M aiirnehmen konnte. Für
die vollständige ßeckenläiige e rh ä lt m a n ü ,0 1 « 5 . Der h intere Fort-
^ .satz wird dem Dnnnhcin a n g eiiö ren , der v o rdere dem Schamheio,
I das an seinem n icht auffnlleud Fächer-förmig au.sgehreiteten vorderen
Ende mit dem der anderen Beckenliälfte verbunden isl. Vor der Pfanne
erk en n t man im Schambein ein kleines L o ch , das eben so wie das
Berühren der beiden Schambeine in den lebenden Laecrlen wnlirgc-
nomraeil wird. Das Sitzbein is t g rö ssten th eils weggebrochen.
Der deutlich gekrümmte Oberschenkel liegt mit seinem gewölbte
n , durch einen kurzen Hals abg esch n ü rten Kopfe noch fest in der
Beekenpfanne. Er is l 0,021 la n g , an beiden Enden 0 ,0 0 3 und in
der mittleren Gegend 0 ,0 0 2 breit, in der Nähe des Halses erkennt
man einen tieiillich nn.sgebildcleii Trochanter, Die Unicrselienkel-
knochen ergehen 0 .0 1 8 5 Länge. Das Kehieiibein isl iinffaUeiid
s tä rk e r, es ergiebt nm gewölbten oberen Ende 0 ,0 0 3 , am sliiiiipfen
unteren 0 ,0 0 2 5 und in der schwä ch s ten Gegend kaum llber 0 ,0 0 2
Breite. Das Wadenbein is t sch lanker und ein wenig mehr gebogen.
Von der Fu s sw u rz el ist am deutlichsten der unler dem Wadenbein
auftretende Knochen e rs te r nnd zwe ite r Reihe zu erkennen,
letzterer wu rd e se in er Lage nach dem triangulären Knochen in den
lebenden Lacerten en tsp rech en , e rs te re r w a r Plalten -fö rmig nnd
bildete wohl ohne Zweifel mil dem anderen Knoclien e rster Reihe eine
v ertik ale Platte, wie in llomoeosaurus Maximiliani. Die seh r deutlich
üherlieferten Füsse sind beide so v e rd reh t, d a ss die kleine oder fünfte
Zehe innen Hegt. Der Mitteifussknoehen d ieser Zehe is l durch Kürze
ausgezeichnet, namentlich auch im Vergleich zum e rsten Zelienghed.
Diese Zehe is t ungefähr so lang wie die zwe ite , die Daumenzehe
is t die kürze ste und die drei folgenden nehmen ailmählieh an Lange
zu Die Zahlen der Glieder, w o ra u s die Zehen b e steh en , bilden, ab g
esehen vom Mittelfuss, jedoch mit den Klauengliedcrn, die kaum
s tä rk e r waren a ls iu den Fingern, folgende Reihe: 2. 3. 4. 5. 4. die,
w ie die für die Hand gefundene Zahlenreihe, der in den lebenden
Lacerten en tsp rich t. •
Gestein und Knochen bieten so n s t n ichts bemerk en swe rlh es dar.
Die Grösse stimmt mit Houioeosaurus Maximiliani uhereni,
wobei jedoch auffallende Abweichungen b e stehen. Der Schädel ist
lä n g e r, sch lanker und in der hinteren Hälfte gleichförmiger breit,
die Zahl der Rückenwirbel is t um einen oder ein Pa a r Wirbel g rö sser,
die Finger und Zehen sind länger als in le tzterer Species; Oberschenkel
und Unterschenkel sind s tä rk e r. Oberarm und Vorderarm
kürzer, auch im Vergleich zum Oberschenkel und Unterschenkel, die
in Länge auf llom oeosaurus Maximiliani lierauskommen; ferner ist
der Vorderarm im Vergleich zum Oberarm k ü rze r, die Hand, besonders
aber der F u s s län g er, der Mitlelfussknochen der kleinen Zehe
k ü rze r, letztes fällt weniger g egen llom oeosaurus neptunius als
gegen llomoeosaurus Maximiliani auf. Auch is t der Schwanz stä rk er.
Von den gewöhnlichen Lacerten u n terscheidet sieh das Thier schon
durch den doppelten Zivischenkiefer und durch eine geringere Zahl
Zähne, die auch weiter aus einander sitzen.
HOMOEOSAURUS NEPTOMÜS.
Tai'. XII. F ig .3 . Taf-XVI. Fig, 1 - 4 .
Lacerta neptunia, .
Homoeosaurus neptunius,
. Goi.i.rcss, in N. Ant. Lenpoia.. XV. 1 (1831).
I. V. MEYER.
109. 209.
Fit7.i»ge8 , in A :S Wien. Mu.». iL N»- tiirg., H. 183T. S. 1' 1. — Systciiiii Repti-
Unni. 1, 1843, p. 60.
H. V. Meyer, in Jnlirh. f. Minernl., 1847.
8. 182; 1856. S. 827. — .....
Mftxiinili»ni «nd Rlmuiphorliyi.eliiii (Ptcrn-
dactylus) longicaudus etc.. 1847. S. 5.
Ueber dieses zierliche Geschöpf besitzen w ir nur die Angaben
vo n Gold fu ss, der im Ganzen wen ig vo n ihm sag t und Abbildungen
in na tü rlich e r und doppelter Grösse m itth eilt, die eben so wenig
.»cniigeii können. Ich w a r daher seh r e rfre u t, a ls ich durch Herrn
L h e im e n O b er-B erg rath Nöggerath im October 1 850 zur Untersuchung
der dem uatiirhistorischcn Museum der Universität Bonn
ungehörigen Original-Versteinerung gelaugte, an der ich e rs t selbst
noch die Entblöasung einzelner Theile voriialim. Taf. XII. Fig. 3 habe
u-li das Thier in n a türlicher Grösse und Taf. XVI, Fig. 1 den Schädel
vo n unten v ie rfa ch , Fig. 2 den linken Oberkiefer mit den Zähnen
s e ch sfach , Fig. 3 den rech ten Arm und Fig. 4 den rechten Fuss,
beide v ierfach v e rg rö s s e rt, dargestellt. Die Versleinerung riilirt
angeblich vo n Monheim h e r, wo ru n ter das in dessen Nähe liegende
Daiting zu v e rstehen sey n wird. _
Das Tliier ist ungeachtet seiner z arten Bescliaffenlieit v o llständig
und im Zusammenhang se in er Theile überliefert. Es konnte
d aher auch die Fäuiniss noch nicht weit vo rg esch ritten gewesen
se y n , als es zur Ablagerung gelangte. Allorwärls lassen sich dicGren-
zen des weichen Körpers deutiicli verfolgen. Innerhalb d ieser Grenzen
ist das Gestein von w eisser. weicher Beschaffenheit. Die schlaff
herahliiingeiulen Gliedmiiassen ve rrath en gleichwohl unzn eid cu lig ,
d a ss das Thier schon to d t w a r , als es vom Gestein aufgenommen
llcrp. «. Hkyer, lUhoyr. Schk-fa-.
wurde, und nicht erst wälirend der Umhüllung von der G esteinsmasse
sein Leben einhüssle. Das ä u sserste Ende des Sc-hwanzes ist entweder
a u f der mir unbekannten Gegenplatte hängen geblieben, oder es
bestand nur aus Knorpel. Das Thier liegt mit dem Rücken auf dem
Gestein und ist daher von der Bauchseite entblösst. Der noch mit
der Wirbelsäule fest zusammenhängende Kopf isl e tw as nach der
rechten Seite liin gebogen, woran zum Theil ein Bruch schuld ist,
der sich in der vorderen Strecke der Riickenwirbel voriindet.
Zwischen dem Birn-fövmigen, vorn stumpf gerundeten Kopf
und der Wirbelsäule lä sst sich die Grenze n icht mehr genau v e r- .
folgen. Die Länge des Schädels wird 0 ,0 1 1 5 betragen. Der Fortsatz 1
am hinteren Ende des Unterkiefers ist kurz und führte nicht weiter
zurück a ls der Schädel. An der linken Seile is t dieser F o rtsa tz weg-
gehro ch eu , an der rechten so gut überliefert, das» man giaubt siel.
I überzeugen zu können, dass er aus einem eigenen Knochen bestanden
I habe. Hinten ergiebt der Schädel 0 ,0 0 7 5 , in der Gegend der Jochbogen
' 0 .0 0 8 Breite, die durch Druck nur wenig verändert seyn wird. Die
Uiilerkiefeihäirien sind durch eine Symphysis, die nicht länger als
die Breite einer Hälfte war, fest mit einander verbunden. Der Unterkiefer
is t iu den Schädel hineingedrückt, es liegen ihm daher aussen
zu beiden Seiten die Backenzähne des Oberkiefers .in, und nur am
v o rderen Ende erkennt man v ie r Zähne des Unterkiefers von mehr
rundlichem Ansehen. Da jedoch ihre Kronen theilweise im Gestein
v erborgen liegen, so wird anzunehmen se y n , dass sie konisch zugingen.
Diese vier vorderen Zähne, von denen Je zwei auf eine
Uiiterkieferhälfte kommen, scheinen stä rk er zu se y n , als die unmitte
lb ar darauf folgeniien. die allmähUcIi abnehmcn. Man glaubt ferner
zu erkennen, d a ss diese g la tte n , beseliinelzten Zähnchen fest am
Kiefer hafteten und keine eigentliche Wurzel b esassen. Mehr aussen
und unten sclieint am Unterkiefer, wen ig sten s so weit Zähne sitzen,
eine schwa ch e Kinne zu liegen, worin Mündungen von Gefässgäogen
wahrgenommen werden. Der untere Rand is t sonst ziemlich gerade,
n u r in der dem Jochbogcu entsprechenden Gegend e rscheint er
schwa ch convex. Es is t dies die Gegend des Kro n fo rlsa tze s, wo
der Unterkiefer die grö sste Höhe z e ig t, für die mau 0 ,0 0 1 5 erhält.
Von Nähten oder einem Locli an der Aussenseite wird n ichts wahr-
genonimeii, Ueber die Zahl der Zähne und die Länge der von ihnen
im Unterkiefer eingenommenen Reihe lä sst sich nichts angeben.
Zwischen den vorderen Zähnen des Unterkiefers treten die
Spitzen von deu Zähneu des Oberkiefers heraus. Für die Zahl
der Zähne in einer Überkieferhälfte erhält man nach der vollständiger
überlieferleii Reihe 13, die die v o rdere Ilälfle der Schädellänge ein-
nehnien. Von diesen Zähnen waren neun genauer zu ermitteln
(Fig 2 ) , nämlich die acht h in te ren , v o r denen ein Zahn weggehrochen
is t und der v o r der hiedurch entstandenen Lücke sitzende
Z ah n ; v o r diesem is t wieder ein Zahn weg g eb ro ch en , und noch
weiter vorn liegen die Zähne fast ganz im Gestein verb o rg en , vou
dem sie ihrer Kleinheit wegen nicht zu befreien waren. Der letzte
der Oberen Backenzähne is t auffallend g ro s s , seine Kroue ergiebt
f is i 0 0 0 1 5 Länge und gleicht mehr der des Zahnes von einem
fleischfressenden Sau g e lh ier, a ls von einem Lacerteii-artigen Reptil.
Sie be steh t iu einer iu die hintere H.ilfte fallenden Hauptspitze, die
v om lang und eben abfällt uud h inter der ein nicht zur Spitze aus-
«ebildeler Kroueutheil folgt; au ssen erkennt man einen schwachen
B,isaltwulst. N.ich demselben Typus sind die d avor sitzenden Zähne
g eb ild et, uur d a ss je weiter vorn der Zahn auftritt, die Qa.iptspitze
um so ger.ider uud der hintere Theil um so geringer sich darstellt,
wobei der Zahn überlmupt an Grösse abnimmt. Der fünfte Zahn
von hinten is t schon einfach k o n isc h , wie die Zähne noch weiter
v o r n , die immer geringer werden. Die Zahnkrone is t beschmelzt
und nur hie und da mit sehwä elier Andeutung von Streifung v e rsehen
aber nieht eigentlich gestreift. Die Zähne scheinen nicht m
wirklichen Alveolen zn stecken, sondern mit dem Kiefer v e rwachsen
zu sey n An den von den wcggebroehencn Zähnen hinterlassenen
I Stellen erkennt man den ins Innere des Kiefers führenden Gefass-
I ,»aiw Die Zähne folgen dicht hinter einander, und se lb st die vorderen
^¡„d’ n,,r ,,,.,«.rklich g e t.e n .t, cl« „ h t I .i,« r e ,, n . l , , , ,» »,ne Strecke
! v on 0 ,0 0 4 5 Länge ein.
I lieber die Beschaffenheit des vorderen Theiles der Unter- oder
! Gaumenseite des Schädels lä sst sich keine Angabe m a ch e .. Das
, d ahinter sich darstellende geschwungene Knochenpaar werde«
27