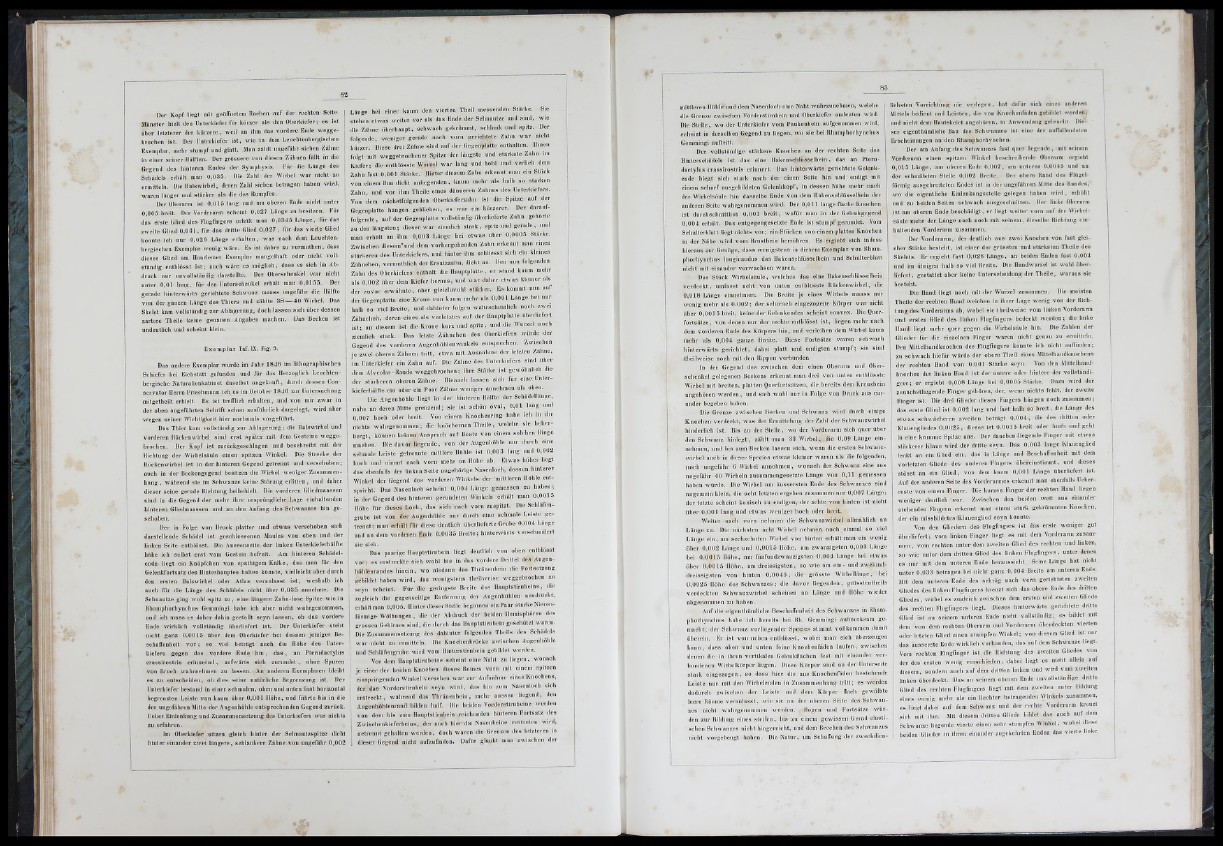
Der Kopf liegt mil geölTiictcm linchen auf der rechten Seilc-
Miinsler hielt den Unterkiefer für kürzer als den Oberkiefer; e s ist
aber letzterer der k ü rze re , weil an ihm das vordere Ende weggebrochen
ist. Der Unterkiefer is t , wie in dem Lenchtenbergischen
Exemplar, mehr stampf nnd g la tt. Mim zählt imgefähr sieben Zähne
in einer seiner Hälften. Der grössere von diesen Zähnen fällt in die
Gegend des hinteren Endes der Symphysis. Für die Länge des
Schädels erhält man ü ,ü 3 5 . Die Zahl der Wirbel w a r nicht zn
ermitteln. Die Halswirbel, deren Zahl sieben betragen haben wird,
w aren länger und s tä rk e r als die des Rumpfes.
Her Oberarm is t 0 ,0 1 5 lang imd nm oberen Ende nicht unter
0 ,0 0 5 breit. Der Vorderarm scheint ü ,ü 2 7 Länge zn besitzen. Fiir
das e rste Glied des Fiugfingers erhält man 0 ,0 3 4 5 Länge, für das
zweite Glied 0 .0 3 1 , für das dritte Glied 0 ,0 2 7 , für das v ierte Glied
konnte ich mir 0 ,0 2 6 Länge e rh a lle n , w a s nach dem Leiichlen-
bergisehen Exemplar wenig w äre. Es is t daher zu v e rmuthen, dass
dieses Glied am Ilaarlemer Exemplar mangelhaft oder nicht vollständig
en tblösst i s t ; auch wäre es möglich, da ss es sich im Abdruck
n u r unvollständig dnrstellte. Der Ober.seheukei w a r nicht
unter 0 ,01 lan g, fiir den Unterschenkel e rh ä lt man 0 ,0 1 5 5 . Der
gerade hin te rwä rts gerichtete Schwanz maass ungefähr die Häifle
von der ganzen Länge des Thiers imd zählte 3 8 — 40 Wirbel. Das
Skelet kam v ollständig zur Ablagerung, doch la ssen sich über dessen
zartere Theile keine genauen Angaben machen. Das Recken ist
undeutlich und scheint klein.
E x em p la r Taf. IX. Fig. 5.
Das andere Exemplar wurde im J a h r 1 8 4 6 im lilhographischen
Schiefer bei Eichstätt gefunden uud für das Herzoglich Lenchten-
bergische iXatnralienkabinet daselbst nngekaufl, durch dessen Con-
s c rv a lo r Herrn Frisehmnnn ich es im October 1 846 zur Untersuchung
milgetheilt erhielt. Es is t trefTÜch e rh a lte n , und von mir zwa r in
der oben angeführten Schrift schon ausführlich dargelegt, wird aber
wegen seiner Wichtigkeit hier nochmals vorgeführl.
Das Thier kam vollständig zur Ablagerung; die Halswirbel und
vorderen Rückenwirbel sind e rs t sp a ter mit dem Gesteine weggebrochen.
Der Kopf is t zurückgeschlagen und beschreibt mit der
Richtung der Wirbelsäule einen spitzen Winkel. Die Strecke der j
Rückenwirbel ist in der hinteren Gegend g e tren n t und versch o b en ;
auch in der Beckengegend besitzen die Wirbel iveniger Zusammen- |
h a n g , während sie im Schwänze keine Störung e rlitte n , und daher I
d ieser seine gerade Richtung beibehielt. Die vorderen Gliedmaassen
sind in die Gegend der mehr ihre ursprüngliche Lage einhaltenden
h interen Gliedmaassen und an den Anfang des Schwanzes hin g e schoben.
Der in Folge von Druck p la tte r nnd e tw a s v erschoben sich
d arstellende Schädel ist g eschlossenen .Manles vo n oben und der
linken Seile eniblösst. Die Aussenseite der linken Unterkieferhälfte
habe ich se lb st e rs t vom Gestein befreit. Am hinteren Schädelende
liegt ein Knöpfclien von späthigem Kalk e, das man für den
Gelenkfortsatz des liinlerliauples halten könnte, vielleicht aber durch
den e rsten Halswirbel oder Atlas v e ra n la s s t is t , weshalb ich
auch für die Länge des Schädels nicht über 0 ,0 3 5 annehme. Die
Sehnautze ging wohl spitz z n , eine längere Zahn-lose Spitze wie in
Khamphorhynchus Gemmingi habe ich aber nicht wahrgenommen,
und ich muss es daher dahin g e stellt sey n la s s e n , ob das vordere
Ende wirklich vollständig überliefert ist. Der Unterkiefer ste h t
nielit ganz 0 .0 0 1 5 über dem Oberkiefer bei dessen je tzig er Beschaffenheit
v o r ; so viel beträgt anch die Höhe des Unterkiefers
gegen das vordere Ende hin , d a s , an Pterodaclylus
e ra ssiro stris e rin n e rn d , a u fwärts sich z u ru n d e t, ohne Spuren
von Bruch wahrnehmen zu la ssen . An anderen Exemplaren bleibt
e s zu entsch e id en , ob dies seine natürliche Begrenzung ist. Der
Unterkiefer bestand in einer schmalen, oben und unten fast horizontal
begrenzten Leiste von kaum über 0,001 Höhe, und führte bis in die
der ungefähren .Mitte der Augenhöhle entsprechenden Gegend zurück.
Ueber Einlenkung und Zusammenselzniig des Unterkiefers w a r nichts
zu erfahren.
Im Oberkiefer sitzen gleich h inter der Schnäutzspitze dicht
hinter einander zwei län g ere, schlankere Zähne vo n ungefähr 0,002
Läiwe bei einer kaum den v ierten Theil messenden Stärke. Sie
steh en e tw a s weiter v o r a ls das Ende der Sehnautze und s in d , wie
die Zähne ü b e rh au p t, schwa ch gekrümmt, schlank nnd spitz. Der
folgende, weniger gerade nach vorn g e rich te te Zahn w a r nicht
kürzer. Diese drei Zähne sind auf der Gegenplatte enlhallen. Ihnen
folgt mit weggebrochener Spitze der längste und s tä rk ste Zahn im
Kiefer; die en tb lö sste Wurzel w a r lang und hohl und verlieh dem
Zahn fast 0,001 Stärke. Hinter diesem Zahn erk en n t man ein Stück
vou einem ihm dicht anliegenden, kaum mehr als halb so starken
Z ah n , und v o r ihm Theile eines dünneren Zahnes des Unterkiefers.
Von dem nächstfolgenden Obevkieferzahn is t die Spitze au f der
Gegenplatte hängen g eblieben, es w a r ein kürzerer. Der darauffo
lgende, a u fd e r Gegenplatte vollständig überlieferte Zahn gehörte
zu den län g sten ; d ieser w a r ziemlich s ta r k , spitz nud g e ra d e , und
man erhält an ihm 0 ,0 0 3 Lauge bei e tw a s über 0 ,0 0 0 5 Stärke.
Zwischen d ie sem 'iin d dem vorh erg eh en d en Zahn erkennt man einen
stä rk eren des Unterkiefers, und h inter ihm sch lie sst sich ein kleines
Zähnchen, vermuthlich der Ersatzzahn, dicht an. Den nun folgenden
Zahn des Oberkiefers enthält die llau p tp la tte , er stan d kaum mehr
als 0 ,0 0 2 über dem Kiefer h e ra u s , und w a r daher e tw a s kleiner als
der z u v o r e rw ä h n te , aber g leichwohl stä rk er. Es kommt nun auf
der Gegenpiatte eine Krone vo n kann« mehr als 0,001 Länge hei nur
halb so viel Breile, und dahinter folgen w.ilirseheinlich noch zwei
Zähnchen, deren eines a ls v o rletztes auf der Hanplplatle überliefert
i s t ; an diesem is t die Krone kurz nnd sp itz , «nd die Wurzel noch
ziemlich sta rk . Das letzte Zähnchen des Oberkiefers wü rd e der
Gegend des vorderen Augenhöhlenwiiikels entsprechen. Zwischen
je L - e i oberen Zähnen tr itt , e tw a mit Ausnahme der letzten Zähne,
im Unterkiefer ein Zahn anf. Die Zähne des Unlerkiefers sind über
dem Alv eo lar-Ran d c w eg g eb ro ch en ; ihre Stärke is t gewöhnlich die
der s tä ik e re n oberen Zähne. Hienach la ssen sich für eine ü n te r-
k ieferhälfte ein oder ein Pa a r Zähne weniger annehmen als oben.
Die Augenhöhle liegt in der hinteren Hälfte der Schädellänge,
nahe an deren Mitte gren z en d ; sie is t schön o v a l, 0 ,01 lang und
0 ,0 0 7 hoch oder breit. Von einem Kiiochenring habe ich in ihr
n ichts wahrgenommen; die knöchernen T h eile, welche sie beh erb
e rg t, können keinen Anspruch anf Reste vo n einem solchen Ringe
machen. Die d avor lieg en d e , v on der Augenhöhle n u r durch eine
schmale Leiste ge tren n te mittlere Höhle is t 0 ,0 0 3 lang und 0 .00 2
hoch und nimmt nach vo rn mehr an Höhe ab. E tw a s h öher liegt
d a s ebenfalls der linken Seite angehörige Xasenlocli, d e ssen h interer
Winkel der Gegend des v o rderen Winkels der mittleren Höhle ent-
■ spricht. Das Nasenloch sch ein t 0 ,0 0 4 Länge gemessen zu h ab en ;
I In der Gegend des hinteren gerundeten Winkels e rh ä lt man 0 ,0 0 1 5
: Höhe für d ieses Lo ch , das sich naeli vorn zuspitzt. Die Schläfen-
j gn ib e is t von der Augenhöhle nur durch eine schmale Leiste getre
n n t; man erhält für diese deutlich überlieferte Grube 0 ,0 0 4 I Jn g e
I und an dem vorderen Ende 0 ,0 0 3 5 Breite; h in te rwä rts v e rschmälert
' s ie sieh.
I Das paarige Hauptstirnbein liegt deullich von oben en tblösst
I v o r ; e s erstre ck te sich wohl bis in das v o rdere Drittel des Augen-
' höhlenrandes h in e in , wo alsdann das Thränenbein die Fo rtsetzung
gebildet haben w ird , das w en ig sten s th e ilweise weggebrochen zu
: seyn scheint. Für die ge rin g s te Breile des Hanp lstirn b ein s, die
I zugleich die gegenseitige Entfernung der Augenhölilen ansdrückl,
' erhält man 0 ,0 0 5 . Hin te rd iese rS te lle beginnen ein P a a r s ta rk e Nieren-
¡ förmige Wölbungen, die der Abdruck der beiden Hemisphären des
! g ro ssen Gehirnes sind, die durch das Hanptstirnbein ge sch ü tz t waren,
i Die Zusammensetzung des dahinter folgenden Theils des Schädels
' war nicht zu ermitteln. Die Knochenbrücke zwischen Augenhöhle
und Schläfengrubc wird vom Hinterstirnbein gebildet werden.
Vor dem Hauptstirnheine scheint eine Naht zu lieg en , wonach
je e iner der beiden Knochen dieses Beines vo rn mit einem spitzen
einspringenden Winkel v e rsehen w a r zur Anfnahme e ines Knochens,
der das Vordcrsfinibeiii seyn w ird , das hin zum Nasenloch sieh
e rs tre c k t, wälirend das T h iän en b e iii, mehr an ssen lieg en d , den
' Augenhühlenrand bilden half. Die beiden Vorderstinibeinc werden
' von dem bis zum Hauplstirnbein reichenden hinteren Fo rtsa tz des
' Zwisch cn k ic fe rb cin s, der auch hier die Nasenbeine vertre ten wird,
' g ctrcmit gehalten w e rd en , doch w aren die Grenzen des letzteren in
] d ieser Gegend nicht aufziifinden. Dafür glaubt man zwischen der
mittleren Höhle «nd dem Nasenloch eine Naht walirzimehmcn, welche
die Grenze zwischen Vorderstirnbein und Oberkiefer andeulen wird.
Die Stelle, wo der Unterkiefer vom Paiikenbein aiifgenommen wird,
scheint in derselben Gegend zn liegen, w o sie bei Khamphorliyncluis
Gemmingi auftritt.
Der vollständige stä rk ere Knochen an der rechten Seite des
llin lersehädcls is t das eine lla k en sch lü sselb e in , das an Ptero dactylus
e ra s s iro s tris e rinnert. Das h in te rwä rts gerichtete Gelenkende
biegt sich stark nach der einen Seite hin und endigt mit
einem s c h arf aiisgebildeten Gelenkkopf, in d e ssen Nähe mehr nach
der Wirbelsäule hin dasselbe Ende v on dem Hakenschlüsselbein der
anderen Seite wahrgenommen wird. Der 0 ,0 1 1 lange flache Knochen
is t diirchschnittlich 0,0 0 1 b re it, wofür man in der Gelenkgegend
0 ,0 0 4 erh ä lt. Das entg eg en gese tz te Ende is t stumpf geriiiidet. Vom
Sehulterblull liegt n ichts v o r ; ein Stücken von einem platten Knochen
in der Nähe wird vom Brustbein herrühren. Es ergiebt sich indess
hie rau s zur Genüge, d a ss w en ig sten s in diesem Exemplar von Rham-
p h o rhynchus longicaudus das Hakensclilüsselbein und Schulterblatt
nicht mit einander v e rw ach sen waren.
Das Stück Wirbelsäule, wele-lics das eine Hakenschlüsselbein
v e rd e c k t, umfasst acht vnn nuten en tb lö s s te Rückenwirbel, die
0 ,0 1 8 Länge einnehmen. Die Breile je eines Wirbels maass nur
wenig mehr a ls 0 .0 0 2 ; der schwa ch eiiigezogene Körper w a r nicht
über 0 ,0 0 1 5 hrcil, keine der Gelenkenden scheint convex. Die Quer-
fo rts ä tz e , von denen n u r der rechte en tb lö sst is t , liegen mehr nach
dem v o rderen Ende des Körpers hin, und verleihen dem Wirbel kaum
mehr a ls 0 ,0 0 4 ganze Breite. Diese F o rtsä tz e waren schwach
h in te rw ä rts g e ric h te t, dabei p la tt nnd endigten stum p f; sie sind
th e ilw eise noch mit den Rippen verbunden
In der Gegend des zwisch en dem einen Oberarm nnd Oberschenkel
gelegenen Beckens erkennt man drei von unten en tb lö sste
Wirbel ulit breiten, platten Querfortsätzen, die bereits dem Kreuzbein
angehören w e rd e n , und sich wohl nur in Folge von Druck ans einander
begeben haben.
Die Grenze zwischen Becken nnd Schwanz wird durch einige
Knochen verdeckt, w a s der Ermittelung der Zahl der Schwanzwirbel
hinderlich ist. Bis zu der Stelle, wo der Vorderarm sich quer über
den Schwanz liin leg t, z äh lt man 33 W irb e l, die 0 ,0 9 Länge einiiehmen,
und bis zum Becken la ssen sich, wen n die e rsten Schwanzwirbel
anch in dieser Species e tw a s kleiner w aren a ls die folgenden,
noch iingefäFir 6 Wirbel anneh n ien , w onach der Schwanz eine aus
u n gefähr 4 0 Wirbeln ziisaiiimengeselzle Länge v on 0 ,11 gemessen
liaheii würde. Die Wirbel am ä n sserste n Ende des Schwanzes sind
ungeiiiein klein, die acht letzten ergeben znsannneii nur 0 .0 0 7 Länge
der le tzte sch ein t konisch zu endigen, der a ch te vo n hinten is t nicht
über 0,001 lang nnd e tw a s wen iger hoch oder breit.
Weiter naeh v o rn nelinien die Schwanzwirbel allmählich
Länge zn. Die n ä chsten a cht Wirbel nehmen noch einmal so viel
Länge e in . am sechzelmlen Wirbel vo n hinten erhält man ein wenig
über 0 ,0 0 2 Länge nnd 0 ,0 0 1 5 Höhe, am zwanzigsten 0 ,0 0 3 Länge
bei 0 ,0 0 1 5 Ilö lie , am funfundzwanzigsten 0 .0 0 4 Länge bei elw.as
über 0 ,0 0 1 5 Höhe, am d re is s ig s te n , so wie am e in - und zweiiind-
dreis sig sten vo n hinten 0 ,0 0 4 5 , die g rö s s te Wirbellänge, bei
0 ,0 0 2 5 Höhe des Sc hw an z e s; die d avor liegenden, grössten th eils
ve rdeckten Schwanzwirbel scheinen an Länge nnd Höhe wieder
abgcnoinmen zn haben.
Auf die eigentliümliche Besciinffeiiheit des Schwanzes in Rham-
pliorhynchus habe ieh b e re its bei Kh. Gemmingi aufmerksam gem
a ch t; der Schwanz v o rliegender Species stimmt voilkoinnion cl.imit
überein. Er is t vo n neben e n ib lö s s t, wobei man sich überzeugen
k a n n , d a ss oben und unten feine Knochenfäden lau fen , zwischen
denen die in ihren vcriiknien Gelenkiläehen fest mit einander ver-
huiideiieii Wirbelkörper liegen. Diese Körper sind an der Unterseite
sta rk eingezogeii, so da ss hier die aus Knoclienfäden bestehende
Leiste nur mit den Wirhclendeii in Zusammenhang tr itt : es werden
dadurcli zwischen der Leiste und dem Körper llnch gewölbte
leere Ränini; v e ra n la s s t, wie sie an der oberen Seite des Schwanzes
nicht wahrgenommen werden. Bogen und Fo rtsä tz e w ü rden
zur Bildung eines ste ifen , bis zu einem g ewissen Gcrnd clnsti-
seheii Schwanzes nicht liiiigcreicht, und dem Brechen des Schwanzes
nicht vorg eh eu g t haben. Die Natu r, um Sehaffiing der zweckdienlichsten
Vorrichtung nie v e rle g en , hat dafür sich eines anderen
Mittels bedient und Leisten , die von Knochenfäden gebildet werden,
lind nicht dem Haiilskelet an g eb o ren , in Anwendung gehraehl. Diese
r eigenthiimliche Bau des Schwanzes is t eine der auffallcnd.sten
Erscheinungen an den Rhamphorhynchen.
Der am Anfang des Schwanzes fast quer liegende, mit seinem
Vorderarm einen spitzen Winkel besehreihende Oberarm ergiebt
0 ,0 1 5 Län g e , am oberen Ende 0 ,0 0 7 , nm unteren 0 ,0 0 4 5 und an
der schmälsten Stelle 0 ,0 0 2 Breite, Der obere Rand des Flügel-
förmig ausgebreileten Endes ist in der ungefähren .Mitte des Kandes,
wo die eigentliche Einlenkiiiigsstelle gelegen liaben w ird , erhöht
und zu beiden Seiten schwach aiisgeschnitlen. Der linke Oberarm
oberen Ende b e sch äd ig t, er liegt weiter vorn auf der Wirbelsäule
mehr der Länge nach noch mit seinem, dieselbe Richtung cin-
halteiideii Vorderarin zusammen.
Der Vorderarm, der deutlich aus zwei Knochen von fast gleicher
Stärke b e stellt, is t e iner der g rö ssten und stä rk sten Theile des
Skelets. Er e rgiebt fast 0 ,0 2 6 Lange, an beiden Enden fast 0 ,0 0 4
und im übrigen halb SO viel Breite. Die Handwurzel is t wohl überliefert,
g e s ta tte t aber keine Unterscheidung der Theile, wo rau s sie
besieht.
Die Hand liegt noch mit der Wurzel zusammen. Die meisten
Tlieile der rechten Hand weichen in ih rer Lage wenig von der Richtu
n g des Vorderarms ab, wobei sie th e ilweise vom linken Vorderarm
und e rsten Glied des linken Flugfingers bedeckt w e rd en ; die linke
Hand liegt mehr quer gegen die Wirbelsäule hin. Die Zahlen der
Glieder für die einzelnen Finger waren nichl genau zu ermitteln.
Den Mittelhandknochen des Fiugfingers konnte ieh nicht aiiffinden;
zu sclnvach hiefür würde der obere Thcil eines Mittelhandknochens
der rechten Hand von 0.001 Stärke seyn. Von den Mittelhand-
knoclien der linken Hand is t der untere oder hintere der vollständig
e re ; er e rgiebt 0 ,0 0 8 Länge bei 0 ,0 0 0 5 Stärke. Dazu wird der
ziinäciistliegende Finger geliören, der, wenn nichts fehlt, der zweite
Finger ist. Die drei Glieder dieses Fingers hängen noch zusammen;
das e rste Glied is t 0 ,0 0 2 lang und fast halb so b re it, die Länge des
e tw a s schwächeren zweiten beträgl 0 ,0 0 4 , die des dritten oder
Klauengliedes 0 .0 0 2 5 , d ieses ist 0 .0 0 1 5 breit oder hoch und geht
in eine krumme Spitze aus. Der daneben liegende Finger mit e twas
s tä rk erer Klaue wird der dritte seyn. Das 0 .0 0 3 lange Klauenglied
lenkt an ein Glied e in , das in Länge «nd Beschaffenheit mit dem
v o rletzten Gliede des anderen Fingers übereinstimmt, nnd dieses
s tö s s t an ein Glied, vo n dem kaum 0,001 Länge überliefert ist.
Auf der anderen Seite des Vorderarmes erk en n t man ebenfalls Ueberreste
von einem Finger. Die kurzen Finger der rechten Hand liegen
w eniger deutlich vo r. Zwischen den beiden weit aus einander
stehenden Fingern erkennt man einen sta rk gekrümmten Knochen,
der ein missbildetes Klauenglied seyn könnte.
Von den Gliedern des Flugfingers is t das e rste weniger gut
ü b e rliefert; vom linken Finger liegt es mit dem Vorderarm zusammen,
vom rechten unter dem zweiten Glied des rechten und linken,
so wie u n te r dem dritten Glied des linken Flugfingers, unter denen
es nur mit dem nntereii Ende herau ssieh t. Seine Länge hat nicht
u n te r 0 .0 3 3 betragen bei nicht ganz 0 ,0 0 4 Breite am unteren Ende.
Mit dem unteren Ende des sch räg nach v o rn gerichteten zweiten
Gliedes des linken Fiugfingers kreuzt sich das obere Ende des dritten
Gliedes, wobei es zugleich zwischen dem e rsten und zweiten Gliede
des rechten Flugfingers liegt. Dieses hin te rwä rts gerichtete dritte
Glied is t an seinem unteren Ende nicht v o llständig; es bildet mit
dem von dem rechien Oberarm und Vorderarm überdeckten vierten
oder letzten Glied einen stumpfen Winkel; vo n diesem Glied is t nur
d a s ä u sserste Ende wirklich vorhanden, das auf dem Schwänze liegt.
Vom rechten Flugfinger is t die Riclitnng des zweiten Gliedes von
der des e rsten wenig v e rsch ied en ; dabei liegt es nicht allem auf
diesem, sonder« anch auf dem dritten linken uud wird vom zweiten
linken überdeckt, Das an seinem obeien Ende nnvollstandige dritte
Glied des rechten Fiugfingers liegt mit dem zweiten unter Bildung
eines wenig mehr als ein Rechter betragenden Winkels zusammen,
cs liegt dabei auf dem Schwanz und der rechte Vorderarm kreuzt
sieh mit ihm. Mit diesem dritten Gliede bildet das auch auf dem
Scini anze liegende v ie rte einen se h r stumpfen Winkel, wobei diese
beiden Glieder in ihren einander zugekehrten Enden das vierte linke