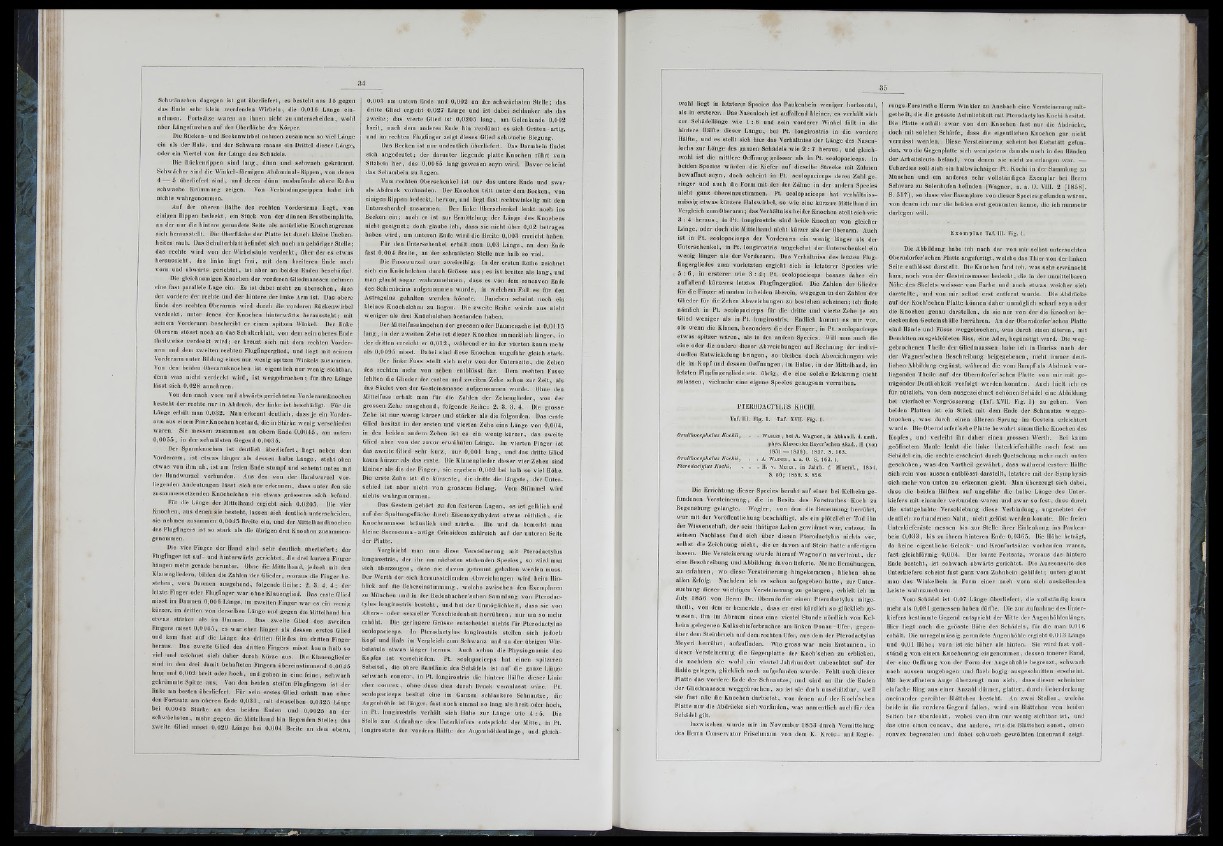
Schwniizehcn dagegen ist gut nbe rlieferl, e s bestellt ans 15 gegen
das Ende sein' klein weidenden Wirbeln, die 0 ,0 1 6 Länge cin-
nelimen. Eorlsiilze waren an ihnen nicht zu un te rs ch e id en , wohl
nnf der Oberfläche der Körper.
Die Rücken- und Beckenwirbel ncliiuen zusammen so viel Lange
ein als der Unis, und der Schwanz maass ein Drittel d ieser Lange,
oder ein Viertel von der Länge des Schädels.
Die Rückenrippen sind la n g , dünn und schwa ch gekrümmt.
Schwächer sind die Winkel-förmigen Abdominai-Kippen, von denen
4 — 5 überliefert s in d , nnd deren dünn nuslaufeiide obere Enden
schwache Krflmiming zeigen. Von Verbindungsrippen habe ich
nichts wahrgeiiominen.
Auf der oberen Oälfle des rechten Vorderarms lie g t, von
einigen Rippen b edeckt, ein Stück von der dünnen Bruslbeinpiatte,
an der nur die hintere gerundete Seite a ls natürliche Knochengrenze
sich licrausstcllt. Die Oberfläche der P latte ist durch kleine Unebenheiten
rauh. Das Schulterbiatt befindet sich noch an gehöriger S te lle ;
d a s rechte wird von der Wirbelsäule v e rd e ck t, über der es e tw as
h e ra n s s ie h t, das linke liegt fre i, mit dem breiteren Ende nach
vo rn und abwärt.s g e ric h te t, is t aber an beiden Enden besclindigf.
Die gleielinamigen Knochen der vorderen Gliedinnasseu nehmen
eine fast parallele Lage ein. Es is t dabei nicht zu ü b e rse h en , dass
der vordere der rechte und der hintere der linke Arm ist. Das obere
Ende des rechten Oberarms wird durch die vorderen Rückenwirbel
v e rd e ck t, unter denen der Kuoelien hin te rwä rts he rau sste .h t; mit
seinem Vorderarm beschreibt e r einen spitzen Winkel. Der linke
Oberarm stö s s t noch an das Schulterblatt, von dem sein oberes Ende
theilweise verdeckt w ird ; er kreuzt sich mit dem rechten Vorderarm
und dem zweiten rechten Fiugfingerglicd, und liegt mit seinem
Vorderarm unter Bildung eines nur wenig spitzen Winkels zusammen.
Von den beiden Oberarmknochen is t cigenilich nur wenig sichtbar,
denn w a s nicht verdeckt w ird , is t w eg g eb ro ch en ; für ihre Länge
lä s s t sich 0 ,0 2 8 aniielimen.
Von den nach vorn und abwä rts gerichteten Vorderarmknoclien
be steh t der rechte nur in Abdruck, der linke is t bescliädigl. Für die
Lange erhält man 0 ,0 3 2 . .Man erkennt deutlich, das.s je ein Vorderarm
aus einem Paar Knochen bestand, die in Stärke wenig verschieden
w aren . Sie messen zusammen am obern Ende 0 ,0 0 4 5 , am iintern
0 ,0 0 3 5 , in der schmälsten Gegend 0 ,0 0 3 5 .
Der Spannknochen is t deutlich ü b e rliefert, liegt neben dem
Vorderarm, is t e tw a s länger a ls dessen halbe L än g e , ste h t oben
e tw as von ihm a b , is t am freien Ende stumpf und sch ein t iinten mit
der Handwurzel verbunden. Aus den von der Handwurzel v o rliegenden
Andeutungen la s s t sich nur e rk en n en , dass u n te r den sie
zusammeiisetzendcn Knöchelchen ein e tw as g rö sse re s sich befand.
Für die Länge der Mittelhand ergiebt sich 0 ,0 2 0 5 . Die v ier
Knochen, aus denen sie besteht, la ssen sich deutlich unterscheiden,
sic nehmen zusammen 0 ,0 0 4 5 Breite ein, und der Mittelhandknochen
des Fliigfingers is t so sta rk a ls die übrigen drei Knochen zusammen-
genomnien.
Die v ie r Finger der Hand sind s e h r deutlich üb e rliefert; der
Fliigfinger is t auf- und hin te rwä rts gerich te t, die drei kurzen Finger
häiigcii mehr gerade herunter. Ohne die Mittelhand, Jedoch mit den
Klauengliedern, bilden die Zahlen der Glieder, wo rau s die Finger bes
te lle n , vom Daumen au sg eh en d , folgende Reihe: 2 . 3. 4, 4 ; der
letzte Finger oder Fliigfinger w a r ohne Klauenglied. Das e rste Glied
m is st im Daumen 0 ,0 0 6 Länge, im zweiten Finger w a r es ein wenig
k ürzer, im dritten von derselben Länge und gegen die Mittelhand hin
e tw as stä rk er a ls im Daumen. Das zweite Glied des zweiten
Fingers misst 0 ,0 0 4 5 , es w a r eher länger a ls dessen e rs te s Glied
und kam fast auf die Länge des dritten Gliedes im dritten Finger
heraus. Das zwe ite Glied des dritten Fingers misst kaum halb so
viel und zeicliiiet sich daher durch Kürze au s. Die Klanenglieder
sind in den drei damit behafteten Fingern übereinstimmend 0 ,0 0 4 5
lang und 0 ,0 0 2 breit oder hoch, und gehen in eine feine, schwach
gekrümmte Spitze ans. Von den beiden steifen Fliiglingern ist der
linke am besten überliefert. Für sein e rstes Glied e rh ä lt man ohne
den Fo rtsa tz am oberen Ende 0 ,0 3 1 , mit i
1 0 ,0 3 2 5 Länge
bei 0 ,0 0 4 5 Stärke an den beiden Enden und 0 ,0 0 2 5
s c hw ä ch s ten , mehr gegen die Mittelhand hin liegenden Stelle; das
zweite Glied misst 0 ,0 2 9 Lange bei 0 ,0 0 4 Breite an dem obern,
0 ,00 3 nm imfern linde «nd 0 ,0 0 2 an der s chwä ch s ten Stelle; das
dritte Glied ergiebt 0 ,0 2 7 Lange und is t dabei sch lan k e r als das
zw e ite ; das v ie rte Glied is t 0 ,0 2 0 5 la n g , am Geienkende 0 ,0 0 2
b re it, nach dem anderen Ende hin verdünnt es sich Gräten - artig,
und im rechten Fliigfinger zeigt die ses Glied schwache Biegung,
Das Becken ist nur undeutlich überliefert, Das Darmbein findet
sicli an g ed en tet; der da ru n te r liegende p la tte Knochen rü h rt vom
Sitzbein h e r , das 0 ,0 0 6 3 lang g ewe sen sey n wird. Davor scheint
das Schambein zu liegen.
Vom rechten Oberschenkel is t nur das u n te re Ende und zwar
als Abdruck vorlianden. Der Knochen tritt unter dem Becken, von
einigen Rippen bedeckt, h e rv o r, und liegt fa s t rectitwinkelig mit dem
Unterschenkel zusammen. Der linke Oberschenkel lenkt noch ins
Becken e in ; auch er is t zur Ermittelung der Länge des Knochens
nicht g e eig n e t; doch glaube ic ii, d a s s sie nicht über 0 ,0 2 betragen
haben w ird , am unteren Ende wird die Breite 0 ,0 0 3 e rreich t haben.
Für den Unterschenkel e rhä lt man 0 ,0 3 L än g e , an dem Ende
fast 0 .0 0 4 Breite, an der schmälsten Stelle nur halb so viel.
Die Fusswurzel w a r zweireihig. In der e rsten Reilie zeichnet
sich ein Knöchelchen durch Grösse a u s ; es is t breiter a ls la n g , und
man glaubt so g a r wah rzu n e lim en , d a ss es vo n dem concaven Ende
des Schienbeins aiifgenommen w u rd e , in welchem Fall e s für den
Astraga lus gehalten werden köniile. Daneben scheint noch ein
kleines Knöchelchen zii liegen. Die zwe ite Reihe wu rd e au s n icht
weniger a ls drei Kuöchelchen bestanden haben.
Der .Mitteifussknoehen der g ro ssen od e r Dauraenzehe is t 0 ,0 1 1 5
la n g , in der zweiten Zctie is t d ieser Knochen unmerklich län g er, in
der dritten e rreich t e r 0 ,0 1 2 , während e r in der v ie rten kaum mehr
a ls 0 ,0 0 9 5 misst. Dabei sind diese Knochen ungefähr gleich sta rk .
Der linke F u s s ste llt sich mehr von der U n te rse ite , die Zehen
des rechten mehr vo n neben e n tb lö s s t dar. Dem rechten Fiisse
felillen die Glieder der e rsten und zweiten Zehe schon zur Z e it, als
das Skelet vo n der Gesteinsmasse nufgcnommen wurde. Ohne den
.Mittelfuss e rh ä lt man für die Zahlen der Zeh en g lied er, von der
gro s s en Zehe au sg eh en d , folgende Reihe: 2. 3. 3. 4. Die g ro sse
Zehe is t n u r wen ig kürzer und s tä rk e r als die folgenden. Das e rste
Glied besitzt in der e rsten und vierten Zehe eine Länge vo n 0 ,0 0 4 ,
in den beiden ändern Zehen is t es ein wen ig k ü rz e r, das zweite
Glied aber von der zu vor e rw äh n ten Länge. Im vie rten Finger ist
das zwe ite Glied seh r k u rz , nur 0 ,0 0 1 la n g , und das d ritte Glied
kaum kürzer als das e rste. Die Klauenglieder d ieser v ie r Zehen sind
kleiner a ls die der F in g er, sie ergeben 0 ,0 0 2 bei halb so viel Höhe.
Die e rste Zehe is t die k ü rz e s te , die d ritte die lä n g s te , der Unterschied
is t aber nicht von gro ssem Belang. Vom Sliimmei wird
nichts wahrgenommen.
Das Gestein g e h ö rt zu den festeren L ag e n , es ist gelblich und
a u f der Spaltungsfläche durch Eisenoxydhydrat e tw a s rö llilich , die
Knoclienmasse bräunlich und mürbe. Hie und da bemerkt man
kleine Saccocoma - a rtige Crinoideen z ahlreich au f der unteren Seite
der Platte.
Vergleicht man nun diese Versteinerung mit Pterodactylus
lo n g iro s tris , der ihr nm nächsten stehenden S p e c ie s , so wird man
Sich üb e rz eu g en , d a ss sie davon g c lrc n n t gehalten werden muss.
Der Werth der sich herausslcllenden Abweichungen wird beim Hinblick
au f die Uebereinstimmung, welche zwisch en den Exemplaren
zu Miinclicn und in der Redcnbaclier’achen Sammlung v on Pterodac-
ly lu s lo n g iro stris b e s te h t, nnd bei der Unmöglichkeit, d a ss sie von
A lte rs - oder sexueller Verscliicdcnheit lie rrü h ren , n u r um so mehr
erhöht. Die gerin g e re Grösse entscheidet n ichts für Pterodaclylus
scolopaeiceps. In Pterodactylus lo n g iro stris stellen sich jedoch
Kopf und Hals im Vergleich zum Schwanz und zu der übrigen Wirbelsäule
e tw a s länger heraus. Auch schon die Physiognomie des
Kopfes ist verschieden. Pt. scolopaeiceps hat einen .spitzeren
Sch e itel, die obere Randlinic des Schädels ist a u f die ganze Länge
schwa ch co n cav , in Pt. lon g iro stris die h intere Hälfte d ieser Linie
eher c o n v e x , ohne d a ss dies durch Druck vcrniilasat wäre. Pt,
scolopaeiceps besitzt eine im Ganzen sch lankere Seh n au tze , die
Augenhöhle is t länger, fast noch einmal so lang a ls breit oder hoch,
in Pt. lo n g iro stris v e riiält sich Höhe zur Länge wie 4 : 5. Die
Stelle zur Aufnahme des Unterkiefers enlS]iriclil der .Mille, in Pl.
longirostris der vordem Hälfte der Augcnhühlenlütige, und gleicliwohl
liegt in letzterer Species das Paiikenbein weniger horizontal,
a ls in e rste re r. Das Nasenloch is t aufTallend kleiner, es v e rh ä lt sich
zur Schädellänge wie 1 : 6 und sein v o rd erer Winkel fällt in diu
hintere Hälfte d ieser Län g e , bei Pt. lo n g iro stris in die vordere
Hälfte, und es ste llt sich hier d a s Verhältniss der Länge des Nasenlochs
zur Länge des ganzen Schädels wie 2 : 7 h e ra u s , und gleichwohl
is t die mittlere Ocifnung g rö s se r a ls in Pt, scolopaeiceps. In
beiden Species würden die Kiefer a u f dieselbe Strecke mit Zähnen
bewaffnet s e y n , doch sch ein t in Pt. scolopaeiceps deren Zahl geringer
«nd auch die Form mit der der Zähne in der ändern Species
nich t ganz übereinzuslimmen. Pt. scolopaeiceps h a t v e rh ä ltn issmässig
e tw a s kürzere Halswirbel, so wie eine kürzere Mittelhand im
Vergleich zum Oberarm; das V erhältniss beider K nochen ste llt sich w ie
3 : 4 h e ra u s , in P t. lo n g iro stris sind beide Knochen vo n gleicher
Länge, oder doch die Mittelhand n icht kürzer als der Oberarm. Auch
is t in Pt. scolopaeiceps der Vorderarm ein wenig länger a ls der
Un terschenkel, in P t. lo n g iro stris «mgekehrt der ünterscheDkel ein
wenig länger a ls der Vorderarm. Das Verhältniss des letzten Flugfingergliedes
zum v o rletzten ergiebt sich in letzterer Species wie
5 : 6 , in e rs te re r wie 3 : 4 ; Pt. scolopaeiceps b e sass daher ein
auffallend kürzeres letztes Flngfingerglied. Die Zahlen der Glieder
für die Finger stimmten in beiden überein, wogegen in den Zahlen der
Glieder für die Zehen Abweichungen zu bestehen sch ein en ; ich finde
nämlich in Pt. scolopaeiceps für die dritte und v ie rte Zehe je ein
Glied wen ig er als in Pt. lo n g irostris. Endlich kommt e s mir vor,
a ls wenn die Klanen, b e sonders die der F in g e r, in Pt. scolopaeiceps
e tw a s sp itzer w ä r e n , a ls in der ändern Species. Will man auch die
eine oder die andere d ieser Abweichungen au f Rechnung der individuellen
Entwickelung b rin g en , so bleiben doch Abweiclunigen wie
die im Kopf und d e ssen Oelfniiugcn, im Halse, in der Mittelhand, im
letzten Flugfingergüede etc. ü b rig , die eine solche Erklärung nicht
z u la s s en , vielmehr eine eigene Speeies genugsam ve rrath eu .
PTERODACTYLUS KOCHI.
Taf. m. Fig. t. Taf. XVII. Fig. I.
Ornithocephalus Kochii,
Ornithocephalus Kochii,
Pterodactylus Kochi,
. W.ioiER, bei A. Wagner, in Abhsniil. li. math,
phys. Klasse der Biiyer’aohcn Akad., U (vun
1831 — 1836). 1837. S. 163.
. A. WioNER, a. a, 0. S. 163. t.
. H. V. Meyer, in Jahrb. f. Mineral., 1854.
S. 56; 1856. S. 876.
Die Errichtung d ieser Species beruht au f e iner bei Kelheim gefundenen
Verste in e ru n g , die in Besitz des F o rslra lh es Koch zu
Regeiisburg gelangte. Wag le r, von dem die Benennung herrülirl,
w a r mit der Verölfeiitlichiing be sch ä ftig t, als ein plötzlicher Tod ihn
der Wissenschaft, der sein thä tige s Leben gewidmet w a r, entzog. In
seinem Nachlass fand sich über diesen Pterodactylus nichts vor,
s e lb s t die Zeichnung n ic h t, die er davon a u f Stein h a tte anfertigen
la sse n . Die Versteinerung wurde h ierauf Wagner'n a n v e r ir a u t, der
eine Beschreibung und Abbildung davon lieferte. .Meine Bemühungen,
zn e rfah ren , wo diese Versteinerung hingekommen, blieben ohne
allen Erfolg. Nachdem ich e s schon aiifgegeben h a lte , zur Uiiler-
SHcluing d ie ser w ichtigen Versteinennig zu g e lan g en , erhielt ich im
Jiily 1 856 von Herrn ü r . Oberndorfer einen Pterodactylus mitge-
th e ilt, von dem er b emerkte, d a s s e r e rs t kürzlich so glücklich gew
e s e n , ihn im Abriium e ines eine viertel Stunde nördlich von Kel-
hcini gelegenen K aik sd iiefcrbriiches am linken D o n au -U fe r, gegenüber
dem Slcinbruch a u f dem rechten Ufer, ans dem der Pterodactylus
Meyeri h e rrn lirt, niifzufinden. Wie g ro s s w a r mein E rs tau n e n , in
dieser Versteinerung die Gegenpiatte der Kooh’sch en zu erblicken,
die naclidem sie wohl ein viertel Jalirliiindert unbeachtet a u f der
Halde gelegen, glücklich noch anfgefimdeii wurde. Fehlt auch dieser
Platle das v o rd ere Ende der Sch n an tze , nnd sind an ihr die Enden
der Gliedmaassen w eg gcbroclicn, so is t sie doch u n sch ätzb ar, weil
sie fast alle die Knochen d a rb ie te t, von denen au f der Koch'schen
Platte nur die Abdrücke sich vorfindeii, w a s iiamenllich auch für den
Schädel gilt.
Inzwischen wurde mir im November 1 8 5 3 durch Vermittelung
des Herrn Cüii.servator Frischmanii vo n dem K. K re is - und Rcgieru
n g s-Forstratlie Herrn Winkler zu Ansbach eine Versteinerung mif-
getheilt, die die g rö sste .Aehnlichkeit mit Pterodactylus Kochi be.sitzt.
Die Platle enthält zwar von den Knochen fast nur die Abdrücke,
doch mit solcher Schärfe, da ss die eigentlichen Knochen gar nicht
vermisst werden. Diese Verstcineruiig scheint bei Eiebslätt gefunden,
wo die Gegenpiatte sich wen ig sten s damals noch in den Händen
der Arbeilsleute befand, von denen sie nicht zu erlangen war. —
Ueberdies soll sich ein halbwüchsiger Pt. Kochi in der Sammlung zu
München und ein anderes seh r vollständiges Exemplar bei Herrn
Schwarz zu Solenhofcn befinden (Wag n er, a. a. 0 . Vlil. 2 [1 8 5 8 ].
S. 5 1 7 ) , so dass v ie r Exemplare von dieser Species gefunden wären,
vo n denen ich nur die beiden erst genannten kenne, die ich nunmehr
darlegeii will.
E x em p la r Taf. III. Fig. 1.
Die Abbildung habe ich nach der von mir se lbst untersuchfcn
Obcrndorfer’achen Platte angefertigt, welche das Thier von der linken
Seite en tblösst da rstellt. Die Knochen fand ich, was seh r erwünscht
kam, noch vo n der Gesteinsmasse bedeckt, die in der unmittelbaren
Nähe des Skelets w eisser von Farbe und auch e tw a s weicher sich
d a rs te llte , und von mir se lb st e rs t entfernt wurde. Die Abdrücke
a u f der Kocli’scheii Piatte können dah er unmöglich sc h a rf seyn oder
die Knochen genau da rstellen , da sic nur von der die Knochen bedeckenden
Gesteinshullc herrühren. An der üb erndorfer’schen Platte
sind Hände und Füs se w eg gebrochen, w a s durch einen ä lte re n , mit
Dendriten ausgekieideten Riss, eine Ader, begünstigt ward. Die weg-
gebrochenen Tlieile der Gliedmaassen habe ich in Umriss nach der
der Wagnerischen Beschreibung beigegebenen, nicht immer deutlichen
Abbildung ergänzt, während die vom Rumpf als Abdruck v o rliegenden
Theile a u f der Oberndorfer’schen Platte von mir mit genügender
Deutlichkeit v e rfolgt werden konnten. Auch liieil ich es
für nützlich, von dem aiisgezeiclinet schönen Schädel eine Abbildung
bei vierfacher Vergrösserung (Taf.XVH. Fig. 1) zu geben. Von
beiden Platten is t ein Stück mit dem Ende der Sehnautze wegge-
b ro eiien , w a s durch einen älteren Sprung im Gestein erleichtert
wurde. Die Oberndorfer’sche Platte b ewah rt sämmtliche Knochen des
Ko p fe s, und v e rle ih t ih r daher einen grossen Werth. Bei kaum
geöffnetem Maule lenkt die linke Unterkieferhälfte nocIi fest am
Schädel ein, die rechte e rsch ein t durch Quetschung mehr nach iinten
g e sch o b en , w a s den Vortheil g ew ä lirt, d a ss während e rstere Hälfte
sich rein von au ssen entb lö sst d a rs te llt, le tztere mit der Symphysis
sich mehr von initen zu erkennen giebt. .Man überzeugt sich dabei,
d a ss die beiden Hälften a u f ungefähr die halbe Länge des Unterkiefers
mit einander verbunden waren und zw a r so fest, d a ss durch
die sta tlg eh ab te Verschiebung diese Verbindung, ungeachtet der
deutlich vorhandenen Nah t, nicht g elöst werden konnte. Die freien
Unterkieferäste messen bis zur Stelle ih rer Einlenkung ins Paukenbein
0 ,0 3 3 , bis zn ihrem hinteren Ende 0 ,0 3 6 5 . Die Höhe beträgt,
da keine eigentliche Gelenk- und Kronfortsälze vorhanden waren,
fast gleichförmig 0 ,0 0 4 . Der kurze F o rtsa tz , wo rau s das hintere
Ende b e s te h t, is t schwa ch a bw ä rts g erichtet. Die Aussenseite des
Unterkiefers scheint fa s t ganz vom Zahnbein g ebildet; unten glaubt
inan das Winkelbein iu Form einer nach vo rn sich auskeilcnden
Leiste walirzunchmen.
Vom Schädel ist 0 ,0 7 Länge ü b e rliefert, die vollständig kaum
mehr a ls 0,081 gemessen haben dürfte. Die zur Aufnahme des Unterkiefers
bestimmte Gegend entsp rich t der Mitte der .Augenhülilcnlänge.
Hier liegt auch die g rö s s te Höhe des Sch äd els, für die man 0,016
erhält. Die iinregclmässig gerundete Augenhöhle ergiebt 0 ,0 1 3 Länge
und 0 ,01 Höhe; vo rn ist sie höher als hinten. Sie wird fast vollstän
dig vo n einem Kiiochenring eingenommen, dessen innerer Rand,
der eine Oeffnung von der Form der .Augenhöhle b eg ren zt, schwa ch
nach au ssen umgebogen und flacli bogig ausgeschnitten erscheint.
Mit bewaffnetem Auge überzeugt man s ic h , d a ss d ieser scheinbar
einfache King au s einer Anzahl dünner, g la tte r, durch Ucberdeckiing
aneinander g e re ih te r Blättchen besteht. An zwei Stellen , welche
beide in die vordere Gegend fallen, wird ein Blättchen von beiden
Seiten licr ü b e rd e ck t, wobei von ihm nur wenig sich tb a r i s t , und
das eine einen co n cav , das a n d ere, wie die Blättchen s o n s t, einen
convex begrenzten uud dabei sclnvacli gewölbten Innenrand zeigt.