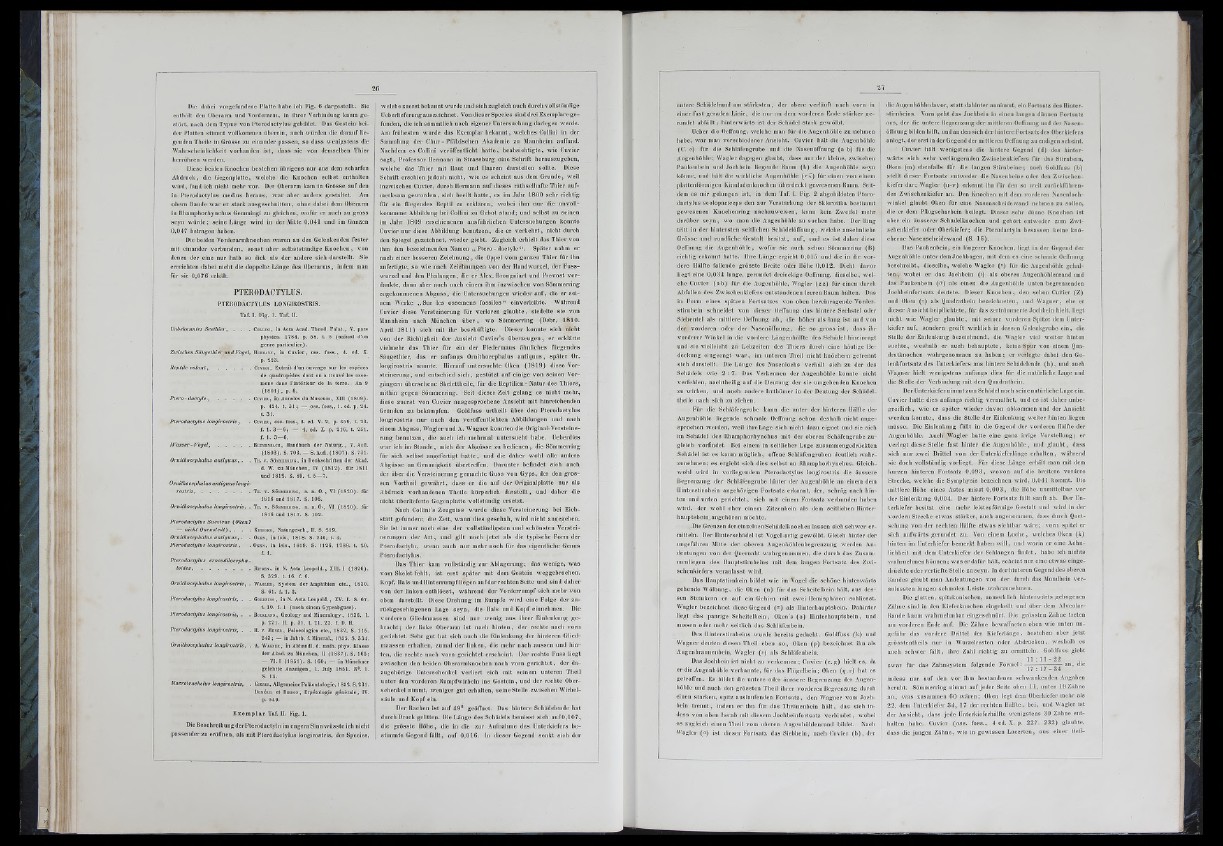
Dip (liibci vorgerimdcnc PIntle habe ieh Fig. 6 dargestcllt. Sie
onlhält den llb e ian n und Vorderarm, in ihrer Verbindung kaum ge-
slö rl, inicli dem Typus von Pierodactylus gebildet. Das Gestein beider
Plaltun stimmt vollkommen überein, auch würden die darauf liegenden
Theile in Grösse zu einander p a ssen, so da ss wenigstens die
U'nlirsclieinlichkcit vorhanden is t , d a ss sic von demselben Thier
herrühren werden.
Diese beiden Knochen bestehen übrigens n u r aus dem scharfen
Abdruck, die Gcgenplatle, welche die Knochen se ihst eiilhalfen
wird , f.ind ich nicht mehr vor. Der Oberarm kam in Grösse au f den
in. Pterodactylus medius h e ra u s , w a r aber anders g e staltet. Am
obern Rande war e r slark a u sg esch n itten , ohne dabei dem Oberarm
in Khamphorhynchus Gemmingi zu gleichen, wofür er auch zu gross
seyn w ü rd e ; seine Länge wird in der Mitte 0,041 und im Ganzen
0 ,0 4 7 betragen haben.
Die beiden Vorderarmknoclien waren an den Geleiikcnden fester
mit einander v e rb u n d en , so n s t aber se lbstständige Kn o ch en , von
denen der eine n u r halb so dick als der andere sich darstellt. Sie
e rreichten dabei nicht die doppelte Länge des Oberarms, indem man
für sie 0 ,0 7 6 erhält.
PTERODACTYLUS.
PTERODACTYLUS LONGIROSTRIS.
Taf. I. Fig. 1. Taf. II.
Unbekanntes Seelhier, . . . Collis;, in Ada .4cad. Tticoil P.ilat., V. pars
physica. 1784. p. 68. t. 5 (animal li’uii
genro particulier).
Zwischen Säiigethier undrogcl, IIebmass, in Cuvier, oss. foss., 4. ed. X,
p. 223.
Ite/itile rolaiit ......................Citier, Extrait d’un ouvrage sur les espèces
de goniinipèdes dont on a trouvé les osse-
Dicns dans l'intérieur de In terre. Au 9
(1 8 0 1 ), p. 6.
Ptcro - dactyle, ...................... Covier, in Annales du Muséum, Xlll (1809).
p. 424. t. 31; — oss. foss., I. cd. p. 24.
t. 31.
. CtrvitR, oss. foss., 3. cd. V. 2. p. 359. t. 23.
f. 1 . 3 - 6 ; - 4. cd. X. p. 216. t. 251.
I. 1. 3—6.
. BLiMESSACn, Handbuch der Kalnrg., 7. Anfl.
(1803). S. T03. — 8. Aufl. (1807). S. 731.
. Tu. V. SBuuEBRiac, in Denkscliriflen der Akad.
d. W. zn München, IV (1812). fur 1811
nnd 1812. S. 89. t. 5 — 7.
Ornithocephalus antiquus longirostris......................................
Te. V. SSiisiERRixs
1816 und 1817
Ornithocephalus longirostris, . Tn. v. SB.umerrisc.
1616 und 1817. S. 102.
Pterodactylus Suevicus (Oken?
— nichl Quenstedt) . . . . Krieoer, Natargesch-, 11. S. 219.
Ornithocephalus antiguus, . . Okea, in Isis, 1818. S. 246. t- 4.
Pterodaclylus longirostris, .Oke.v, in Isis, 1819. S. 1126. 1788. 6. 20.
f. 1.
Plcrodaclylus crocodilocepkal
o i d e s , .................................Ritses, in N. Acta Leopold., XIII. I (1826).
S. 329. t. 16. f. 6.
Ornithocephalus longirostris, . Waoler, System der Amphibien etc., 1830.
S. 61. f. 1. 2.
. Goldfcss, in N. Ada Leopold., XV. I. S. 67.
t. 10. f. I (nach einem Gypsabgnss).
Plcrodaclylus lonyirostris,
Wasser-Vogel, . . . .
Omitkocephalus anliguus, .
, VI (1820). für
, VI (1820). für
Pterodaclylus longirostris, ,
Plcrodaclylus longirostris, . .
Pterodaclylus longirostris, .
Ornithocephalus longirostris,
Macrolraclielus longirostris,
Bccklam) , Gcology and Mineralogy, 1836. I,
p. 221. lt. p. 31. t. 21. 22, f. D. II.
H. V, .\lEïEn, Palaeologica etc., 1832. S. 116.
243; — in Jahrb. f. Mineral., 1855. S. 334.
A. Waoser, in Abhandl. d. malh. phys. Klasse
der Akad. zu Mfliichen, II (1837). S. 166;
— VI. I (1851). S. 160; — in .Münchner
gelehrte Anzeigen, 1. July 1861. N». 1.
S- 14.
Giebel, Allgemeine Paläontologie. 1852.8.231.
ÜCHBRIL et BmnoK, Erpétologie generale, IV.
E x em p la r Taf. 11, Fig. 1.
Die B eschreibungder Pterodaclyln im engem Sinn w ü s s te ich nicht
sender zu erülfnen, als mit Pterodactylus longirostris, der Species,
I w elch e ziie rst bekannt w urde lind sich zugleich aucli durch vollständige
Uebcriicferiing niiszeichnet. Von dieser Species sind drei Exemplare gefunden,
die ich sämmtücli nach eigener Untersiiehung darlegcn werde.
Am frühesten wurde das Exemplar b e k an n t, welches Collini in der
Samiiiluiig der Chur - Pfälzischen Akademie zu Mannheim iuiiTand.
Nachdem es Collini verölTcntlicht h a tte , b e ab sich tig te, wie Cuvier
s.agt, Pro fessor Hermann in Stra ssb iirg eine Schrift herniisziigeben,
welche das Thier mit Haut und Haaren darstellen sollte. Diese
Schrift erschien jedocli nich t, wie e s scheint aus dem Grunde, tveil
inzwischen Cuvier, durch Hermann au f dieses räthselhafte Thier aufmerksam
g ew o rd en , sich beeilt h a tte , es im J a h r 1 8 0 0 s e h r richtig
für eil) fliegoiides Reptil zu e rk lä ren , wobei iliiii nur die iinvoil-
kommcne Abbildung bei Collini zu Gebot s ta n d ; und s e lb s t zu seinen
im J a h r 1 8 0 9 erschienenen ausführlichen Untersuchungen konnte
Cuvier n u r diese Abbildung b e nu tzen , die er v e rk e h rt, n icht durcli
den Spiegel gezeichnet, wieder gicht. Zugleich erhielt das Thier von
ihm den bezeichnenden Namen „ Ptero - dactyle Später nahm er
nach e iner b e sseren Zeich n u n g , die Üppel vom ganzen Thier für ihn
anfertigte, so wie nach Zeichnungen vo n der Handwurzel, der Fiiss-
wiirzel und den Phalangen, die er Alex. Brongniart und P ré v o s t v e rdankte,
dann ab er auch nach einem ihm inzwischen vo n Sömmerring
zugckommeiiüu A b g u ss, die Untersuchungen wieder a u f, die e r se inem
Werke „ S u r les o sseinens fo s s ile s “ einverleibte. Während
Cuvier diese Versteinerung für ve rlo ren g la u b te , siedelte sie von
.Mannheim nach München ü b e r, w o Sömmerring (Dcbr. 1 8 1 0 .
April 1 8 1 1 ) sich mit ihr beschäftigte. Dieser k o nnte sich niclit
von der Richtigkeit der Ansicht Cuvier’s ü b e rz eu g en , e r erklärte
vielmehr das Tliier für ein der Fledermaus ähnliches fliegendes
Saugelhier, das er anfangs Ornithocephalus a n liq u iis , sp ä te r Or.
lo n g iro stris n annte. Hierauf imlersiichte Oken (1 8 1 9 ) diese Ver-
ste iiien iiig , und entschied s ic h , ge stü tz t au f einige von seinen Vorgängern
ü bersehene Skelettheile, für die Reptilien - N atur des Tliiers,
mithin g egen Sömmerring. Seit d ieser Zeit gelang e s n icht mehr,
diese zu erst vo n Cuvier au sg esp ro ch en e A nsicht mit hinreichenden
Gründen zu bekämpfen. Goldfuss u rth eilt üb e r den Pterodac tylus
lo n g iro stris nur nach den veröffentlichten Abbildungen und nach
einem Ab g u ss, Wagler und A. Wagner konnten die Original-Versteinerung
ben u tzen , die auch ich mehrnial u n te rsu ch t habe. Ueberdies
w a r ich im S tan d e , mich der Abgüsse zu b e d ien en , die Sömmerring
für sich se lb st an g efertigt h a tte , und die d aher wo h l alle andere
-Abgüsse an Genauigkeit «bertreffeii. Darunter befindet sich auch
der über die Versteinerung gemachte Guss von Gyps, der den g ro ssen
Vorthcil g ew ä h rt, d a s s e r die auf der Originalplatte nur als
Abdruck vorhandenen TheÜe körperlich d a rs te llt, nnd daher die
nicht überlieferte Gegenpiatte vollständig e rsetzt.
Nach Collini's Zeugniss wu rd e diese Versteinerung bei Eichs
tä tt gefunden; die Zeit, wan n dies g e sch ah , wird nicht angegeben.
Sie is t immer noch eine der vo lls tän d ig sten unii sch ö n sten Versteinerungen
der A rt, und gilt noch je tz t als die ty p is ch e Form der
Ptero d ac ty in , wenn auch nur mehr noch für das eigentliche Genus
Ptcrodactyliis.
Das Thier kam vollständig zur Ablagerung; d a s wenige, w a s
vom Skelet feh lt, is t e rs t sp ä ter mit dem Gestein weggehrochen.
Kopf, Hals im dH in terrum p flieg en au fd er rechten Seile und sind daher
von der linken c n tb lö s s t, wah ren d der Vorderriimpf sich mehr von
oben d a rstellt. Diese Drehung im Rumpfe wird eine Folge der zii-
rückgeschlagencn l.-age s e y n , die Hals und Kopf einiiehmen. Die
vorderen Gliedmaassen sind nur %venig aus ih rer Einicnkuiig g e b
ra c h t; der linke Oberarm is t naeh liin ten , der rechte nach vnrii
g e richtet. Sehr g u t h a t sich auch die Einlenkimg der h in te ren Giied-
maassen erlialtcn, zumal der linken, die mehr nach au ssen iiiul liin-
tcn, die rechte iiac-h vo rn g e richtet crselieiiit. Der rcelite Fu s s liegt
zwischen den hcideii Oberarmknoclien nach vo rn g e ric h te t, der dazugehörige
Unterschenkel v e rliert sieh mit seinem unteren Theil
u n te r den vorderen Riimpfwirbcln ins Gestein , mici der reclite Oberschenkel
nimmt, weniger g u t e rh a llen , seine Stelle zwisehen Wirhel-
säulc und Kopf ein.
Der Rachen is t a u f 4 9 “ gcölTnel. Das hintere Seliädelende hat
durch Druck gelitten. Die Länge des Schädels burnissi sich aiifO,lÜ7,
die g rö s s te llü tie , die in die zur Aufnahme des Unterkiefers bestimmte
Gegend fällt, auf 0 ,0 1 6 . In d ie ser Gegend sen k t sich der
untere Scliädelraiid aiii s tä rk s te n , der obere v e rläuft nach vorn in
einer fast geraden Linie, die nur an dem vorderen Ende stä rk e r gerundet
ahfällt; lliiilerwärts is t der Schädel slark gewölbt.
Ueber die OclTimiig, welche iiiau für die Augenhöhle zu iielimen
habe, w a r man v e rschiedener Ansielit. Cuvier hält die Augenhöhle
(C. c) für die Sehläfengnibe und die Nascnöffniiiig (a b) für die
Au g enhöhle; Wagler dagegen glaubt, d a ss nur der kleine, zwischen
Paiikenbein und Jochbein liegende Kaum (k ) die Augenhöhle seyn
könne, und hält die wirkliche Augenhöhle (r-?) für einen von einem
plattenrörmigen Kimiladenknechen überdeckt g ewesenen Raum. Seitdem
es mir gelungen is t, in dem Taf. I. Fig. 2 ahgebildeten Pfero-
dnclyliis sccilop.aciceps den zur Verstärkung der Sklerotika bcstiiimit
gewe sen en Knochenring n a cliziiwcisen, kann kein Zweifel mehr
darüber s e y n , wo man die Augenhölile zu siiclicn habe. Der Ring
tr itt in der h in tersten seitlichen SchädelölTtuing, wciclic ansehnliche
G rösse und rundliche G estalt b e s itz t, au f, und es is t daher diese
Oeffnung die Aiigenhölile, wofür sie auch schon Sömmerring (B)
rich tig erk an n t h atte. Ilire Länge ergiebt 0 ,0 1 5 und die in die vordere
Hälfte fallende g rö s s te Breite oder Höhe 0 ,0 1 2 . Dicht davor
licgt eine 0 ,0 3 4 lange, gerundet dreieckige OcITiumg. die selb e, welche
Cuvier ( a b ) für die Augenhöhle, Wagier ( z z ) für einen durtli
Abfallen des Zwisclieiikiefers entslaniieaeo leeren Raum hallen. Das
in Form eines spitzen F o rtsa tz es von oben hcreiiirageiide Vorders
tirnbein schneidet von dieser Oeffnung das liinlere Sechstel oder
Siebentel a ls mittlere Oeffnung a b , die hölier a ls lang is t und von
der v o rderen oder der NasenöfTniing, die so gro s s i s t , da ss ihr
v o rd erer Winkel in die vordere Längenliälfle des Schädel limeinragt
und sie vielleicht zu Lebzeiten des Tliiers durch eine liäntige Bedeckung
eingeengt w a r , im unteren Thcil nicht knöchern getrennt
sieh ilarstellt. Die Länge des Nasenlochs v e rh ä lt sich zu der des
Schädels wie 2 : 7. Das Verkeimen der Augenhöhle konnte nicht
v erfehlen, naelilheilig au f die Deutung der sie umgebenden Knochen
zu wirken, und noch andere Irrthümer in der Deutung der Schädel-
thcilc nach sich zu ziehen.
Für die Schlüfeiigrube kann die u n te r der h interen Hälfte der
Augenhöhle liegeudc schmale Oeffiumg schon deshalb n icht ange-
sprochen werden, weil ihre Lage sich n icht dazu e ignet und sie sich
im Schädel des Rhamphorhynchns mit der oberen Schäfengrube zugleich
vorfindet. Bei einem in seitlicher Lage ziisainmeiigedrückteii
Schädel is t e s kaum möglich, offene Schläfengriibeii deutlich wahr-
z imehmen; es e rgiebt sich dies se lb st an Rhainphorhyiiciiiis. Gleichw
ohl wird in vorliegendem Pterodactylus lo n g iro stris die äu ssere
Begrenzung der Sehläfengnibe h inter der .Augenhöhle an einem dem
Ilinterstirnbein angehörigen Fo rtsa tz erk an n t, der, sch räg nach hinten
und imtcn g e ric h te t, sich mit einem Fo rtsa tz verbunden haiieii
«•ird, der wohl eh er einem Zitzenbein a ls dem seitlichen Hinterh
au p tsb ein angehöreii möchte.
.Die Grenzen der einzelnen Seliädelknochen la ssen sieh sc hwe r e rmitteln.
Der liintersehädel is t Vogel-artig gewöibt. Gleicli h inter der
ungefälircii .Milte der oberen Aiigenliöhlenbcgienzung werden Andeutungen
vo n der Oncintibt wahrgenomnieii, die durch das Ziisam-
menliegen des Hiuiptsfirnbcins mit dem langen Fo rtsa tz des Zwischenkiefers
v e ra n la s s t wird.
Das Hniiplstirnbein bildet wie im Vogel die schöne liin terwärts
gehende M'ölbung, die Oken (n ) für das Scheitelbein hält, aus dessen
Siciiikeru e r auf ein Geliirn mit zwe i llumisphären sch lie sst.
Wagler bezeichnet diese Gegend («) als Hinterhauptsbein. Dahinter
liegt das paarige Sch e itelb ein , Okcn's (o ) Ilinterliaiiptsbeiii, und
aiissen oder iiielir seitlich d.as Schläfenbein.
Des Hiiilerstinibcins wurde bereits gedacht. Goldfuss (k ) und
Wagner deuten diesen Theil eben s o , Okcii (p) bezeichnet ihn als
Aiigciibraimcnbciii, Waglcr (f) als Scliiäfeiibein.
Das Jochbein is t nicht zu vc rk em ien ; Cuvicr (c . g) hielt es, da
e r die Aiigeiiliöliie ve rk an n te, für das Flü gelbe in; Oken (q. r) liat es
gcIroiTcn. Es bildet die un te re nder ä u ssere Begrenzung der Aiigen-
höhlc lind nucli den g rö sste n Theil ilirer v o rderen Begreiizimg durch
einen s ta rk en , spitz aiislaiifciulen F o rts a tz , den Wagner vom Jocli-
beiti tr e n n t , indem er ihn für das Thränenbein h ä lt, das sich in-
desa von oben iiornb mit diesem Jochbeiiifortsatz v e rb in d e t, wobei
es zugleich einen Thcil vom oberen Augciihühlcnrand bildet. Nach
Wagler («) ist d ieser Forl.satz das Siebbein, nacli Cuvier ( b ), der
die Augenhöhle davor, s ta tt daliinter annimmt, ein Fnrtsatz des Hinler-
slirnbeins. Vorn g eh t das Jochbein in einen langen dünnen Fortsatz
an s, der die untere Begrenzung der mittleren Oeffiuing und der Nascn-
ölTiiuiig bilden hilft, und an den .sich der liinterc Fortsatz des Oberkiefers
anlegt, der erst in der Gegend der m ittleren üelftuing zu endigen scheint.
Cuvicr halt wenigstens die hintere Gegend (d) des hinterw
ä rts sich seh r verlängernden Zwisoheiikiefers für das Stirnbein,
üken (m) ebenfalls für die langen Stirn b ein e ; nacli Goldfuss (b)
s te llt d ieser Fortsatz entweder die Nasenbeine oder den Zwischenkiefer
d a r; Wagler (ii-v ) erkennt ihn für den so weil ziirückführcn-
den Zwiseheiikiefer an. Den Knochen mit dem vorderen Nasenlochwinke!
glaubt Okeii für eine Nasenscheidewand netimeo zu sollen,
die e r dein Pfliigscharbein beilegt. Dieser seh r dünne Knochen ist
aber ein ä u sserer Seliädelknochen und gehört entweder zum Zwi-
sclieiikiefcr oder Oberkiefer; die Pterodactyin b e sassen keine knöcherne
Nasenscheidewand (S. 1 6 ) .
Das Paukenbein, ein längerer Knochen, liegt in der Gegend der
Aiigcnhöiile unter dem Joclibogen, mit dem cs eine schmale Ocifnung
b e sch reib t, dieselbe, welche Waglcr («J für die Augenhöhle gelial-
te ii, wobei er das Jochbein (<) a ls oberen Augenhöhlenrand und
das Paiikenbein ( J ) als einen die Augenhöhle unten begrenzenden
Joclibeinforlsatz deutele. Dieser Kn o ch en , den schon CuOier (Z)
und Oken (t) als Qiiadratbein b ezeiclmeten, und Wagner, ehe er
dieser Ansicht beipiliehtete, für das zertrümmerte Jochbein hielt, liegt
nicht wie Wagler g lau b te, mit seiner vorderen Spitze dem Unlcr-
kicfer au f, sondern greift wirklich in dessen Gclenkgriibe e in , die
Stelle der Einlenkimg bezeichnend, die Wagler viel w eiter hinten
su c h te , weshalb er auch b e h au p te te, keine Spur von einem Qua-
dralknoehcn waiirgcnoiiiinen zu h ab en ; er verlegte dabei den Ge-
lenkfortsalz des Unterkiefers ans hintere Sehädelendc ( h ) , und auch
Wagner hielt wen ig sten s anfangs dies für die natürliche Lage und
die Stelle der Verbindung mit dem (Juadratbcin.
DcrUuterkiefer nimmt zum Schädel noch seine natürliche Lage ein.
Cuvier h atte dies anfangs richtig vermuthet, und es is t daher unbegreiflich,
wie er sp ä ter wieder davon abkommen und der Ansiclit
werden k o n n te , dass die Stelle der Einleiikung weiter hinten liegen
uiiisse. Die Einlenkiing fällt in die Gegend der vorderen Hälfte der
.Augenhöhle. Auch Wagler h a tte eine ganz irrige Vorstellung; er
v e rlegt diese Stelle fa s t h inter die Aiigenliölile, und g la u b t, dass
sieh nur zwei Drittel von der Unterkieferlänge e rh a lte n , während
sie doch vollständig vorliegl. Für diese Länge erhält man mit dem
kurzen hinteren Fo rtsa tz 0 ,0 9 3 , wovon au f die breitere vordere
Strecke, welche die Sympliysis bezeichnen wird, 0,041 kommt. Die
mittlere Höhe eines A ste s m is st 0 ,0 0 3 , die Höhe unmittelbar v o r
der Einlenkimg 0 ,0 0 4 . Der hintere Fo rtsa tz fällt san ft ab. Der Unterkiefer
besitzt eine mehr leistenforinigc Gestalt und wird in der
vordern Strecke e tw as s tä rk e r, auch angenommen, dass durch Quet-
sehimg von der rechten Hälfte e tw a s sichtbar w ä re ; vo rn spitzt er
sich au fw ärts gerundet zu. Von einem Lo clic, welches Oken (k)
hinten im Unterkiefer bemerkt haben w ill, und worin er eine Aehn-
lichkeit mit dem Unterkiefer der Schlangen findet, habe ich nichts
wahriielimen können; w a s er dafür liält, scheint nur eine e tw a s eingedrückte
oder vertiefte Stelle zu seyn. In der hinteren Gegend d es oberen
Randes glaubt man Atiileiitutigen von der durch das .Mondhein v e r-
an lass tcn langen schmalen Leiste wahrznnehnieii.
Die g latten, spitzkonischen, unmerklich h in te rwä rts gebogenen
Zähne sind in den Kieferknochen eingekeilt und über dem Alveolar-
Rande kauiii wahrnehmbar eingesclinürt. Die g rö ssten Zähne treten
am vorderen Ende auf. Die Zähne bewaffneten oben wie unten uü-
gefälir das v o rd ere Drittel der Kicferlänge, bestehen aber je tz t
g rössten th eils nur in Wnrzeireslen oder Abdrücken, weshalb es
auch sc hwe r fällt, ihre Zahl richtig zn ermitteln. Goldfuss giebt
I I : 1 1 - 2 2
zwa r für das Zabn.systcm folgende Formel: ^ a n , die
indess nur auf den v o r ihm bestandenen schwankenden Angaben
b eruht. Sömmerring nimmt auf jed er Seite oben I I , iinten I9Z äh n e
a n , w a s zusaiuinen 60 w ä ren : Oken legt dem Oberkiefer melir als
2 2 . dem Unterkiefer 34 , 17 der rechten Hälfte, b e i, und Wagler ist
der A n sic h t, da ss jed e Unlerkieferhälfte w en ig sten s 30 Zähne enthalten
habe. Cuvier (o s s . fo ss.. 4 ed. X. p. 2 2 7 . 2 3 2 ) glaubte,
(lass die ju ngen Zähne, wie in g ewissen L.acerten, aus einer OelT