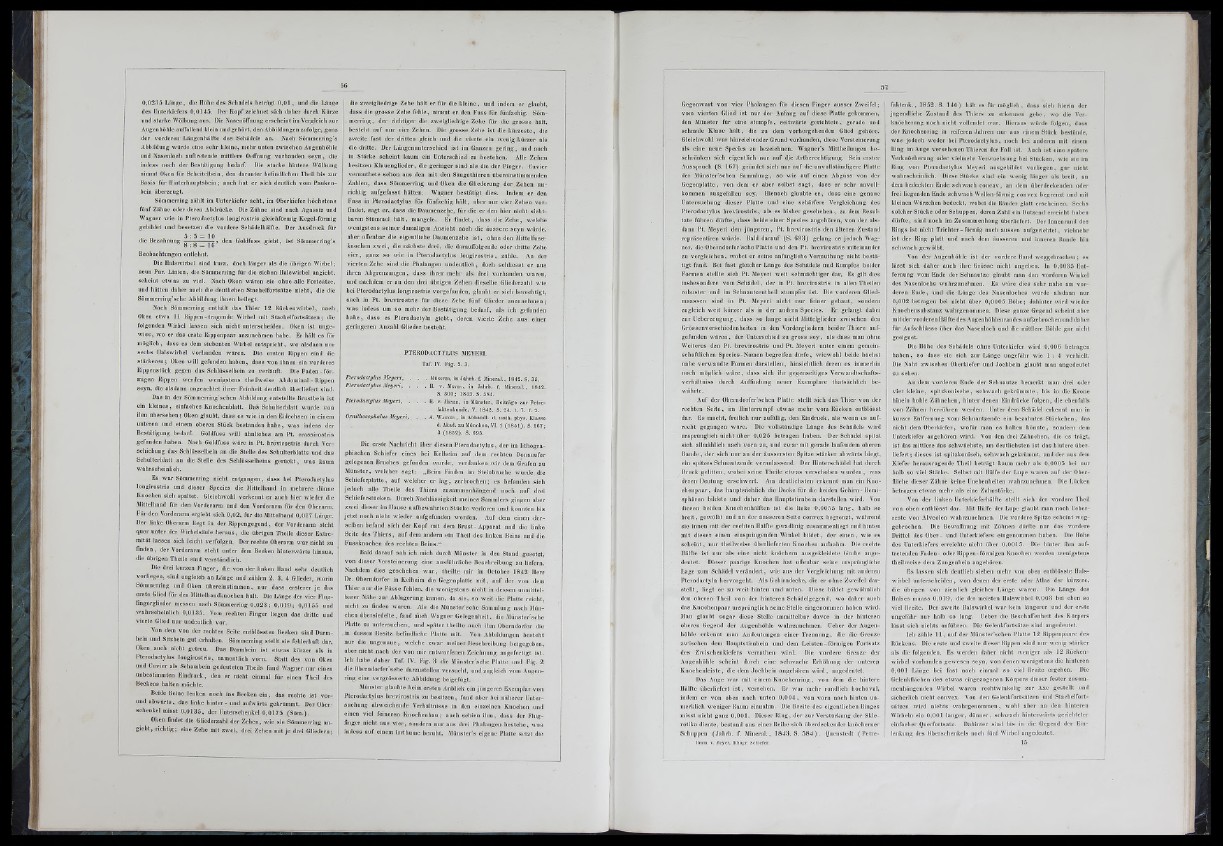
0.023r. Länge, die lliilie des Schädels belriigl O.OI , uiul die Länge
dos Unterkiefers 0 ,0 1 4 5 . Der Kopf zeicliiiut sich daher durch Kürze
und sta rk e Wölbung atis. Die Nasenöffnung erscheint im Vergleich zur
Aiigenhölile iHiffallend klein und gehört, den Abbiidiingen zufolge, ganz
der vorderen Längenliälfle des Schädels an. Nach Sömmerring’s
Abbildung würde eine s e h r kleine, mehr initeu zwischen Angenhölile
und Nasenloch luiflretende mittlere Oeffnung vorhanden s e y n , die
indess noch der Bestätigung bedarf. Die sta rk e hintere Wölbung
nimmt Oken für Scheitelbein, den darunter befindlichen Theil bis zur
Basis für Hinlci'hau|itsbcin; auch hat er sich deutlich vom Paiikeii-
bein überzeugt.
Sömmerring zählt im Unterkiefer a ch t, im Oberkiefer höchstens
fünf Z ähne oder deren .Abdrücke. Die Zähne sind nach Agnssiz und
Wagner wie in Ptcrodactyliis longirostris gleichförmig Kegel-förmig
gebildet und besetzen die vordere Schädelhälfle. Der Ausdruck für
die Bezahnung - — den Goldfuss g ie b t, is t Sömmerring’s
9 i o = Io
Beobachtungen entlehnt.
Die Halswirbel sind ku rz, doch länger als die übrigen Wirbel;
neun Par. Linien, die Sömmerring für die sieben Halswirbel angiebt.
scheint e tw as zu viel. Nach Oken wären sie ohne alle Fortsätze,
und hätten daher auch die deutlichen Stachelfortsätze n ic h t, die die
Sömmerriiig'sche .Abbildung ihnen beilegt.
Nach Sömmerring enthält das Thier 12 Riickenwirbel, nach
Oken e twa 11 Rippen - tragende Wirbel mit Stach elfo rtsä tzen ; die
folgenden Wirbel lassen sich nicht unterscheiden. Üken is t ungew
is s , wo er das e rste Rippenpnar anzunehinen habe. Er hält es für
möglich, dass es dem siebenten Wirbel e n tsp rieiil, wo alsdann nur
se ch s Halswirbel vorhanden wären. Die e isten Kippen sind die
stä rk e ren ; üken will gefunden h ab en , dass vo n ihnen ein v o rd eres
Kippeiisliick gegen das Schlüsselbein zu verläuft. Die Faden - förmigen
Rippen werden wenigstens theilweise Abdominal - Rippen
sey n , die alsdann ungeachtet ih rer Feinheit deutlich überliefert sind.
Das in der Sömmerring'schen Abbildung e n tste llte Brustbein ist
ein kle in es , einfaches Knochenblatt. Das Schulterblatt wurde von
ihm ü b e rsehen; Oken glaubt, da ss e s wie in den Eidechsen in einem
unteren und einem oberen Stück bestanden h a b e , w a s indess der
Bestätigung bedarf. Goldfuss will ähnliches am Pt. era ssiro stris
gefunden haben. Nach Goldfuss wäre in Pt. brev iro stris durch Verschiebung
das Schlüsselbein an die Stelle des Schulterblatts und das
Schiillerblatl an die Stelle des Schlüsselbeins g e rü c k t, w a s kaum
wahrscheinlich.
Es w a r Sömmerring nicht en tg an g en , d a ss bei Pterodactylus
longirostris und dieser Species die .Mittelhand in mehrere dünne
Knochen sich spaltet. Gleichwohl v e rkennt e r auch hier w ieder die
.Mittelhand für den Vorderarm und den Vorderarm für den Oberarm.
Für den Vorderarm ergiebt sich 0 ,0 2 , für die Miltelhand 0 ,0 1 7 Länge.
Der linke Oberarm liegt in der Kippengegend, der Vorderarm ste h t
quer unter der Wirbelsäule h e ra u s , die übrigen Theile d ieser Extremität
lassen sich leicht verfolgen. Der rechte Oberarm w a r nicht zu
finden, der Vorderarm ste h t unter dem Becken hin te rwä rts hinaus,
die übrigen Theile sind verständlich.
Die drei kiuzen F in g er, die vo n der linken Hand seh r deullich
vorliegen, sind ungleich an Länge und zählen 2. 3. 4 Glieder, worin
Sömmening und Oken übereinstimraen, nur dass e rs te re r je das
e rste Glied für den Mittelliandknochen hält. Die Länge der v ie r Fhig-
fingerglieder messen naeh Sömmerring 0 ,0 2 3 ; 0 ,0 1 9 ; 0 ,0 1 5 5 und
wahrscheinlich 0 ,0 1 3 5 . Vom rechti
a Finger liegen das d ritte und
vierte Glied mir iiiideiillich vor.
Von dem von der rechten Seife entblössten Becken sind Uarm-
bein und Sitzbein gut erhalten. Sömmerring ste llt sie fehlerhaft dar,
Oken auch nicht getreu. Das Darmbein is t e tw a s kürzer a ls in
Pterodactylus long iro stris, namentlich vorn. S ta tt des von Oken
und Cuvier als Schambein gedeuteten Theils fand Wagner nur einen
nubestimmten Eindruck, den er niclit einmal für einen Theil des
Beckens halten möchte.
Beide Beine lenken noch ins Becken e in , das rechte is t vor-
iind a bw ä rts , das linke h in te r- und a u fwärts gekrümmt. Der Oberschenkel
misst 0 ,0 1 3 5 , der Unterschenkel 0 ,0 1 7 5 (Söm.).
üken findet die Gliederzahl der Zehen, wie sie Sömmerring ang
ie b t, rich tig ; eine Zehe mit zw e i, drei Zehen mit je drei Gliedern;
die zweigliedrige Zehe hält er für die kle in e, und indem er glaubt,
dass die g ro sse Zehe fehle, nimmt er den Fuss für fünfzehig. Söm-
. merriiig, der richtiger die zweigliedrige Zelie für die g ro s s e liäit,
besteht auf nur v ie r Zehen. Die g ro s s e Zehe is t die k ü rz e s te , die
zweite fa s t der dritten gleich nnd die v ie rte ein wenig kürzer als
die dritte. Der Löngeiuiiitcrscliied is t im Ganzen g e rin g , und auch
in Stärke sch ein t kaum ein Unterschied zu bestehen. Alle Zehen
besitzen Kiauenglieder, die geringer sind a ls die der Finger. Cuvier
vermnthete schon luis den mit den Säugethieren übereinstimmenden
Zah len , d a ss Söuimerritig nnd Oken die Gliederung der Zehen uii-
richlig aufgefasst hätten. Wagner b e stätig t dies. Indem er den
Fnss in Pterodactylus für fünfzehig liä ll, aber nur v ie r Zehen v o rfiiidet,
sag t er, d a ss die Daumenzehe, für die e r den hiev niclit sich tbaren
Stümmel h ä lt, mangele. E'r findet, d a ss die Z e h e , welche
wen ig sten s se in er damaligen Ansicht nach die ä u ssere sey n würde,
aber offenbar die eigentliche Daiimenzche i s t , ohne den .Mitlelfuss-
knocheu zw e i, die nä ch ste d rei, die darauffolgeiidc oder dritte Zehe
v ie r, g anz so wie in Pterodac tylus lo n g iro s tris , zähle. An der
vierteu Zehe sind die Phalangen n iidentlich, doch sc h lie s s t er aus
ihren Abg renzungen, dass ih rer mehr als drei vorhanden waren,
und nachdem er an den drei übrigen Zehen dieselbe Gliederzalii wie
bei Pterodactylus lo n g iro stris vorgefuiiden, glaubt er sich berechtigt,
auch in Pt. b rev iro stris für diese Zehe fünf Glieder anzniiehmen;
w a s indess nm so mehr der Bestätigung bed arf, a ls ich gefunden
h a b e , da ss es Pterodactyin g ie b t, deren v ie rte Zelie au s einer
geringeren .Anzahl Glieder besteht.
PTERODACTYLUS MEYERI.
Taf. IV. Fig. 2. 3.
Pierodactylus Kleyei-i, . . . Huxsier, i» Jahrb. f. Mineral., 1842. S. 35.
Pterodactylus Meyeri, . . . 11. v. Mkves, in Jalirb. f. Mineral., 1842.
S. 303; 1843. S. 584.
Pterodaclylus Meyeri, . . .H . v. Mever, in Münster, Beiträge zur Pctrofaktenkuude,
V. 1842. S. 24. t. 7. f. 2.
Ornithocephalus Meyeri, . . A. Wagxer , in Abhandl. .1. matli. phys. Klasse
d.Akad. zu .München, VI. 1 (1861). S. !67;
3 (1852), S. 693.
Die e rs te Nachricht über diesen P te ro d a c ty lu s , der im lilliogra-
phischcn Schiefer eines bei Kelheim auf dem rechten üoiiauufer
gelegenen Bruches gefunden w u rd e , verdanken wir dem Grafen zu
.Münster, welcher s a g t; „Beim Finden im Steinbruehe wurde die
Schiefcrplatte, a u f welcher e r la g , z e rb ro ch en ; es befanden sich
jed o ch aljc Theile des Thiers zusammenhängend noch a u f drei
Schieferstüekcn. Durch Nachlässigkeit meines Sammlers gingen aber
zwei d ieser im Hause au fb ewaliilen Stücke verloren und konnten bis
je tz t noch nicht w ieder aiifgefunden werden. Anf dem einen derselben
befand sich der Kopf mit dem Brust - Apparat und die linke
Seite des T h ie rs , a u f dem ändern ein Theil des linken Beins und die
Fussknochen des rechien Beins.“
Bald da rau f s ah ich mich durch Münster in den Stand g e setz t,
von d ieser Versteinerung eine ausführliche Besclireibung zu liefern.
Nachdem dies geschehen w a r , theilte mir im October 1 842 Herr
Dr. Oberndorfer in Kelheim die Gcgciipliittc m it, a u f der von dem
Thier nur die Füsse fehlen, die w en ig sten s nicht in dessen iiiimitlel-
barcr Nähe zur Ablagerung kamen, da s ie , so weit die Platte reicht,
nicht zu finden waren. Als die Münater'sche Sammlung nach München
übcrsieilelte, fand auch Wagner Gelegenheit, die .Müiistcr’sclic
Platte zu imlersu ch en , und sp ä ter theilte auch ihm Oberndorfer die
in dessen Besitz befindliche Platte mit. Von Abbildimgcn b e steht
nu r die un g en au e , welche zwa r meiner Beschreibung bcigegcbcii,
aber nicht nach der vo n mir entworfenen Zeicimting an g efertigt ist.
Ich habe daher Taf. IV. Fig. .3 die Miinsler’sch e l’lalte und Fig. 2
die Oberndoi-fer'sche darznstellen v e rsucht, und zugleich vom Aiigcii-
ring eine v c rg rö s s e rte Abhilduiig beigefügt.
Münster glaubte beim e rsten Anblick ein jü n g e re s Exemplar von
Pterodactylus brev iro stris zu b e sitz en , fand aber bei näiiurcr Uiiter-
siichimg abweichende Verhältnisse in den einzelnen Knochen und
einen viel feineren Knochenbau; auch schien ilim, da ss der Ehig-
iinger nicht aus v ie r, sondern nur aus drei Phalangen b e steh e , was
indess a u f einem Irrlhimie beruht. Munster’s eigene Platte se tzt die
Gegenwart v on v ie r Phalangen für diesen Finger au sser Zweifel ;
vom v ierten Glied is t nur der Anfang a u f diese Platte gekommen,
den Münster für eine stum p fe , se itw ä rts g e ric litete , gerade und
schmale Klaue h ä lt, die zu dem vorliergelienden Glied gehöre.
Gleichwohl w a r hinreichender Grund vorhanden, diese Versteinerung
als eine neue Species zu bezeichnen. Wagner’s Mitlliciluiigen beschranken
sich eigentlich mir auf die Artburechtigung. Sein e rster
Ausspnich (S. 16 7 ) gviiiidet sich n u r a u f die unvollständigere Pliitie
der -Miinster’schcn Sammlung, so wie au f einen Abguss von der
Gegenpiatte, vo n dem er aber se lb st s a g t, dass er seh r unvoll-
koiniiien ansgel'alleu sey. Hienach glaubte e r , d a ss eine genaue
Untersuchung d ieser Platte und eine schärfere Vergleichung des
P terodactylus h re v iro s tr is , als es bisher g e sch e h en , zn dem Resulta
te fnlireu dü rfte, da ss beide einer Species angehören, vo n der alsdann
Pt. .Meyeri den jü n g e re n , Pl. brev iro stris den älteren Zustand
rcpräsenliren würde. Bald da rau f (S. 6 9 3 ) gelang cs jedoch Wagn
er, die Ubcrndorfer'sche Platle nnd den Pt. b rev iro stris miteinander
zu v e rg le ich en , wobei er seine anfängliche Vermuthung nicht bestätig
t fand. Bei fast gleicher Länge des Schädels nnd Kumpfes beider
Formen stellte sich Pt. .Meyeri weit schmächtiger dnr. Es gilt dies
insbesondere vom Schädel, der in Pl. b rev iro stris in allen Theilen
ro b u ste r und im Schnautzenlhcil stumpfer ist. Die vorderen Gliedm
a ass en sind in Pt. .Meyeri nicht nur feiner g e b au t, soiideiii
ziiffleieii weit kürzer als in dev ändern Species. Er gelangt dabei
zur ü eb erzen g iin g , d a ss so lange nicht Mittelglieder zwischen den
Giösscnverscliiedeniieiten iu den Vordcrgliedcrn beider Thiere aufgefunden
w ä r e n , der Unterschied zu g ro s s s e y , als da ss man oline
AVeitercs den Pt. b rev iro stris und Pt. .Meyeri u n te r einem gemeiii-
scliaftlichon Species-Namcn begreifen dü rfe , wiewo h l beide höchst
nahe v e rw an d te Formen d n rste lieii, hinsichtlich deren es imnierhiii
noch möglich w ä r e , d a ss sich ihr gegenseitiges Verwandtschafls-
v e rliältn iss durch Auffindung neuer Exemplare thatsäciilich bewährte.
Auf der Oberndorfer’schen Pl.atle ste llt sich das Thier von der
rechten S e ite , im Hinlerriimpf e tw a s mehr vom Rücken cn tblösst
d ar. Es macht, freilich nur zufällig, den Eindruck, als wenn es aufrech
t gegangen wäre. Die vollständige Länge des Schädels wird
ursprünglich nicht über ü ,0 2 5 betragen haben. Der Schädel spitzt
sich allmählich nach v o rn zu, «nd zwa r mit gerade laufendem oberen
R an d e, der sich nur an der äu sserslen Spitze s tä rk e r a bw ä rts biegt,
ein sp itzes Schnautzende ve ran las sen d . Der liintersehädel hat durch
Druck ge litten , wobei seine Theile e tw as verschoben w u rd e n , was
deren Deulmig e rs c hw e rt. Am deutlichsten erkennt man ein Kiio-
c h e n p a a r, das haiiplsächlicli die Decke für die beiden Gehirn - Ilemi-
splnlren bildete nnd daher das Haiiptstirnbein darstellen wird. Von
d iesen beiden Kiiochcnliälftcn is t die linke 0 ,0 0 5 5 la n g , halb so
b r e it, gewölbt und an der ä u sseren Seite convex b egrenzt, wähvcnil
sie inneii mit der rechten Hälfte geradlinig ziisammcnliegt und hinten
mit d ieser einen uinspiingenden Winkel b ildet, der ein en , wie es
s c h e in t, n u r theilweise (iberlicferteii Knciclien anfnalim. Die rechte
Hälfte is t nur a ls eine nicht knöchern aiisgekleidele Grube ange-
dciitel. Dieser paarige Knocheu hat offeuhar seine ursprüngliche
Lage zum Schädel v e rä n d e rt, wie ans der Vcrglcicliiing mit anderen
Pterodactyin Iiervorgeht. Als Gehii ndecke, die er oline Zweifel dars
te llt, liegt er zu weit hinten und iiiilcn. Diese bildet gewöhnlich
den oberen Tlieil von der h interen Schädelgegend, wo daher auch
das Kiioclicnpaar ursprünglich seine Stelle eingenommen haben wird.
Man glaubt so g a r diese Stelle miiiiittolbar d avor in der hinteren
oberen Gegend der Augeiiliöhle wahrziiiiehiiien. Ueber der Augcn-
hühle erkennt man .Andeufiingeu einer Tren n u n g , die die Grenze
zwisehen deni Ilaiiplsliriibein und dem Leisten -fö rm ig en Fortsatz
des Zwisclieiikiefers v e rrath en wird. Die v o rdere Grenze der
.Angeiiliühlc scheint durch eine sclnvaclic Erhöhung der unteren
Kiiochcnleiste, die dem Jochbein nngehoren w ird , angedentet.
Das .Auge w a r mit einem Kn o clien n u g , von dem die hintere
Ilälfle überliefert is t , v ersehen. Er w a r mehr rundlich liochnval,
indem er von oben nach unten 0 .0 0 4 , von vorn niich hinten un-
merklich weniger Ranni cimialim. Die Breite des eigentlichen Ringes
mis st nichl ganz 0 ,0 0 1 . Dieser Ring, der zur Verstärkung der Sklerotika
diente, besfani! aus einer Reihe sich überdeckender kinicherncr
Schuppen (J.ahrb. f. Mineral., 1843. S. 5 8 4 ) . Quenstedl (P e lre -
llunii. V. Ak.yor, lllhosr Soliicfcr.
fakteiik., 1852. S. 1 4 0 ) hält es für möglich, d a ss sich hierin der
jugendliche Zustand des Tbier.s zu erkennen g e b e , wo die Verknöcherung
noch nicht vollendet war. Hieraus würde folgen, dass
der Kiiochenring in reiferen Jah ren nur ans einem Stück bestünde,
wa s jedoch weder bei Ptero d ac ly lu s, noch bei anderen mit einem
King im Auge versehenen Thieren der Fall ist. Auch is t eine spätere
Verknöcherung oder vielmehr Verwachsung bei Stücken, wie sie im
Ring von Pterodactylus Meyeri ausgebildel vo rlieg en , g a r nicht
wahrscheinlich. Diese Stücke sind ein wenig länger als b re it, an
dem bedeeklcn Ende schwach con cav , an dem überdeckenden oder
frei liegenden Ende sclnvacli Wcllen-förniig convex begrenzt und mit
kleinen Wärzchen bedeckt, wobei die Ränder gla tt erscheinen. Sechs
solcher Stücke oder Schuppen, deren Zahl ein Dutzend erreicht haben
d ürfte, sind noch im Zusammenhang überliefert. Der Innenrand des
Rings is t nicht T rich te r-fö rm ig nach anssen au fg e rich te t, vielmehr
is t der Ring platt und nach dem äusseren und inneren Rande hin
schwa ch gewölbt.
Von der .Augenhöhle is t der vordere Rand weggebrochen; es
lä sst sich dah er auch ihre Grösse nicht angehen. ln 0,0 0 3 5 Entfernung
vom Ende der Sehnautze glaubt man den vorderen Winkel
des Nasenlochs wahrzunelimen. Es wäre dies seh r nahe am v o rderen
E n d e, und die Länge des Nasenloches würde alsdann mir
0 ,0 0 2 helragcn bei nicht über 0 ,0 0 0 5 Höhe; dahinter « ’ird wieder
Knocheiisubslanz wahrgenommen. Diese ganze Gegend scheint aber
mit der vorderen lläifte des .AiigcnhöhlenrniKics anfgebrochen und daher
für Aufschlüsse über das Nasenloch und die mittlere Höhle g a r niclit
geeignet.
Die Höhe des Schädels ohne Unterkiefer wird 0 ,0 0 6 betragen
h a b en , so dass sie sich zur Länge ungefähr wie I : 4 verhielt.
Die Naht zwischen Oberkiefer und Jochbein glaubt man angedeutet
zn sehen,
An dem vorderen Ende der Sehnautze bemerkt man drei oder
vier k le in e, sp ilzk o n isc h e , schwa ch gek rümm te , bis in die Krone
hinein hohle Zähnchen, h inter denen Eindrücke folgen, die ebenfalls
von Zahnen herrühren werden. Unter dem Schädel erkennt man in
kurzer Entfermiiig vom Schnautzende ein bezahntes Stückchen, das
nicht dem Oberkiefer, wofür man es hallen k ö n n te , sondern dem
Unterkiefer angehören wird. Von den drei Zähnchen, die es trägt,
is t das mittlere das schwä ch s te, am deutlichsten ist das hintere überliefert;
d ieses is t spilzkonisch, sclnvach gekrümmt, und der aus dum
Kiefer hevaiisragende Theil beträgt kaum mehr als 0 ,0 0 0 5 hei nur
halb 80 viel Stärke. Selbst mit Hülfe der Lupe w aren auf der Oberfläche
d ieser Zähne keine Unebenheiten wahrzunelimen. Die Lücken
betragen e tw a s mehr als eine Zahnstärke.
Von der linken Unterkiefcrliälfle ste llt sich der vordere Theil
von oben en iblösst dar. Mit Httlfe der Lupe glaubt man noch Ueberreste
vo n Alveolen walirzimchnien. Die vordere Spitze scheint weg-
gebrochcii. Die Bewaffnung mit Zähnen dürfte nur das vordere
Drittel des Ober- und Unterkiefers eingenommen haben. Die Höhe
des Unterkiefers erreichte nicht über 0 ,0 0 1 5 . Die hinter ihm .auftretenden
Faden- oder Rippen-förmigen Knochen werden wenigstens
theilweise dem Ziingenbcin aiigchörcn.
Es lassen sich deutlich sieben mehr von oben entblösste Halswirbel
u iiferseheideii, von denen der e rste oder Alias der kürzere,
die übrigen von ziemlich gleicher Länge waren. Die Länge des
Halses in.aass 0 ,0 1 9 , die der meisten Halswirbel 0 ,0 0 3 bei eben so
viel Breite. Der zweite Halswirbel war kein längerer und der e rste
ungefähr nur halb so lang. Ueber die Beschaffenheit des Körpers
lä s s t sich nichts aiifflhven. Die Gelenkfortsätze sind angedeulel.
Ich zähle 1 1 , auf der Münsler'schen Platte 12 Rippenpaare des
Kückens. Die e rste und zweite dieser Rippen sind nur wenig stärker
als die folgenden. Es werden daher nicht weniger als 12 Rückenwirbel
vorhanden gewe sen sey n , von denen wenigstens die hinteren
0 ,001 Länge bei fast noch einmal so viel Breite ergeben. Die
GelenkHäcIieti des e tw as eingezogenen Körpers dieser fester zusammenhängenden
AA'irbel waren rechtwinkelis zur .Axe g e stellt und
sicherlich nicht convex. Von den Gclenkforlsätzen und Stachelfort-
snlzcn wird nichts wahrgenommen, wohl aber an den hinteren
Wirbeln ein 0.001 la n g er, dü nn e r, schwa ch hin te rwä rts gerichteter
dnfac lie r Querfortsalz. Daiiinler sind bis in die Gegend der Eiii-
Icnkung des Oberschenkels noch fünf Wirbel angedentet.
15