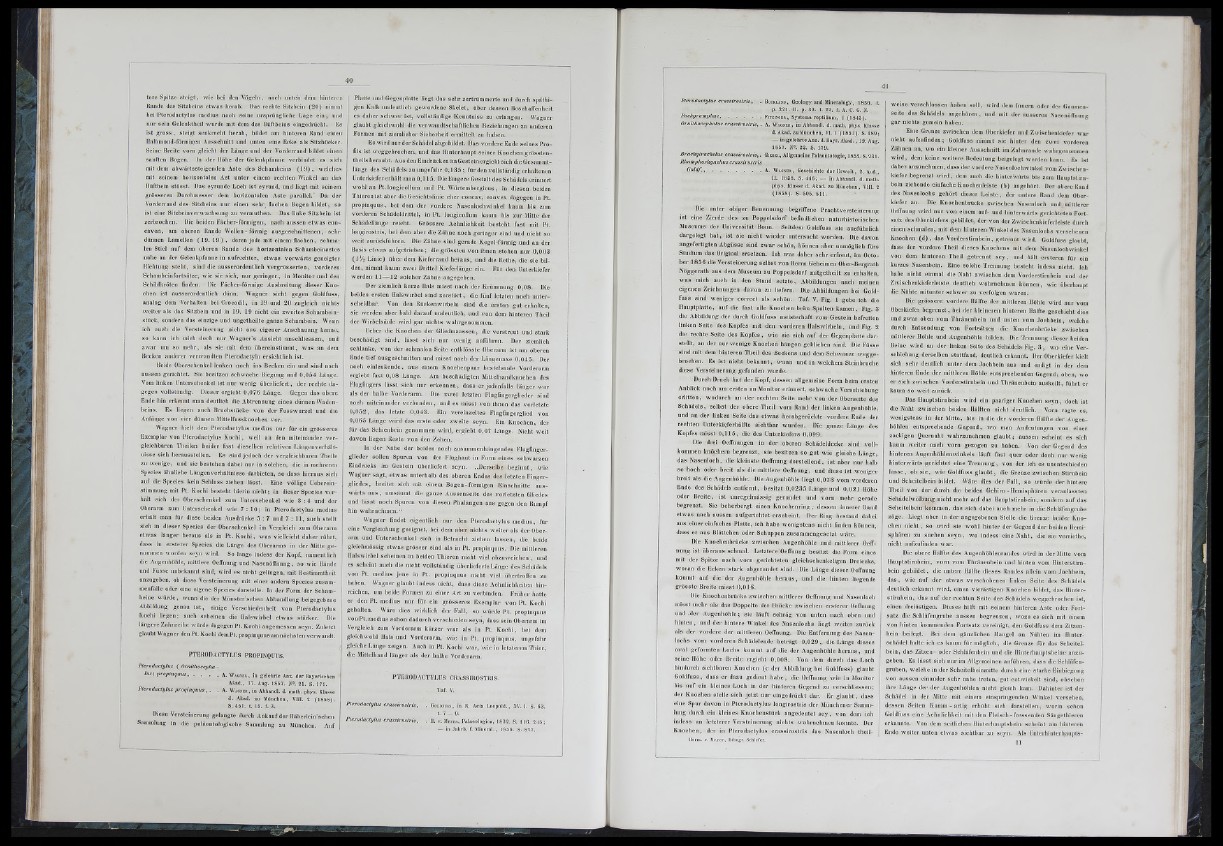
Icrc Spitze siL-igt, wie bei den Vögeln, nach unten dem liinleieii
Rande des Sitzbeins e tw as hcrah. Uns rechte Sitzbein (2 0 ) niiiiiut
bei Pterodnctylns medius noch seine ursprilngliche Lage e in , nud
nur sein Gcleiiktlicil wurde mit dem des llnftbeins eingedrückt. Es
g ro s s , steigt seiikreclif h e rab , bildet i
Ibmond-förmigcn Ausschnitt und iiiilen e
I hinteren Rand einen
e Ecke a ls Sitzhöcker.
Seine Rreile vorn gleicht der Länge und der Vorderrand bildet einen
siinftcn Bogen, ln der Hübe der Gciciikplänne verbindet es sich
mit dem abwärtssleigeiiden Aste des Schambeins ( 1 9 ) , welche.«
mit seinem liorizonlalen .\ s t unter einem rechten Winkel an das
llüflbcin stö ss t. Das cyrunde Loch is t eyrnnd, und liegt mit seinem
grösseren Otirclimesscr dem horizontalen Aste parallel. Da der
Vorderrand des Sitzbeins nur einen sehr, flachen Bogen bildet, so
ist eine Sitzbeiiiverwachsuiig zu vermuthen. Das linke Sitzbein ist
zerbrochen. Die beiden Fächer-förmigcn, nach aussen e tw as concav
en , am oberen Rande Wellen - förmig au sg esch n itten en , seh r
dünnen Lamellen (1 9 . iO ) , deren jede mit einem flachen, schma len
Stiel auf dem oberen Rande des horizontalen Schambeinnstes
nahe an der Gelenkpfanne in aufrechter, e tw a s v o rw ä rts geneigter
Richtung s te h t, sind die ausserordentlich v e rg rö s s e rie n , vorderen
Sehambciiiforlsätze, wie sie sieh, nur g e rin g e r, in .Monitor und den
Schildkröten finden. Die Fächer-förmige Ausbreitung d ieser Knochen
is t ausserordentlich dünn. Wagner sieh t gegen Goldfuss,
analog dem Verhalten bei Crocodil, in 19 und 2 0 zugleich nichts
weiter als das Sitzbein nnd in 19. 19 nicht ein zwe ite s Schanibeinstück,
sondern das einzige und ungetheilte ganze Schambein. Wenn
ich auch die Versteinerung nicht aus eigener .Viischauiiug kenne,
so kann ich mich doch nur Wagner’s Ansicht a n sch liessen , und
zwa r um so mehr, als sie mit dem übereinstimmt, was an dem
Becken anderer ve rwandten Pterodactyin ersichtlich ist.
Beide Oberschenkel lenken noch ins Becken ein und sind nach
anssen gerichtet. Sie besitzen schwache Biegung und 0 ,0 5 4 Länge.
Vom linken Uniersclienkel is t nur wenig ü b e rliefert, der rechte dagegen
vollständig. Dieser ergiebt 0 ,0 7 6 Länge. Gegen das obere
Ende hin erkennt man deutlich die Abtrennung eines dünnen Wadenbeins.
Es liegen auch Bruchstücke vo n der Fusswurzel und die
Anfänge von vier dünnen Mitteifussknoehen vor.
Wagner hielt den Pterod.iclylus medius nur für ein g rö ssere s
Exemplar von Pterodactylus Ko ch i, weil an den miteinander vergleichbaren
Theilen beider fast dieselben relativen Läiigenvcrhält-
nisse sich hcrausstcllen. Es sind jedoch der vergleichbaren Theile
zu «’eilige, und sie bestehen dabei nur in solchen, die in mehreren
Species ähnliche Längenverhältuisse darbicten, so d a ss hieraus sich
a u f die Species kein Schluss ziehcu lä sst. Eine völlige Uebereinstimmung
mit Pl, Kochi b e steht hierin n ic h t; in dieser Species v e rhält
sich der Oberschenkel zum Unterschenkel wie 3 : 4 und der
Oberarm zum Unterschenkel wie 7 : 1 0 ; in Pterodactylus medius
erhält man für diese beiden .Ausdrücke 5 : 7 und 7 ; 11, auch stellt
sich in dieser Species der Oberschenkel im Vergleich zum Oberarm
e tw as länger heraus als in Pt. Ko ch i, w a s vielleicht daher rührt,
dass in er.sterer Species die Länge des Oberarms in der Mitte g e nommen
worden seyn wird. So lauge indess der Kopf, namentlich
die Augenhöhle, mittlere Oefl'nimg und NasenöfTniing, so wie liäiide
nnd Füsse unbekannt sind, wird es nichl gelingen, mit Bestimmtheit
anzugeben, ob diese Versteinerung mit einer ändern Species Zusammenfalle
oder eine eigene Species darslelle. In der Form der Schambeine
w ü rd e , wenn die der Münster’schen Abhandlung beigegebenc
Abbildung genau i s t , einige Verseliiedeuheit von Pterodactylus
Koclii liegen; auch scheinen die Halswirbel e tw as stä rk er. Die
längere Zaiinreihc würde dagegen Pt. Kochi angemessen sey n . Zuletzt
glaubt Wagner den Pt. Kochi demPt.propinquns am nächsten verwandt,
PTERODACTYLUS PROPINQUUS.
Pterodactylus ( Ornithocepha -
¡US) propinyuus, . . . . A. W*o»Ea, in gelehrte Anz. der Bayeri»r;hen
Akad., 17. Aug. 1867. N". 21. S. 171.
Pterodactylus proyinquus, . . A. W*eNEi<, in Abhandl, d. math, phys, Klaa.,e
d. Akad, zu .«anehen, VIII. 2 (1858).
S. 451. t. 16. r. 3.
Diese Versteinerung gelangte durch Ankauf der Iläberlcin’schen
Sammlung in die paiäontologische Sammlung zn München. Auf
Platte und Gegenpiatte liegt das seh r zertrümmerte und durch sp ätbi-
gen Kalk uiidcullicli g ewordene Sk e le t, über dessen Bcschaffenlieit
es daher s c hw e r ist, vollständige Ken n tn iss zu erlangen. Wagner
glaubt gleicliwohl die vcrwandlschaftliclien Beziehungen zu undeicii
Formen mit ziemiicher Sicherheit ermittelt zu haben.
Es wird nur der Schädel abgebildcl. Das v o rdere Ende se in es Profils
is t « eggebrochen, uud das lliiiterliaupt seiner Knochen g rö ssfen -
Ihcils beraubt. Aus den Eindrücken im Gestein ergiebt sich die Gesammt-
läagc des Scliädels zu ungefähr 0 ,1 3 5 ; für den vollst.ändig erhaltenen
Unterkiefer e rh ä lt man 0 ,1 1 5 . Die längere Gestalt des Schädels erinnert
wohl an Pt.longicoilum und Pt. Würtembcrgicus, in diesen beiden
Thieren is t aber die G csichtsliiiie eher concav, convex dagegen in Pt,
propinqiius, bei dem der v o rdere Nasciiloclnviiikel kaum bis zum
vorderen Schaileldrittel, in Pt. longicolium kaum bis zur .Mitte der
Schädellänge reicht. Grössere Aehiilichkeit besteht, fa s t mit Pt,
lo n g irostris, bei dem aber die Zähne noch geringer sind und nicht so
weit zurückführeii. Die Zähne sind gerade Kegcl-förinig und an der
Basis e tw as aufgetrieben; die g rö sste n vo n ihnen steh en nur 0 ,0 0 3
( ! '/ , Linie) üb e r dem Kicferrand h e raus, nnd die Reihe, die sie bilden,
nimmt kaum zwei Drittel Kieferläiige ein. Für den Unterkiefer
weiden 11— 12 solcher Zähne angegeben.
Der ziemlich kurze Hals misst nach der Krümmung 0 ,0 8 . Die
beiden e rsten Halswirbel sind z e r s tö r t, die fünf letzten noch iinler-
soheidbar. Von den Rückenwirbeln sind die e rsten gut erhalten,
sie «’erden aber bald da rau f uiideullicli, und vo n dem hinteren Theil
der Wirbelsäule «’ird g a r n ichts walirgenommen.
Ueber die Knochen der Gliedmaassen, die v e rs tre u t und sta rk
beschädigt s in d , lä s s t sich nur wenig anfüliren. Der ziemlich
schianke, von der schmalen Seite en tb lö sste Oberarm is t am oberen
Ende tie f au sg eschnitten und misst nach der Läiigenaxe 0 ,0 4 5 . Der
noch einlenkende, a u s einem Knoclieiipaar bestehende Vorderarm
ergiebt fast ü ,ü 8 Länge. Am beschädigten MiUclliaiidkiioclieii des
Flugiiugers lä s s t sich nur e rk en n en , d a ss e r jed enfalls länger war
als der halbe Vorderarm. Die zwei ietzlcii Fliigfiiigerglieder sind
noch miteinander v e rb u n d en , nnd es misst von ihnen das v o rletzte
0 ,0 5 2 , das letzte 0 ,0 4 3 . Ein ve re in ze lte s Flngfingerglied von
0,0 6 5 Länge wird das e rste oder zwe ite sey n . Ein Knochen, der
für das Schienbein genommen wird , e rgiebt 0 ,0 7 Lange. Nicht w e it
davon liegen Reste von deu Zellen.
In der Nähe der beiden noch zusammenhängenden Fluglingcr-
glieder sollen Spuren von der Flughaut in Form e ines schwarzen
Eindrucks im Gestein überliefert sey n . „Derselbe b e g in n t, wie
AVagner sag t, e tw a s unterhalb des oberen Endes des Ict-zten Finger-
g licd es , breitet sich mit einem Bogen-förmigen Einschnitte a u s w
ä rts a u s , uinsäuml die ganze Aussenseite des vorletzten Gliedes
und lä s s t noch Spuren von diesen Phalangen aus gegen den Rumpr
hin wah rn ehm en .“
AVagner findet eigentlich nur den Ptero d ac ly lu s med iu s, für
eine Vergieiehuiig geeignet, bei dem ab er n ichts weiter als der (iber-
arm und Unterschenkel sich in Betracht ziehen la s s e n , die beide
gleiohmässig e tw a s g rö s s e r sind als in Pt. propinquus. Die mittleren
Halswirbel scheinen in beiden Thieren nichl viel ab zuweich en , nnd
es scheint auch die nicht vollständig überlieferte L änge des Schädels
von Pt. medius jen e in Pt. propitiqiins n icht viel übcrlroffen zu
haben. AVagner glaubt indess nicht, d a ss diese Achiiliclikuiten lun-
reichen, um beide Formen zu e iner Art zu vcibiiidcii. Früher liatte
e r den Pl. medius nur für ein g rö sse re s Exemplar von Pl, Kochi
gehalten. AVärc dies wirklich der Fa ll, so würde Pl. propinqiius
von Pt. medius schon dadurch verschieden sey n , d a ss sein ühcrarm im
Vergleich zum Vorderarm kürzer w a r a ls in Pt. Koclii, bei dciii
gleichwohl Hals und Vorderarm, wie in Pt. propinquus, ungefähr
gleiche Länge zeigen. Auch in Pt. Kochi w a r, wie in Icizlerciii Thier,
die Mittelhand länger a ls der halbe Vorderarm.
PTERODACTYLUS CRASSIRÜSTRIS,
Taf. V.
Pterodaclylus erassirostris, . Gor.un’ss, in N. Acln Leopold., XV. I. S, 63.
Pterodactylus erassirostris, . 11. v. Mkvm, Palaeologica, 1632. S. 116. 2.15;
— in Jahrb. f. .tliiiernl., 1856. S. 827.
Pierodactylus erassirostris, . Bucxuan, Geology and Mineralogy, 1836. I.
p. 221. II, p. 33. t. 22. f. A. C. G. Pr.
Pacliyramphus...................... ..... FiTzisoEa, Systcaia rcptilium, I (1843).
OriiilhocepItalHS erassirostris, . A. Wrc.ner, in Abhandl. d. malh. phys. Klasse
d.Akad. zu.llünehen, VI. 1 (1861). S. 189;
— in gelehrte Anz. d. üayr, Akad., 19. Aug.
1857. 22. S. 179.
Brachylracketus erassirostris,. Giedei., Allgcnieinc Paläontologie, 1852, S. 231.
Hhumphorhynchus erassirostris
( l o l d i - , .............................A. Waoseh, Geschichte der Urwelt, 2, Aufl.,
11. 1858. S. 446; - in Abhandl. d. math,
phys. Klasse d. Akad. zu Hüuchcn. Vlil, 2
(1858). S. 505, 511.
Die u n te r obiger Benennung begrilTene Pra eh tv e rsteineriin g
is t eine Zierde des zu Poppelsdorf befindlichen natiirhistorisclieii
.Museums der Un iversität Bonn. Seitdem Goldfuss sie ausführlich
dargelegt h a t, is t sie nicht wieder untersucht worden. Die davon
angcfcrligten Abgüsse sind zwa r schön, können aber unmöglich fürs
. Studium das Original erse tz en . Ich w a r daher seh r erfreut, im October
1 856 die V ersteinerung se lb st von Herrn Geheimen Ober-ßergrath
Nöggerath aus dem .Museum zu Poppelsdorf mitgethciit zu erhallen,
w a s mich auch in den Stand s e tz te , Abbildungen nach meinen
eigenen Zeichnungen davon zu liefern. Die Abbildungen bei Goldfuss
sind weniger correct als sch ön . Taf. V. Fig. 1 gebe ich die
Ilau p lp latte, au f die fa s t alle Knochen beim Spalten k am en , Fig. 3
die .Abbildung der durch Goldfuss meisterhaft vom Gestein befreiten
linken Seite des Kopfes mit den v o rderen Hals«’iib c ln , und Fig. 2
die rechte Seite des K o p fe s, wie sie sich au f der Gegenplatte darste
llt, an der nur wenige Knochen hängen geblieben sind. Die Füsse
sind mit dem hinteren Theil des Beckens und dem Sclnvanze wegge-
broclicn. Es is t nicht b e k an n t, w an n und in welchem Steinbruehe
diese Versteinerung gefunden «'urde.
Durch Druck hat der Kopf, dessen allgemeine Form beim ersten
Anblick noch am e rsten an .Monitor e rinnert, schwa ch e Verschiebung
e rlitte n , wodurch an der rechten Seile mehr v o n der Oberseite des
Sch äd els, se lb st der obere Theil vom Rand der linken Augenhöhle,
und an der linken Seite das e t« ’as herabgerückte v o rd ere Ende der
rechten Uiiterkieferhälfte sich tb a r wurden. Die ganze Länge des
Kopfes m is st 0 ,1 1 5 , die des Unterkiefers 0 ,0 9 9 .
Die drei Oeffnungen io der oberen Schädeldecke sind vollkommen
knöchern b eg ren zt, sie besitzen so g u t wie gleiche Lange,
das N asenloch, die kleinste Oeffnung d a rstelle n d , ist aber nur halb
80 hoch oder breit als die mittlere Oeffiuing, und diese is t weniger
breit als die Augenhöhle. Die Aiigciiliölile liegt 0 ,0 7 3 vom vorderen
Ende des Scliädels e n tfe rn t, b e sitz t 0 ,0 2 3 5 Länge und 0,021 Höhe
oder Bre ite, ist «iiregclmässig g e rundet und vo rn mehr gerade
begrenzt. Sie beherbergt einen Knoch eu rin g , dessen innerer Rand
e tw a s nach aussen au fgeriehtet erscheint. Der King bestand dabei
au s einer einfachen Platte, ich habe wen ig sten s nicht finden können,
da ss er ans Blättchen oder Schuppen znsainmengesefzl « ’áre.
Die Knochetibrückc zwischen Aiigenhölile uud miltierer Oeif-
nung is t überaus schmal. Letztere Oeffiuing besitzt die Form eines
mit der Spitze nach vorn g e richteten gleiclischcnkeligeii Dreiecks,
« 'o ra n die Ecken sta rk abgerundet sind. Die Länge d ieser Oelfnung
kommt au f die der Augenhöhle h e ra u s , und die hinten liegende
g rö s s te Bi-eite misst 0 ,0 1 6 .
Die Kiiüclieiibrüi'ke zu ’isciien mittlerer Oeffiuing und Nasenloch
mis st mehr als das Dop|ie!le der Brücke zwischen e rs te re r Oeifniing
und .der Aiigenhölile; sie läuft sch räg von unten nach oben imd
liin ten , und der h intere Winkel des Nasenlochs liegt weiter zurück
a ls dev vordere der minieren Oeifiuuig. Die Entfernung des N.aseii-
lochs vom v o rderen Seliädelende b eträgt 0 ,0 2 9 , die Länge dieses
ovni geformten Lochs kommt auf die der Aiigenhölile h e ra u s , und
seine Ilölie oder Breite ergiebt 0 ,0 0 8 . Von dem durch das Loch
hituluich sichtbaren Knochen (c der Abbildung bei Goldfuss) glaubt
Goldfuss, dass er duzii gedient h a b e , die Ocifnung wie in .Monitor
bis auf ein kleines Loch in der hinteren Gegend zu vcrsch lic sscn ;
der Knochen steile sich je tz t n u r e ingedrückt dar. Er g la u b t, dass
eine Spur davon in Pierodactylus lotigiroslris der .Münchener Sammlung
dui-cli ein kleines Kiiocliciistück nngcdeiitet s e y , von dem ich
indess an letzterer Versteinennig iiiclils «•ahriielimeii konnte. Der
Knoclien, der in l'teroilactyliis e ra s s iro s tris das Nnsciiiocli tlieillloriii.
V. .Ilojer, liiliogr. Sclilcfur,
w eise v e rschlossen haben so ll, wird dem Innern oder der Gaiimcn-
seitc des Scliädels an g eiiö ren , und mit der ä u sseren Nasenölfiiiing
g a r nichts gemein habcu.
Eine Grenze zwischen dem Oberkiefer und Zwischenkiefer «-ar
n icht aiifziiflnden; Goldfuss nimmt sie hinter den zwei vorderen
Zähnen an, wo ein kleiner Ausschnitt im Zalinraiidc wahi-genoninicn
w ird , dem keine weitere Bedeutung beigelegt werden kann. Es ist
daher anzimehmen, dass der vordere Naseiiloc-hwinkel vom Zwischenkiefer
begrenzt w ird , dem aucli die liinterwärts bis zum Haiiplsiirn-
beiii ziehende einfache Knoclienleisle (b ) angehört. Der obere Rand
des Nasenlochs g eh ö rt dieser L e is te , der untere Rand dem Oberkiefer
an. Die Knochenbrücke zwischen Nasenloch und mittlerer
üeffiUMig wird nur von einem auf- und h in te rwä rts g erichteten Fo rtsatz
des Oberkiefers gebildet, der von der Zwisclicnkieferleiste durch
einen schmalen, mit dem hinteren Winkel des Nasenlochs versehenen
Knochen (d ) , das Vorderslirnbein, getrennt wird. Goidfuss glaubt,
d a ss der v o rdere Theil dieses Knochens mit dem Nasenlochwinkel
von dem hinteren Theil g e tren n t s e y , und hält e rsleren für ein
kurzes Nasenbein. Eine solche Trennung b e steht indess nicht. Ich
habe nicht einmal die Naht zw'ischen dem Vorderslirnbein und der
Zwischenkieferleisle deutlich wahniclinicn könn en , wie überhaupt
die Nähte mitunter sc hw e r zu verfolgen waren.
Die g rö ssere vordere Hälfte der mittleren Höhle wird nur vom
Oberkiefer b e g re n zt, bei der kleineien hinteren Häifle geschieht dies
und z« ’ar oben vom Thränenbein und imten vom Jo ch bein , welche
durch Eiitscndnng von Fortsätzen die Knochenbrücke zwischen
mittlerer Höhle und Augenhöhle bilden. Die Trennung dieser beiden
Beine wird an der linken Seile des Schädels Fig. 3 , wo eine Verschiebung
derselben stattfand, dciitlieli erkannt. Der Oberkiefer kielt
sich seh r deutlich unter dem Jochbein aus und endigt in der dem
hinteren Ende der mittleren Höhle entsprechenden Gegend; oben, wo
er sich zwischen Vorderstirnbein und Thränenbein a u sk eü t, führt er
kaum so weit zurück.
Das Hauptslirubein wird ein paariger Knochen s e y n , doch ist
die Naht zwischen beiden Hälften nicht deutlich. Vorn ragte es,
wen igsten s io der .Mitte, bis in die der vorderen Hälfte der Augenhöhlen
entsprechende Gegend, wo man Andeutungen von einer
z ackigen Quernaht wahrzunehmen g la u b t; aussen scheint es sich
kaum weiter nach v o rn gezogen zu haben. Von der Gegend des
hinteren Augenhöhlenwinkels lauft fa s t quer oder doch nur wenig
h in te rwä rts g e richtet eine Treiiiuing, vo n der ich es uneiilschiedeii
la s s e , ob s ie , wie Goldfuss g ia u b t, die Grenze zwischen Stirnbein
und Scheitelbein bildet. Wäre dies der Fa ll, so würde der hintere
Theil von der durch die beiden Geh irn-Hemisphären v eranlassten
Schädelwölbuiig nicht mehr auf das Hauptstirnbeiu, sondern auf das
Scheitelbein kommen, das sich dabei auch mehr in die Sehläfengnibe
zöge. Liegt aber in der angegebenen Stelle die Grenze beider Knochen
n ic h l, so wird sie wohl hinter der Gegend der beiden Hemisphären
zu suchen s e y n , wo indess eine N ah t, die sie verriethe,
nicht aufziifindeii war.
Die obere Hälfte des -Aiigenhöhlenrandes wird in der .Mitte vom
Haiiptstirnbein, vorn vom Thränenbein und hinten vom Hinterstirnbein
g eb ild et, die untere ilniftc dieses Randes allein vom Jochbein,
d a s , wie au f der e tw as ve rschobenen linken Seite des Scliädels
deutlich erkannt « ’ird, einen vierästigen Knoclien bildet, das Hinter-
sliriibein, das auf der rechten Seife des Schädels weggebrochen ist,
einen dreiästigen. Dieses hilft mit seinem hinteren Aste oder Fortsa
tz die Sehläfengnibe au ssen begrenzen, wozu es sieh mit einem
vo n hinten koniiiieiiden Fo rtsa tz vereinigt, den Goldfuss dem Zitzenbein
beilegt. Bei dem gänzlichen .Mangel an Nähten im Hinterschädel
halte ich cs kaum für möglich, die Grenze für da.s Scheitelbein,
das Zitzen- oder Schläfenbein nnd die Iliiitcrhanptsbciiie anzii-
gebeii. Es lä s s t sich mir im Ailgcmcinen anfüliren, d a ss die Scliläfen-
gruben, welche in der Scheitelbciiimiite durch eine sta rk e Einbiegung
von au ssen einander sc lir nahe treten, gut entwickelt s in d , obschon
ihre Länge der der Augenhöhlen nicht gleicli kam. Dahinter is t der
Schädel in der Milte mit ciiicni einspringenden Winkel v e rsehen,
dessen Seiten K am m -a r tig erliöht sich d a rstellen , «-orin schon
Goldfuss eine Aehnlielikeit mit den Flersc li-fres seiiden Säugelhieren
erkannte. Von dem seitlichen IliiilerhiUiplsbeiii scheint am liinteren
Ende weiter niitcii e tw a s sichtbar zu seyn. Als Unlcrhiiitcrliaupls