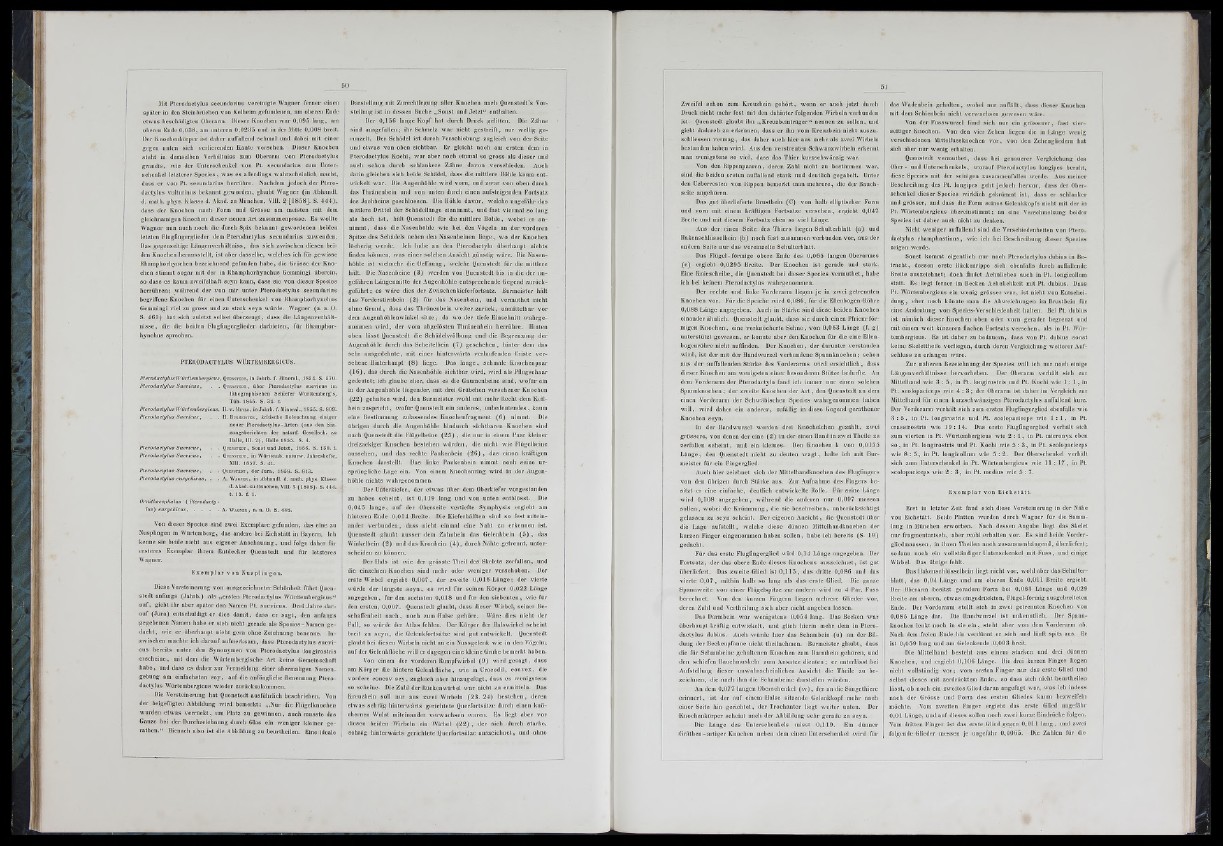
'S
/■'i-
Mil Pleioitaclyliis eeciiniinriiis vereinigte Wagner ferner einen
später in «len Steinbriiclieii von Kellicim gefiimieiieii, am oberen Ende
e tw as bcscliädiglen Obernriu. Dieser Knochen w a r 0 ,0 9 5 lan g , am
oberen Ende 0 ,0 3 8 , am unteren 0 ,0 2 3 5 und in der .Mitte 0 ,0 0 8 breit.
Der Knochenkörper is t dalier anffallend schmal und dabei mit einer
gegen unten sicli verlierenden Kante v ersehen. Dieser Knochen
ste h t in demselben Vcrliiillniss zum übevarin von Pterodactylus
g ran d is , wie der Unterschenkel von Pt. secundarios zum Uiiler-
schenkel letzterer Sp e c ies, w a s e s allerdings wahrscheinlicli macht,
dass er von Pl. secundarius herrühre. Nachdem jedoch der Pterodactylus
vulturiniis bekannt g ewo rd en , glaubt Wagner (in Abhandl.
«I. inalli. pliys. Klasse d. Akad. zu München, Vlll. 2 [1 8 5 8 ]. S. 4 4 4 ) ,
d a ss der Knochen nacli Form und Grösse am meisten mit dem
gicichnaiiiigen Knochen dieser neuen .Art ziisammenpassc. Es wollte
Wagner nun auch noch die liurch Spix bekannt gewordenen beiden
letzten Flugfingerglieder dem Pterodactylus secundarius zuwenden.
Das gegenseitige Län g en v erh ä ltn iss, das sich zwisch en diesen beiden
Knochen liernusstellt, is t aber dasselbe, welches ich für gewisse
iUininphorliynclicii bezeichiieiid gefunden h ab e, die Grösse der Knochen
stiiiiint so g a r mit der in Khamphorhynchus Gemmingi überein,
so dass es kaum zweifelhaft seyn kann, d a ss sie von dieser Species
he rrü h ren ; während der von mir unter Pterodactylus secundarius
begrifTenc Knochen für einen Unterschenkel von iihainpliorhynelius
Gennningi viel zu g ro s s und zu sta rk sey n würde. Wagner (a. a. U.
S. 4 6 1 ) hat siel) zuletzt se lbst ü b erzeugt, d a ss die Langenverhait-
n is s e , die die beiden Flugliiigerglieder da rb ie ten , für Khamphorhynchus
sprechen.
PTERODACTYLUS WÜRTEMBERGICUS.
Plerodaclytus 11'irillemàergic.
¡‘Icrodaclylus Suevicus,
Plerodaclyius H'ürlemberyicus,
Plerodaelylns Suecictis, . .
Flerodaclylus Suevicus,
Flerodaclylus Suevicus,
Flerodaclylus Suevicus,
Flerodaclylus eurycliirus
QmsTEDT, in Jalirb, f. Mineral., 1854. S. 670.
QvE.'STtDi, aber Pterodactylus suevicus im
liiiiographiscfaen Scbictcr Wörttembcrg's,
Tüb. 1865. S. 34. t.
U. V. MEVEn, in Jnlirb. f. Mineral., 1855. S. 809.
H. BcRSEiSTER, kritische Beleuchtung einiger
neuer Ptcrodaotylus-Arten (aus den Siz-
zungabcrichteo der natorf. Gesellscb. zu
Halle, 111. Ì ) , Halle 1855. S. 4.
QiE.vsTEnT, Sonst und Jetzt, 1856. S. 130, f.
Quenstedt, in Württemb. natunv. Jaiiresbefle,
XIH. Ì857. S. 41.
Qie.vstedt, der Jura, 1868. S. 813.
A. WtGNER, in Abbandl. d. math. phys. Klasse
d.Akad. zu .München, VIII. 2 (1858). S. 444.
i. 15. f. 1
Ornithoce/ihalus ( Plerodacly -
lus) eurycliirus..................... «. 0. S. 448.
Von dieser Species sind zwei Exemplare gefunden, das eine zu
Nusplingen in Würtemberg, das andere bei E ichstätt in Bayern. Ich
keime sie beide nicht aus eigener A n schauung, und folge daher für
e rsteres Exemplar ihrem Entdecker Quenstedt und für letzteres
Wagner.
Ex c ip la o n N u s p lin g e
Diese Versteinerung von ausgezeichneter Sehönlicit führt Queii-
s fed t anfangs (Jah rb .) als „ersten Pterodactylus Württembergicns“
a u f, giebt ihr aber sp äter den Namen Pt. su evicus. Drei Jah re dara
u f (Ju ra ) en tsch u ld ig te r dies damit, da ss er s a g t, den anfangs
gegebenen Namen habe er sich nicht gerade als Sp ecies-Nam en ged
a ch t, wie er überhaupt nicht gern ohne Zeichnung bencimc. Inzwischen
machte ich darauf aufmerksam, d a ss Pterodactylus suevicus
bereits u n te r den Synonymen von Pterodactylus longirostris
e rsc h ein e, mit dem die Würtembergische Art keine Gemeinschaft
h a b e , und d a ss es dah er zur Vermeidung einer abermaligen Namengebung
am einfachsten s e y , a u f die anfängliche Benennung Ptero dactylus
AVürtcmbergicns wieder zurflekzukommcn.
Die Versteinerung hat Quenstedt ausführlich beschrieben. Von
der beigefügten Abbildung wird bemerkt: „Nur die Fiügeiknochen
wurden e tw as v e rrü ck t, um Platz zu g ewin n en , auch musste das
Ganze bei der Diirchzeichniing durch Glas ein weniger kleiner gc-
rath en .“ Hienach also is t die Abbildung zu beuilheilen. Eine ideale
Darstellung mit Ziirechtlegiing aller Knochen nach Quensledt’s Vot-
slelhing ist in dessen Buche „S o n st und J e tz t“ enthalten.
Der 0 ,1 5 6 lange Kopf hat durch Druck gelitten. Die Zähne
sind ausgefallen; ihr Schmelz war n icht g e s tre ift, mir wellig gerunzelt.
Der Schädel is t durch Verschiebung zugleich vou der Seile
und e tw a s von oben sichtbai-. Er gleicht noch am e rsten dem in
Pierodactylus Kochi, w a r aber noch einmal so g ro s s a ls d ieser und
aucli schon durch schlankere Zähne davon verschiedeu. Auch
darin gleichen sich beide Schädel, dass die mittlere Höhle kaum entwickelt
war. Die Augeiiliöhle wird v om , und zwa r von oben durch
d as Thränenbein und vo n unten durcli einen aufsteigenden Fortsatz
des Jochbeins gesclilossen. Die Höhle d a v o r, welche ungefähr das
mittlere Drittel der Schädellänge einnimmt, und fast viermal so laug
a ls hoch i s t , hält Quenstedt für die mittlere Höhle, wobei er an-
uimnit, dass die Niiseiihöhle wie bei den Vögeln an der vorderen
Spitze des Schädels neben deu Nasenbeinen lieg e, wo der Knochen
löcherig werde. Jeh habe an den Pterodactyin überhaupt nichts
finden kötnieii, w a s einer solchen .Ansicht g ü n stig wäre. Die Nnsen-
iiölile is t vielmehr die OeiTtuitig, welche Quenstedt für die mittlere
hält. Die Nasenbeine (3 ) werden vo n Quenstedl bis iu die der ungefähren
Längeiimitte der .Angenliöhle entsprechende Gegend ziirück-
g e fü h rt; es w äre dies der Zwisehenkieferfortsatz. Biirmeister hält
das Vorderstirnbein (2 ) für das Nasenbein, und vermnliiet nicht
ohne Grund, dass das Tliränenbein weiter zu rü c k , unmittelbar vor
dem Augenhöhlenwiiikel s itz e , da wo der tiefe Einschnitl wah rg e-
noininen w ird , der vom abgelöstcn Thränenbein h e rrühre . Hinten
oben lä s s t Quenstedt die Sciiädelwölbung und die Begrenzung der
Augenhöhle durch das Scheitelbein (7 ) g e s ch e h eu , h inter dem das
s e h r au sg ed eh n te, mit e iner h in te rwä rts verlaufenden Criste v e rsehene
Uioterhaupt (8 ) liege. Das la n g e , schmale Knochenpaar
( 1 6 ) , das durch die Nasenhöhle sich tb a r wird, wird a ls Pilugschaar
g ed eu te t; ich glaube elier, da ss e s die Gaumenbeine sin d , wofür ein
in der Augenhöhle liegender, mit drei Grübchen verseh en e r Knocheu
(2 2 ) gehalten wird, den Bumieister wohl mit mehr Reclit dem Keilbein
z u sp rich t, wofür Quenstedt ein a n d e re s, unb ed eu ten d es, kaum
eine Bestimmung zn lassendes Knochenfragment (6 ) nimmt. Die
übrigen durch die Augenhöhle hindurch sich tb a ren Knochen sind
nach Quenstedt die Flügelbeiite (2 5 ) , die nur in einem Pa a r klehiur
dreizackiger Knochen bestehen w ü rd e n , die nicht wie Flügelbeiue
au s s eh e n , und das rechte Paukenbeiu ( 2 6 ) , das einen kräftigen
Knoclien darstellt. Das linke Paukenbein nimmt noch seine ursprüngliche
Lage ein. Von einem Knochenring wird in der .Augenhöhle
nichts wahrgenommen.
Der Unterkiefer, der e tw a s üb e r dem Oberkiefer vorgestanden
zu haben s c h e in t, is t 0 ,1 1 9 lang und von unten en tb lö sst. Die
0 ,0 4 5 la n g e, a u f der Oberseite v e rtiefte Symphysis ergiebt am
hinteren Ende 0 ,0 1 4 Breite. Die Kieferhälflen sind so fest miteinander
ve rb u n d en , da ss nicht einmal eine Naht zu e rkennen ist.
Quenstedt glaubt a u sser dem Zahnbein das Gelenkbein (5 ) , das
Winkelbein (2 ) und das Kronbein ( 4 ) , durch Nälite g e tren n t, unterscheiden
zu können.
Der Hals is t wie der g rö s s te Theil des Skelets z erfallen, «nd
die einzelnen Knochen sind mehr oder wen ig er v e rschoben. Der
e rste Wirbel ergiebt 0 ,0 0 7 , der zwe ite ü ,0 1 6 Län g e ; der v ierte
würde der län g ste s e y n , es wird für seinen Körper 0 ,0 2 2 Länge
a n gegeben, für den se ch sten 0 ,0 1 8 und für den s ie b en ten , wie für
den ersten , 0 ,0 0 7 . Quenstedt glaubt, d a ss d ieser Wirbel, seiner Bc-
schalTcnheit n a ch , noch zum Halse gehöre. Wäre dies nichl der
Fall, so würde der .Atlas fehlen. Der Körper der Halswirbel scheint
breit zu s e y n , die Gelenkfortsätze sind gut entwickelt. Qiien.stedt
glaubt bei diesen Wirbeln nicht an ein Niissgelenk wie in dm Vögeln;
a u f der Geienkiläche will e r dagegen eine kleine Grube bemerkt haben.
Von einem der vorderen Rumpfwirbel (9 ) wird g e s a g t, dass
am Körper die hintere Gelcnklläclie, wie in Crocodil, c o n v e x , die
v o rdere concav s e y , zugleich aber liinziigcfiigt, d a ss es wenigstens
80 eclieine. Die Zahl der Rückenwirbel w a r nicht zu ermiltchi. Das
Kreuzbein soll nur aus zwei Wirbeln ( 2 3 . 2 4 ) b e s teh e n , deren
e tw a s sch räg hin te rwä rts g e richtete Querfortsätze durch einen knöchernen
Wulst miteinander v e rw ac lis en waren. Es liegt aber v o r
diesen beiden Wirbeln ein Wirbel (2 2 ) , der sich durch starke,
sch räg h in te rwä rts gerichtete Querfortsätze au sze ich iiet, und ohne
Zweifel schon zum Kreuzbein g e h ö rt, wenn er auch je tz t durch
Druck nicht mehr fest mit den dahinter folgenden Wirbeln verbunden
ist. Quenstedt glaubt ihn ,,K ie u zb e in träg c r“ nennen zu Süllen, und
g iebt dadurch zu erkennen, da ss e r ihn vom Kreuzbein nicht auszu-
schliesseii v e rm a g , das daher auch hier aus mehr als zwei Wirbeln
bestanden haben wird. Aus den v e rstreu ten Schwauzwirbeln erkennt
mau wen ig sten s so v ie l, d a ss das Thier kuvzschwäiizig war.
Von den Kippenpaaren, deren Zahl nicht z« bestimmen war,
sind die beiden e rsten aulTulleud s ta rk und deullich gegabelt. Unter
den Ueberresten von Rippen bemerkt man m eh re re, die der Bauchse
ite angehören.
Das gut überlieferte Brustbein (C) von halb clliptisclier Form
und vo rn mit einem kräftigen Fo rtsa tz e v e rse h en , ergiebt 0,047
Breite und mit diesem Fo rtsa tz eben so viel Länge.
Aus der einen Seite des Thiers liegen Schulterblatt (a ) und
llakensclilüsselbein (b ) noch fest zusammen verbunden v o r, aus der
ä ndern Seite nur das v e reinzelte Schulterblatt.
Das Flü g el-förm ige obere Ende des 0 ,0 6 5 langen Oberarmes
(c ) ergiebt 0 ,0 2 9 5 Breite. Der Knochen is t g e rade und stark.
Eine Kniescheibe, die Quenstedt bei dieser Species v e rm u th et, habe
ich bei keinem Pterodactylus %vahrgenommeii.
Der rechte und linJce Vorderarm liegen je in zwe i getrennten
Knochen v o r. Fü r die Speiche wird 0 ,0 8 6 , für die Elleiibogen-Röhre
0 ,0 8 8 Länge angegeben. Auch in Stärke sind diese beiden Knochen
e inander ähnlich. Quenstedt glaubt, d a s s sie durch einen Pfriem-förmigen
Knoclien, eine verk n ö ch erte Seh n e , vo n 0 ,0 6 3 Länge (f. g)
u n te rs tü tzt g ewe sen , e r konnte ab er den Knochen für die eine Ellen-
bogenrölire nicht aufftnden. Der Kn o ch en , der darunter verstanden
w ird , is t der mit der Handwurzel verbundene Spannkiiochen; schon
aus der aulTallenden Stärke des Vorderarms wird e rsich tlich , dass
d ieser Knochen am wenigsten einer besonderen Stütze bedurfte. An
dem Vorderarm der Ptcrodactyln fand ich immer n u r einen solclien
Spannkiiochen; der zwe ite Knochen der A rt, den Quenstedt an dem
einen Vorderarm der Schwäbischen Speeies wahrgenoinmeii haben
w ill, wird daher ein a n d e re r, zufällig in diese Gegend geratliener
Knochen seyn.
In der Handwurzel werden drei Knöchelchen g e zäh lt, zwei
g rö sse re , von denen der eine (2 ) in der einen Hand in zwei Theile zu
zerfallen s c h e in t, und ein kleines. Den Knochen k von 0 ,0 1 5 5
L än g e , den Quenstedt nicht zu deuten w a g t, halte ich mit Bur-
uieister für ein Fingevglied,
Auch hier zeichnet sich der .M ittelliandknochen des Flngfingci s
vo n den übrigen durch Stärke au s. Zur .Aufnahme des Fingers besitzt
er eine e infa che , deutlich en twickelte Rolle. Für seine Länge
wird 0 ,1 0 8 ang eg eb en , wäh ren d die anderen nur 0 ,0 9 7 messen
so lle n , wobei die Krümmung, die sie b e schreiben, iinbcriicksichtigl
g e lass en zu sey n scheint. Der eigenen A n sic h t, die Quenstedt über
die Lage .iiifstellt, welche diese dünnen Milteliiandknochen der
kurzen Finger eingcnommeu haben so llen , liabe ich b e re its (S. 19)
gedacht.
Fü r das e rste Flngfingerglied wir«! 0 ,1 4 Länge angegeben. Der
F o rts a tz , der «las obere Ende d ieses Knochens a iiszeicliiiet, is t gut
ü berliefert. Das zwe ite Glied ist 0 ,1 1 5 , das d ritte 0 ,0 8 6 und das
v ierte 0 ,0 7 , mithin lialb so lang als das e rste Glied. Die ganze
Spannweite von einer Flügelspitzc zur ändern wird zu 4 Par. Fuss
b erechnet. Von den kurzen Fingern liegen mehrere Glieder vor,
deren Zahl und Vcrthciluiig sich aber nicht angeben lassen.
Das Darmbein w a r w en ig sten s 0 ,0 5 4 lang. Das Becken war
ü berhaupt kräftig e n tw ick e lt, und glich hierin mehr dem iu Plero-
d aclyhis dubius. Auch würde liier das Schambein (u ) an der Bildung
der Beckeiipfanne n icht thcilnchmen. Burmeistcr g la u b t, dass
die für Scliaiiibeiiic gehaltenen Knochen zum Darmbein gehören, und
(len schiefen Bauchmuskeln zum Ansätze dienten ; er un te rlässt bei
Aufstellung dieser uinvahrschcinliclieii Ansicht die Theile zu bezeichnen,
die nach ihm die Schambeine darstellen würden.
An dem 0 ,0 7 7 langen übersclienkel (w ) , der an die Säugethiere
criiiiiei t , is t der auf einem Halse sitzende Gelcnkkopf mehr nach
e iner Seile hin g e ric h te t, der Troclianter liegt weiter unten. Der
Kiioclienkörpcr scheint nach der Abbildung se h r gerade zu seyn.
Die Länge des Uiilcrseheukels misst 0 ,1 1 9 . Ein dünner
G rä tlieii-a rtig er Knochen neben dem einen Uiitersclicnkcl wird für
das Wadenbein g ehalten, wobei mir aiiffälll, «lass dieser Knochen
mit dem Schienbein nicht verwacli.sen gewesen wäre.
Von der Fusswurzel fand sich nur ein g rö s se re r, fast vierseitiger
Knochen. Von den vier Zehen liegen die in Länge w'ciiig
verschiedenen .Mitteifussknoehen v o r , von den Zelienglicdern hat
sich aber nur wenig erlialteii.
Quenstedt ve rm iilh c t, dass bei genauerer Vergleiehune des
Ober- und Unterschenkels, wo rau f Ptcroilacfyhis longipes beruht,
diese Species mit der seinigen zusamnieiifallcn werde. Aus meiner
Beschreibung des Pt. longipes gelit jedoch h e rv o r, dass der Olier-
sclieiikel dieser Species wirklich gekrümmt is t , d a ss e r schlanker
und g rö s se r, und da ss die Form seines Gclcnkkopfs nicht mit der in
Pt. Würtenibergicus übereinstimmt; au eine Verschmelzung beider
Species is t daher aucli nicht zn denken.
Nicht weniger auffallend sind die Verschiedenheiten von Ptero dactylus
rh am p h a stin u s , wie ich bei Beschreibung dieser Species
zeigen werde.
Sonst kommt eigentlich nur noch Pterodactylus dubius in Betr
a c h t, dessen e rste Rückenrippc sich ebeiifalls durch auffallende
Breite auszeichiiet; doch findet Aehnliches auch in Pl. longicoilum
s ta tt. Es liegt ferner im Becken Aehnlichkeit mit Pt. dubius. Dass
Pl. Würtenibergicus ein wenig g rö sser w a r, is t niclit von Entscheid
u n g , eher noch könnte man die Abweichungen im Brustbein für
eine Andeutung vo n Species-Verschiedenheit halten. Bei Pt. dubius
is t nämlich «lieser Knochen oben oder vorn ge rad er begrenzt und
mit einem weit kürzeren llaclicn Fortsatz v e rse ilen , als in Pt. Wür-
tembergicus. Es is t daher zu bedauern, dass von Pt. dubius so n st
keine Skelettheile vorJiegeu, durch deren Vergleichung weiterer Aufsch
lu ss zu erlangen wäre.
Zur näheren Bezeichnung der Species will ich nur noch einige
L än g euvcrhällnissc he rvorheben. Der Oberarm v e rhält sich zur
Mittelhand wie 3 : 5 , iu Pt. longirostris und Pt. Kochi wie 1 : 1 , in
Pt. scolopaeiceps wie 4 : 3 ; der Oberarm is t daher im Vergleich zur
Mittelliand für einen kurzschwänzigen Pterodactylus auffallend kurz.
Der Vorderarm v e rhält sich zum e rsten Flugfingergiied ebenfalls wie
3 : 5 , in Pt. longirostris und Pt. scolopaeiceps wie 1 : 1 , in Pt.
era s s iro s tris wie 1 9 : 1 4 . Das e rste Flngfingerglied v e rhält sich
zum v ierten in Pt. Würtembcrgicus wie 2 : 1 , in Pt. micronyx eben
s o , in l’t. longirostris nnd Pt. Kochi wie 5 : 3 , in Pt. scolopaeiceps
wie 8 : 5 , in Pt. longicoilum wie 5 : 2. Der Oberschenkel verhält
sich zum Unterschenkel in Pt. Würtembcigicus wie 11 i 1 7 , in Pt.
scolopaeiceps wie 2 : 3 , io Pt. medius wie 5 : 7 .
E x em p lt on E i c h s t ä t t .
E rst in letzter Zeit fand sich diese Versteinerung in der Nähe
von Eichstätt, Beide Platten wurden durch Wagner für die Samiii-
hiiig in .München erworben. Nach dessen Angabe liegt das Skelet
nur fragmen tarisch , aber wohl erhalten vor. Es sind beide Vorder-
g licdma assen , in ihren Theilen noch zusammenhängend, überliefert;
sodann noch ein vollständiger Uutersckenkel mit F u s s , und einige
Wirbel. Das übrige fehlt.
Das llakenschlüsselbein liegt nicht vo r, wohl aber das Schulterb
la tt, das 0 ,0 4 Länge und am oberen Ende 0,011 Breite ergiebt.
Der Oberarm besitzt geradere Form bei 0 ,0 6 3 Länge und 0,029
Breite am oberen, e tw a s eingedrückten. Flügel-förmig ausgebreiteten
Ende. Der Vorderarm ste llt sieh in zwei getrennten Knochen von
0 ,0 8 5 Länge dar. Die Handwurzel is t unkenntlich. Der Spann-
knoclieii lenkt noch in sie e in , s te h t aber von dem Vorderarm ab.
Nach dem freien Ende hin verdünnt er sich und läuft spitz aus. Er
ist 0 ,0 5 9 lang und am Gelenkende 0 ,0 0 3 breit.
Die Mittelhand be sieh t aus einem sta rk en und drei dünnen
Knochen, und ergiebt 0 ,1 0 6 Länge. Die drei kurzen Finger liegen
nicht vollständig v o r ; vom e rsten Finger nur das e rste Glied und
se lb st dieses mit zerdrücktein En d e, so dass sich nicht beiirtheilen
hisst, ob noch ein zwe ite s Glied daran angefügt w a r, was ich indess
nach der Grösse und Form des e rsten Gliedes kaum bezweifeln
möchte. Vom zweiten Finger ergiebt das e rste Glied ungefälir
0,01 Länge, und auf d ieses sollen noch zwei kurze Eindrücke folgen.
Vom «Iritteii Finger is t das e rste Glied gegen 0,011 la n g , und zwei
folgende Glieder messen je ungefähr 0 ,00 65 . Die Zahlen für die