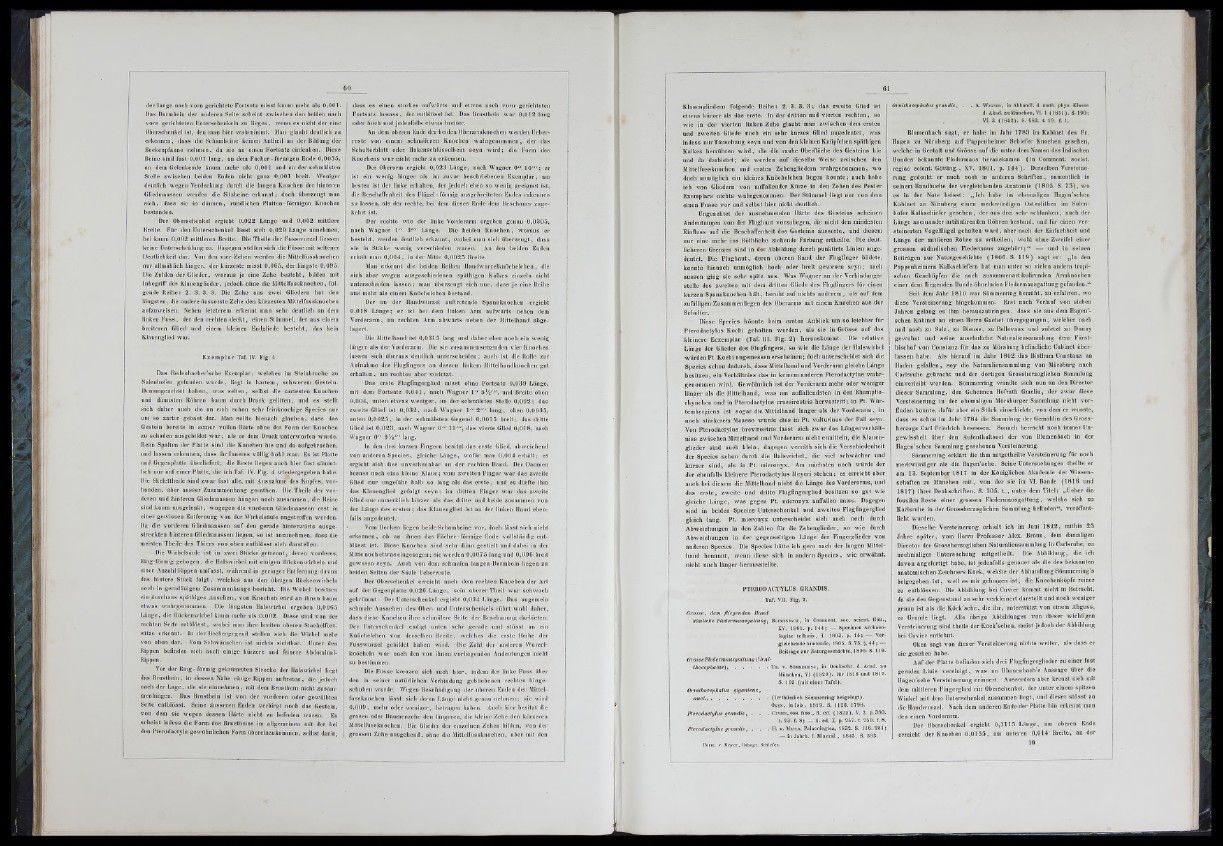
ilor Inngc iincli vorn gcriclilcic Fortsatz misst kntini melir als 0,001.
Das Darmbein der andereii Seite sclieint zwisclien den beiden iiacli
vorn gericlitelen liiitersclienkeln zn liegen, wenn es nicht der eine
Oberschenkel ist, den man hier wahrnimml. Man glaubt deutlich zu
e rk en n en , dass diu Schambeine keinen Antheil an der Bildung der
Heckeiipfaniie nehmen, da sie an einen Fortsatz einlenkcn. Diese
Beine sind fast 0 ,0 0 7 lang, an dem Fä ch er-förmigen Ende 0 ,0 0 5 3 ,
an dem (ielenkeiide kaum mehr als 0,001 und an der schmälsten
Stelle zwischen beiden Enden nicht ganz 0,001 breit. Weniger
ileullieh wegen Verdeckung durch die langen Knochen der hinteren
Gliedmaassen werden die Sitzbeine e rk a n n t; doch überzeugt man
s ic h , dass sie in dünnen, rundlichen PlaUen-förmigcn Knochen
bestanden.
Der Oberschenkel ergiebt 0 ,0 2 2 Länge und 0 ,0 0 2 mittlere
Breile. Für deu Unterschenkel lä s s t sich 0 ,0 2 9 Länge aunehmen,
bei kaum 0 ,0 0 2 inittieren Breite. Die Theile der Fusswurzel liessen
keine ünlerscheidiiitg zu. Dagegen stellen sich die Füs se mit seltener
Deutlichkeit dar. Von den vier Zehen werden die Mitteifussknoehen
nur nihnnhiicli länger, der kürzeste misst 0 ,0 6 3 , der längste 0,095.
Die Zahlen der Glieder, wo rau s je eine Zehe b e s ieh t, bilden mit
Inbegriff der Kiauenglieder, jedoch ohne die Mitlelfussknochen, folgende
Reihe: 2. 3. 3. 3. Die Zehe au s zwei Gliedern h a t den
längsten, die andere ä u sserste Zehe den kürzesten Mitteifussknoehen
aiifzuweisen. Neben letzterem erkennt man seh r deutlich an dem
linken F u s s , der den rechten d e ck t, einen Stümmel, der a u s einem
breiteren Glied und i
kleinen Endgliede b e s te h t, das kein
Klauenglied war.
Das Redenbacher’sch e Exemplar, welches im Steinbruehe zu
Solenliofen gefunden wu rd e , liegt in ha rtem , schwerem Gestein.
Demungeachtet h ab en , w a s se lte n , se lbst die z artesten Knochen
und dünnsten Köhren kaum durch Druck g e litte n , und es stellt
sich daher auch die an sich schon seh r feinknochige Speeies nur
um so z arter gebaut dar. .Man sollte hienach glau b en , dass das
Gestein bereits in seiner vollen Harte ohne der Form der Knochen
ZII schaden aiisgebildet w a r , a ls es dem Druck u nterworfen wurde.
Beim Spalten der Platte sind die Knochen hie und da anfgebrochen,
und lassen erkennen, d a ss ihr Inneres völlig hohl war. Es is t Platte
und Gegenpiatte ü b erliefert; die Reste liegen auch hier fast sämmt-
licli nur auf einer Platte, die ieh Taf. IV, Fig. 4 wiedergegehen habe.
Die Skelettheile sind zwa r fast alle, mit Ausnahme des Kopfes, v o rhan
d en , aber au sser Zusammenhang g e ra then. Die Theile der v o rderen
und hinteren Gliedmaassen hängen noch zusammen, die Beine
sind kaum au sgelcnkt, wogegen die vorderen Gliedmaassen e rs t in
einer gewissen Entfernung von der Wirbelsäule angetroffen werden.
Da die v o rderen Gliedmaassen anf den gerade h in te n v ä rts aosge-
stre ck ten hinteren Gliedmaassen liegen, so is t anzunclimen, dass die
meisten Theile des Thiers von oben en tblösst sich darstellen.
Die Wirbelsäule is t in zwei Stücke g e tre n n t, deren vorderes,
Ring-förmig gebogen, die Halswirbel mit einigen Rückenwirbeln und
einer Anzahl Kippen umfasst, während in geringer Entfernung davon
das hintere Stück fo lg t, welches aus den übrigen Rückenwirbeln
noch in geradlinigem Zusammenliaiige besteh t. Die Wirbel besitzen
ein durchaus späthiges An seh en , von Knoche« wird an ihnen kaum
e tw a s walirgenommen. Die längsten Halswirbel ergeben 0,0 0 6 5
Län g e , die Rückenwirbel kaum mehr a ls 0 ,0 0 2 . Diese sind von der
rechten Seite en tb lö s s t, wobei man ihre breiten oberen Stachelfort-
sätze erkennt, ln der Beckengegend stellen sich die Wirbel mehr
von oben dar. Vom Schwänzchen is t nichts sichtbar. Unter den
Rippen befinden sich auch einige kürzere und ffeinere Abdominal-
Rippen.
Vor der Rin g -fö rmig gekrümmten Strecke der Halswirbel liegt
das Brustbein, in dessen Nähe einige Rippen au ftre ten , die Jedoch
nach der L ag e , die sie einnehmen, mit dem Brustbein nicht zusammenhingen.
Das Brustbein is t von der vorderen oder gewölbten
Seile cn tblösst. Seine ä u sseren Enden v e rbirgt noch das Gestein,
vo n dem sie wegen dessen Härte nicht zn befreien waren . Es
scheint indess die Form des Brustbeins im allgemeinen mit der bei
den Pterodactyin gewöhnlichen Form übercinzukommen, selbst darin.
d a ss cs einen sta rk en au fw ärls und e tw a s nach vorn gerichteten
Fo rtsa tz b e s a s s , der entb lö sst ist. Das Brustbein w a r 0 ,0 1 2 lang
oder hoch und jedenfalls e tw a s breiter.
All dem oberen linde der beiden Oberarmknoclien wurden Ueberreste
von einem schmäleren Knochen w ah rgenom men, der das
Schulterblatt oder llakensclilüsselbein sey n w ird ; die Form des
Knochens w a r nicht mehr zu erkennen.
» e r Überarm ergiebt 0 ,0 2 3 Län g e , nach Wagner 0 " 1 0 " '; er
is t ein wenig länger als im zu vor beschriebenen Exemplar, am
besten is t der linke erhalten, der jedoch eben so wenig geeignet ist,
die Beschaffenbeil des Flügel - förmig ausgebreiteten Endes erkennen
zu lassen, a ls der reclite, bei dem d ieses Ende dem Beschauer zugc-
kchrt ist.
Der rechte wie der linke Vordernrni ergeben genau 0 ,0 3 0 5 ,
nach Wagner 1 " 3 " ' Länge. Die beiden K n o ch en , w o ra u s er
b e s te h t, werden deullich e rk a n n t, \vobei man sich ü b e rz eu g t, da ss
sie in Stärke wenig v e rschieden waren . An den beiden Enden
erhält man 0 ,0 0 4 , in der Milte 0 ,0 0 2 5 Breile.
-Man erkennt die beiden Reihen Handwiirzelknöclielchcn, die
sich aber wegen nnsgescliiedenen späthigen Kalkes einzeln nicht
unterscheiden la s s e n ; inan überzeugt sich niii', da ss je eine Reihe
aus inehr a ls einem Knöchelchen bestand.
Der an der Handwurzel aiiftrelende Spannknoclien ergiebt
0 ,0 1 8 Län g e ; er is t bei dem linken Arm a u fw ä rts neben dem
Vorderarm, im rechten Arm a bw ä rts neben der Mittelhand abgelagert.
Die Mittelhand is t 0 ,0 3 1 5 lang und daher eh er noch ein wenig
länger als der Vorderarin. Die sie ziisainmensetzenden vier Knochen
la ssen sich überaus deutlich u n te rs ch e id en ; auch is t die Holle zur
Aufnahme des Fliigfmgers au d e ssen linkem .Mittelhandknochen gut
e rh a lle n , am rechten aber ve rle tz t.
Das e rste Flugfingergiied misst ohue Fo rtsa tz 0 ,0 3 9 Länge,
mit dem Fo rtsa tz 0 ,0 4 1 , nach Wagner 1 " S 'A '" , und Breile oben
0 ,0 0 4 , unten e tw a s wen ig er, an der schmäisten Stelle 0 ,0 0 2 ; das
zw'eite Glied is t 0 ,0 3 2 , nach Wagner l " 2 " ' la n g , oben 0 ,0 0 3 5 ,
unten 0 ,0 0 2 5 , in der schmälsten Gegend 0 ,0 0 1 5 b re it; das dritte
Glied is t 0 ,0 2 3 , nach AVagner 0 " 1 1 '" , das v ie rte Glied 0 ,0 1 8 , nach
AA'agiier 0 " 9 'A '" lang.
In deu drei kurzen Fingern besitzt das e rs te Glied, abweichend
von anderen S p e c ie s, gleiche Länge, wofür man 0 ,0 0 4 e rh a ll; es
ergiebt sich dies u n v e rkennbar an der rechten Hand. Der Daumen
b e sass noch eine kleine Klan e; vom zweiten Finger w a r das zweite
Glied nur ungefähr halb so lang als das e r s t e , und es dürfte ihm
das Klauenglied gefolgt s e y n ; im dritten Finger w a r das zweite
Glied nur unmerklich kürzer als das dritte und beide zusammen vun
der Länge des e rs te n ; das Klauenglied ist an der linkeu Hand ebenfalls
angedentet.
A'om Becken liegen beide Schambeine v o r, doch lä s s t sich nicht
e rk en n en , ob ao ihnen das Fä ch er-förmige Ende v ollständig entblösst
ist. Diese Knochen sind selir dünn g e stie lt und dabei in der
Mitte noch e tw a s eingezogen; sie werden 0 ,0 0 7 5 lang und 0 ,0 0 6 breit
gewe sen sey n . .Auch von dem schmalen langen Darmbein liegen zn
beiden Seiten der Säule Ueberreste.
Der Oberschenkel e rreich t nach dem rechten Knochen der Art
auf der Gegenpiatte 0 ,0 2 6 Länge, sein oberer Tlieil w a r schwa ch
gekrümmt. Der Unterschenkel ergiebt 0 ,0 3 4 Länge. Das iingcniein
schmale Aussehen des Ober- und Unterschenkels rü h rt wolil daher,
d a ss diese Knochen ihre schmälere Seile der Beschauung darbicten.
Der Unterschenkel endigt nnleii s e h r ger.ndc und s tö s s t an ein
Knöchelchen von derselben B re ite , welches die e rs te Reihe der
Fu s swu rz el gebildet haben wird. Die Zahl der anderen AVurzcl-
knöciieln w a r nach den von ihnen vorlicgeiiilen Andeutungen nicht
zu bestimmen.
Die Füs se kreuzen sich auch h ie r, inilem der linke F a s s über
den in seiner nalürliclicn Verbindung gebliehenen recliten liinge-
schobcn wurde. AVegen Beschädigung der oberen Enden dev Mittel-
fiissknochen lä sst sich deren Länge n icht genau nelinieii; sic wird
0 ,0 0 9 , mehr oder w en ig er, hctrngeii haheii. Auch hier hesilzl die
g ro sse oder Daumenzeile den längeren, die kleine Zehe den kürzeren
.Vlillclfiissknoclien. Die Glieder der einzelnen Zehen bilden, von der
g ro ssen Zelle au sg eh en d , ohne die .Mittelfussknoclien, aber mit den
CI
Klaucnglicdcrn folgende Reihe: 2 . 3. 3. 3 ; das zwe ite Glied ist
e tw a s kürzer als d a s e rste. In der dritten und v ierten r e c h ten , so
wie in der v ie rten linken Zehe glaubt man zwischen dem e rsten
und zweiten Gliede noch ein seh r kurzes Glied a n g ed en tet, was
indess nur Täuschung sey n und vo n den kleinen K nöpfchcn späthigen
Kalkes h e rrühren w ird , die die rau h e Oberfläche des Gesteins hie
und da da rb ie te t; sie werd en auf dieselbe AVcisc zwisch en den
Mitteifussknoehen und e rsten Zehengliedern wahrgenommen, wo
doch unmöglich ein kleines Knöchelchen liegen k o n n te ; auch habe
ich von Gliedern vo n auffallender Kürze in den Zehen des Pe ste r
Exemplars n ichts wahrgenommen. Der Stümmel liegt n u r von dem
einen F u s se v o r und se lb st hier nicht deutlich.
Ungeachtet der ausnelimendun Härte des Gesteins scheinen
Andeutungen vo n der Flughaut vorzuliegen, die n icht den mindesten
Einfluss auf die Beschaffenheit des Gesteins ä u s s e rte , und diesem
nu r eine mehr ins Rölhliche ziehende Färbung ertheilte. Die deutlicheren
Grenzen sind in der Abbildung durch p unktirtc Linien angedeutet.
Die F lu g h au t, deren oberen Rand der Flugfinger bildete,
k onnte hienach unmöglich hoch oder breit gewe sen se y n ; nach
a u ssen ging sie s e h r spitz au s. AVas AVagner an der Verbindungsstelle
des zweiten mit dem dritten Gliede des Fliigfingers für einen
kurzen Spannknochen h ält, beruht auf n ichts auderem, als au f dem
zufälligen Zusammenliegcn des Oberarms mit einem Knochen au s der
Schulter.
Diese Species könnte beim e rsten Anblick um so leichter für
Pterodac tylus Kochi geh alten w e rd en , a ls sie in Grösse au f das
kleinere Ecxemplar (Taf. 111. Fig. 2 ) herauskomrat. Die relative
Länge der Glieder des Fliigfingers, so w ie die Länge der Halswirbel
wu rd en Pt. K ochi angemessen ersch ein en ; doch un te rsch e id et sich die
Species schon dadurch, d a ss Mittelhand und A'orderarm gleiche Länge
be sitz en , ein Verhältniss das in keinem anderen Pterodactylus w ah r-
genommeii wird. Gewöhnlich is t der Vorderarm mehr oder weniger
länger als die Mittelhand, w a s am auffallendsten in den Rbampho-
rhynchei! und in Pterodac tylus e ra s s iro s tris lie rv o rtritt ; in Pt. AVür-
feinbergicus is t so g a r die Mittelhand länger als der Vorderarm, in
noch stärkerem Mansse wü rd e dies in Pt. v u ltu rin iis der Fall seyn.
Von Piero d ac ty lu s b rev iro stris lä s s t sich zwa r das Läiigeiiverhält-
n is s zwischen Mittelhand und Vorderarm nichl ermitteln, die Klauen-
glieder sind auch klein, dagegen v e rrä th sich die Verschiedenheit
der Species schon durch die Halswirbel, die viel schwä ch e r und
k ü rze r sin d , als in Pt. micronyx. Am nächsten noch würde der
der ebenfalls kleinere Pterodac tylus Meyeri s te h e n ; e s e rreich t aber
auch bei diesem die Mittelhand nicht die Länge des A'orderarms, und
das e r s t e , zwe ite und dritte Flugfingergiied besitzen so gut wie
gleiche Län g e , w a s gegen Pt. micronyx auffallen muss. Dagegen
sind in beiden Species Unterschenkel «nd zwe ite s Flugfingergiied
gleich lang. Pt. micronyx un te rsch e id et sich auch noch durch
Abweichungen in den Zahlen für die Zeh en g lied er, so wie durch
Abweichungen in der gegenseitigen Länge der Fingerglieder von
anderen Species. Die Species h ä tte ich gern nach der langen Mittelhand
b e n an n t, wenn diese sich in ändern Sp e c ies, wie erwäh n t,
nicht noch länger heraiisstellte.
PTERODACTYLUS GRANDIS.
Taf, VII, Fig. 7.
Grosse, dem fliegenden Hund
ähnliche Fledermausgallung, BLUSBXBAcn, in Comment, soc. acicnl. Götl.,
XV, 1801. p. 144; — Specimen Arcliaeo-
logine telliiris, I. 1803. p. 16; — Ver-
glciehciiilcAnatomie, 1806. S.T6,§.44; —
Beiträge zur Nsturge.ichiclite, 1806. S. 119.
Ornithocephalus grandis, ■ . A. AVaoxb«, in Abhundl. i). malh. phy«, KIsmhb
(I.AkiKt. zu Münehcn, VI. l (1661). 8.190;
VI. 3 (1852). S. 083. t. 19. f. 1.
Blut
GrosseFkdennaiisgatlung (Ornilhocephalus),
. .
Ornilhocephalus giganteus,
I. V, Söuiizamso, in Denkschr. d. Acad. zu
Miiiichen, VI (1820). für 1816 und 1817.
S. 105 (mit einer Tafel).
Plcrodaclylus grandis, .
Plcrodaclylus grandis, .
. (IrrthSmlieh Sömmerring bcigelcgt).
OüEX, in Isis, 1819. S. II26. 1798.
. CoviBB, osa, foss., 3. ed. (1826). V. 2. p, 380.
t. 23. f. 8 ; — 4. cd, X. p. 267. t. 250. f. 8.
. II. V. Mevko, Palaeologica, 1832. S. II G. 261;
— in Jahrb. f. Miuernl., 1843. S. 583.
Sicycr, UUiDgr. Sctiiefer.
ich s a g t, er habe im Ja h r 1783 im Kabinet des Fr.
Ragen zn Nürnberg auf Pappenheimer Schiefer Knochen gesehen,
welche in Gestalt und Grösse auf diu unter dem Namen des Indischen
Hundes bekannte Fledermaus hcrauskanien ( in Comment. societ.
regiae scient. Gö tlin g ., XV. 1801. p. 1 4 4 ) . Derselben Versteineru
n g gedenkt er auch noch in anderen Sch riften , namentlich in
seinem Handbuche der vergleichenden Anatomie (1 8 0 5 , S. 7 5 ) , wo
es in der Note h e is s t: „ Ic h habe im ehemaligen Ilagen’schen
Kabinet zu Nürnberg einen merkwürdigen Osteolilhen im Solen-
hofcr Kalkschiefer g e seh e n , der aus drei seh r sch lan k en , nach der
Länge aiieiiiander artikulirenden Röhren b e stand, und für einen v e rste
inerten Vogelflügel gehalten w ard , aber micli der Einfachheit und
Länge d e r mittleren Röhre zu u rth eilen , wohl ohne Zweifel einer
g ro ssen südindischen Fledermaus z u g e h ö r t;“ — und in seinen
Beiträgen zur Naturgeschichte (1 8 0 6 . S. 1 1 9 ) sag t e r: „In den
Pappenheimern Kalkschiefern hat man unter so vielen ändern tropischen
Geschöpfen die noch zusaninienartikulirenden Armknochen
e iner dem fliegenden Hunde ähnelnden Flederinausgattung gefunden.“
Seit dem Jah r 1 810 war Sömmerring bemüht, zu erfah ren , wo
diese Versteinerung hingckominen. E rst nach Verlauf von sieben
Jah ren gelang es ihm he rau szu b rin g en , da ss sie aus dem Hagen'-
selien Kabinet an einen Herrn Gachet ü b e rgegangen, welcher nach
und nach zu Su lz, zu Dieuse, zu Bellevaux und zuletzt zu Douay
g ewo h n t und seine ansehnliche Naturaliensammliing dem Fü rstb
ischof von Constanz für das zu Mörsburg befindliche Cabinet überlassen
habe. Als hierauf im Ja h r 1 802 das Bisthiini Constanz an
Baden g e fa llen , se y die Naturaliensammlung vo n Mörsburg nach
Carlsriihe g ebra cht und der dortigen Grosslierzoglichen Sammlung
einverlcibt worden. Sömmerring wandte sich nun an den Director
d ieser Sammlung, den Geheimen Hofralh Gmelin, der zwa r diese
Versteinerung iu der ehemaligen Mörsburger Sammlung nicht x'or-
finden konnte, dafür aber ein Stück einschickte, vo n dem er wu sste ,
d a ss es schon im Jah r 1 7 8 4 die Sammlung der Gemahlin des Grossherzogs
Carl Friedrich be sessen . Sonach h e rrsch t noch immer Ung
ewissh eit über den Aufenthaltsort der vo n Blumenbach in der
Ilagen’schcu Sammlung gesehenen Versteinerung.
Sömmerring erklärt die ihm mitgetheilte A'erateinerung für noch
merkwürdiger als die Hagen’sche. Seine Untersuchungen theilte er
am 13. September 1 817 in der Königlichen Akademie der AVissen-
schaflen zu München m it, vo n der sie im VI. Bande (1 8 1 6 und
1 8 1 7 ) ih rer Denkschriften, S. 105. t . , unter dem Titel: „Ueber die
fossilen Reste einer g ro ssen Fledermausgattuiig, welche sich zu
Karlsruhe in der Grossherzoglichen Sammlung befinden“ , veröffentlicht
wurden.
Dieselbe Versteinerung erhielt ich im Juni 1 8 4 2 , mithin 25
Ja h re sp ä te r, vom Herrn Pro fessor Alex. Braun, dem damaligeu
Director der Grossherzoglichen Naturalieiisammlung in Carlsruhe, zu
nochmaliger Untersuchung mifgetheilt. Die .Abbildung, die ich
davon angefertigt habe, is t jedenfalls g enauer als die des bekannten
anatomischen Zeichners Köck, welche der Abhandlung Sömmerring’s
heigegeben is t , weil es mir gelungen i s t , die Knoehenköpfe reiner
zu eiitblössen. Die Abbildung bei Cuvier kommt nicht in Betracht,
da sie den G egenstand zu se h r v e rkle ine rt d a rstellt und noch weniger
genau ist als die Köck’sc h e , die ih r , unte rs tü tzt von einem Abguss,
zu Grunde liegt. Alle übrige Abbildungen von d ieser wichtigen
Versteinerung sind theils der K öck’schen, meist jedoch der Abbildung
bei Cuvier entlehnt.
Oken sag t vo n d ieser A'ersteinerung nichts weiter, als d a ss er
sie gesellen habe.
Anf der Platte befinden sich drei Flugfingerglieder zu einer fast
geraden Linie v e re in ig t, w a s an Blumenbach’s Aussage über die
Hagen'sche Versteinerung erinnert. Ausserdein aber kreuzt sich mit
dem mittleren Fingcrglied ein Oberschenkel, der unter einem spitzen
AVinkel mit dem Üntersehenkei zusammen lieg t, und dieser s tö s s t an
die Handwurzel. Nach dem anderen Ende der Platle hin erkennt man
den einen A'orderarm.
Der Oberschenkel ergiebt 0 ,1 1 1 5 Län g e , am oberen Ende
e rreich t der Knochen 0 ,0 1 5 5 , am unteren 0 ,0 1 4 Breite, an der