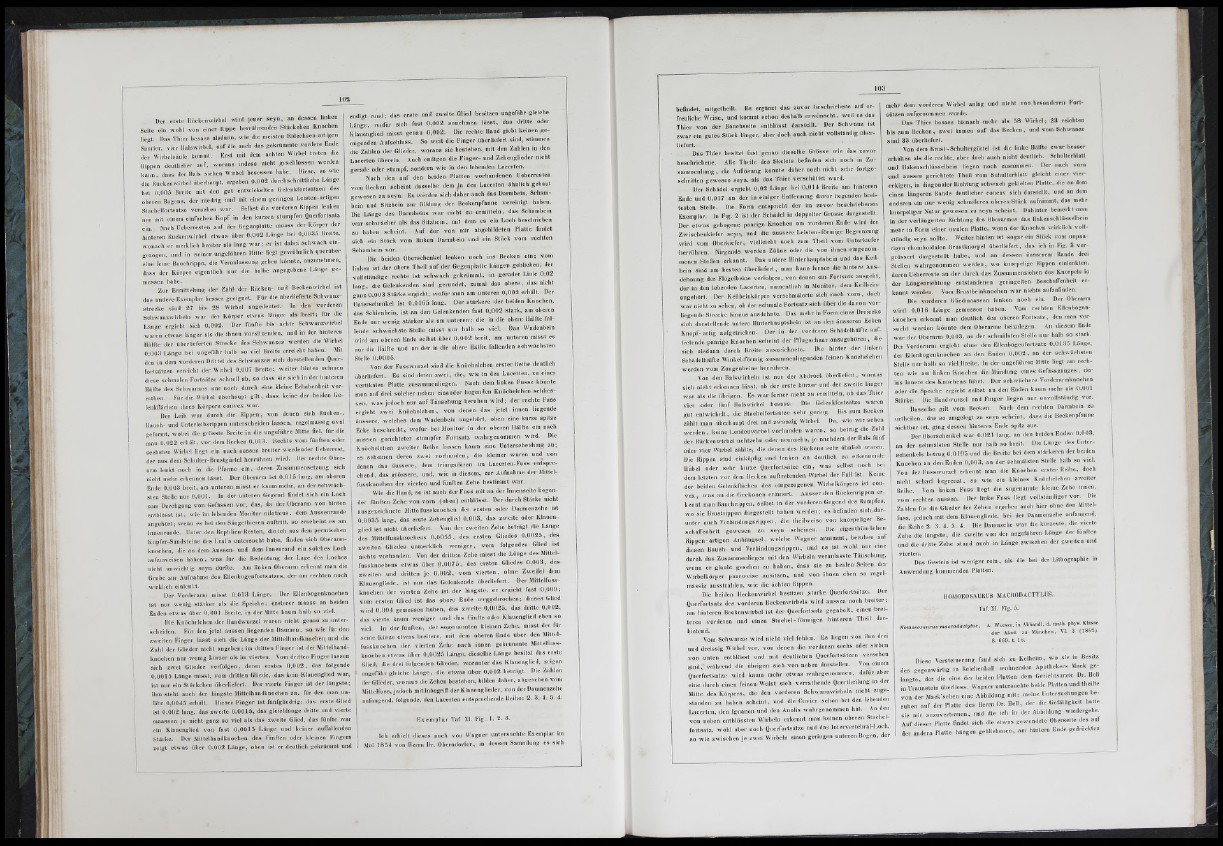
Der e rste Kuckenwirbel wird jen er se y n , 1 dessen linken
5 lierriihrendes Stackchen Knochen
Seite ein wohl von einer Rippe
lieptstre
Das Thier b e sass alsdann, wie die meisten Eideobsen-nrtigen
r llnlswirbel, nnf die auch dos gekrümmte v o rdere Ende
der Wirbelsäule kommt. E rst mit dem achten Wirbel treten die
Rippen deutlicher a u f. wo rau s indess nicht gesch lo s sen werden
k a n n , dass der Hals sieben Wirbel b e sessen habe. Diese, so wie
die Knekenwirbcl überhaupt, ergeben 0 ,0 0 2 durehschnittliche Länge
bei 0 .0 0 5 Breite mit den g u t entwickelten Gelenkfortsätzcn des
oberen Bogens, der niedrig und mit einem geringen Leisten-artigen
Stachelfortsatze v e rsehen w a r. Selbst die vorderen Rippen lenken
mit einem einfachen Kopf in den knrzei, stumpfen Querfortsatz
ein. Nach Ueberresten a u f der Gegenpiatte maass der Körper der
hinteren Knekenwirbcl e tw a s über 0 .0 0 2 Länge bei 0 ,0 0 3 5 Breite,
wonach e r merklich breiter als lang w a r ; er isl dabei s chwa ch e.n-
gezogeii. und in se in er nngefähren Mitte liegt gewöhnlich qnernber
eine feine Banchrippe, die Veranlassung geben könnte, anzuneiimcn,
da ss der Körper eigentlich nur die halbe angegebene Länge g e messen
habe.
Zur Ermittelung der Zahl der Kücken- und Beckenwirbel ist
das andere Exemplar be sser geeignet. Für die überlieferte Schwanz-
ck e sind 27
i 2 8 Wirbel angedentet. in den vorderen
• der Körper e tw a s länger a ls b re it; für die
Schwanzwirbein '
Lange ergiebt sich 0,0 0 2 .
Der fünfte bis achte Schwanzwirbel
„ ...v n e tw as länger als die ihnen Vorsitzenden, und in der hinteren
Hälfte der überlieferten Strecke des Schwanzes werden die Wirbel
0 .0 0 3 Länge bei ungefähr halb so viel Breite e rreich t haben. Mit
den in dem vorderen Drittel des Schwanzes sich darstellenden Quer-
lörlsälzcii erreicht der Wirbel 0 ,0 0 7 B re ite; w e ite r hinten nehmen
diese schmalen Fortsätze schnell ab. so d a ss sie sich in der hinteren
Hälfte des Schwanzes nur noch durch eine kleine Erhabenheit v e r-
r.ithen. Für die Wirbel überhaupt g ilt, da ss keine der beiden Ge-
Icnknächen ihres Körpers convex war.
Der Leib w a r durch die' Rippen, vo n denen sich Rucken-.
Bauch- und Unterleibsrippcn unterscheiden la ssen , regelmässig oval
geformt, wobei die g rö sste Breite in die ungefähre Mitte fiel, für die
man 0 .0 2 2 erhält, v o r dem Becken 0 ,0 1 3 . Rechts vom fünften oder
se ch sten Wirbel liegt ein naeh au ssen breiter w erdende r Üeberrest,
der aus dem Schnlter-Brustgürtel he rrü h reu wird . Der rechte Oberarm
lenkt noeh in die Pfanne e in , deren Zusammensetzung sich
nicht mehr erkennen lä sst. Der Oberarm is t 0 ,0 1 5 lang, am oberen
Knde 0 ,0 0 3 breit, am un te ren m is st e r kaum mehr, an der schwä ch sten
Stelle nur 0 ,0 0 1 . In der unteren Gegend findet sich ein Loch
zum Durchgang von Gefässen v o r, das, da der ü berarm von hinten
en tb lö sst is t, wie im lebenden Monitor n ilo ticu s , dem Aussenrande
an g eh ö rt; wenn es bei den Säugethieren auftritt. so e rscheint es am
linienrande. Unter den Reptilien-Kesten, die ich aus dem permischen
Kupfer-Sandsteine des Urai’s un te rsu ch t habe, finden sich üb e ra rm -
knochen, die an dem Aussen- und dem Innenrand ein solches Loch
aufzuweisen h a b en , w a s für die Bedeutung der Lage des Loches
nicht u nwichtig sey n durfte. .Am linken Oberarm erk en n t man die
Grube zur Aufnahme d e s Ellenbogenfortsatzes, der am rechten noch
wirklich elnlcnkt.
Der Vorderarm misst 0 ,0 ) 3 Länge. Der Ellenbogenknochen
is t nur wenig stä rk er als die Sp e ich e; e rs te re r maass an beiden
Enden e tw a s über 0 ,0 0 1 Breite, in der Mitte kaum halb so viel.
Die Knöchelchen der Handwurzel waren nicht genau zu u n te rscheiden.
endigt n in d : das e rste und zwe ite Glied besitzen ungefähr gleiche
Län g e , wofür sich fast 0 ,0 0 2 annehmen lä s s t, das dritte oder
Klailenglied misst, genau 0 ,0 0 2 . Die rechte Hand giebt keinen genügenden
Für den je tzt au ssen liegenden Daumen, so wie für den
zweiten Finger la s s t sieh die Länge der Mittelhandknochen und die
Zahl der Glieder n icht an geben; im dritten Finger is t der Milteihandknochen
nur wenig kürzer als im v ierten. Vom dritten Finger lassen
sich zwei Glieder v e rfo lg e n , deren e rs te s 0 ,0 0 2 , das folgende
0.0 0 1 5 Länge mis st, vom dritten Gliede, das kein Klauenglied war,
is t nur ein Stückchen überliefert. Der v ierte Finger is l der län g ste ;
ihm ste h t auch der län g ste .Miltelhandknoehen zu , für den man un-
fähr 0 ,0 0 4 5 e rhält. Dieser Fin g er is t fünfgliedrig; d a s e rste Glied
ist 0 ,0 0 2 lang, das zwe ite 0 ,0 0 1 5 , das gleichlange dritte und v ierte
maassen je nicht ganz so viel a ls das zweite Glied, d a s fünfte war
ein Klauenglied von fast 0 ,0 0 1 5 Länge und keiner auffallenden
Stärke. Der Mittelhandknochen des fünften oder kleinen Fingers
zeigt e tw a s über 0 ,0 0 2 Länge, oben is t er deutlich gekrümmt und
Aufschluss. So w e it die Finger überliefert sind, stimmen
die Zahlen der Glieder, w o ra u s sie b e stehen, mit den Zahlen in den
Lacerten überein. Auch endigen die Finger- und Zeliengiieder nicht
gerade oder stumpf, sondern wie in den lebenden Lacerten.
Nach den a u f den beiden Platten v o rhandenen Ueberresten
vom Becken sch ein t dasselbe dem jin den Lacerten ähnlich gebaut
g ewe sen zu seyn. Es werden sich dah er auch das Darmbein, Schambein
und Sitzbein zur Bildung der Beekenpfanne ve re in ig t haben.
Die Länge des Darmbeins w a r nicht zu e rm itte ln , das Schambein
w a r schwä ch e r als das Sitzb e in , mit dem es ein Loch beschrieben
zu haben scheint. Auf der v on mir abgebildeten Platte findet
sich ein Sinck vom linken Darmbein und ein Stück vom rechten
Schambein vor.
Die beiden Oberschenkel lenken noch ins Becken e in ; vom
linken is t der obere Theil a u f der Gegenpiatte hängen geblieben, der
vollständige rechte is t sc hw a ch gekrümmt, in ge rad er Lime 0,02
la n g , die Gelenkenden sind g e ru n d e t, zumal das o b e re , das nicht
ganz 0 ,0 0 3 Stärke e rgiebt. wofür man am un te ren 0 ,0 0 2 e rhalt. Der
Unterschenkel is t 0 ,0 1 6 5 lang. Der s tä rk e re der beiden Knochen,
das Scliienbein, is t an den Gelenkenden fast 0 ,0 0 2 sta rk , nm oberen
Ende nur wenig stä rk e r a ls am u n te re n : die in die obere Hälfte fallende
sc hw ä ch s te Stelle mis st nur halb so v iel. Das Wadenbein
wird am oberen Ende se lbst über 0 ,0 0 2 b reit, am un te ren misst es
nur die Hälfte und an der in die obere Hälfte fallenden schwä ch s ten
Stelle 0 ,0 0 0 5 .
Von der Fu s swu rz el sind die Knöchelchen e rs te r Reihe deutlich
überliefert. Es sind deren zw e i, die, wie in den Lacerten, zu einer
vertikalen Platte zusammenliegen. Nach dem linken F u s se könnte
man auf drei so lch er neben einander liegenden Knöchelchen sch lie ssen
, w a s jedoch nur a u f Täuschung beruhen wird ; der rech te Fuss
ergiebt zwei Knöch e lch en , vo n denen das Je tzt innen liegende
äu ssere, welch e s dem Wadenbein angehört, obeu eine kurze spitze
Ecke b e sch reib t, w o fü r bei Monitor in der oberen Hälfte ein nach
a u s s en g e rich te ter stumpfer F o rts a tz wahrgenommen wird . Die
Knöchelehen zwe ite r Reihe la ssen kaum eine ü n te rs ch e id u n g zu;
es scheinen deren zwei v o rh a n d e n , die kleiner w aren und von
denen das ä u s s e r e , dem triangulären im Lae erten -F u ss en tsp re ch
en d , das g rö sse re , und, wie in diesem, zur Aufnahme der Mittel-
fussknochen der vie rten und fünften Zehe bestimmt war.
Wie die Hand, so is t auch der Fu s s mit an der Innenseite liegender
fünften Zehe vo n v o rn (oben) en tb lö sst. Der durch Stärke nicht
ausgezeichnete Mitteifussknoehen der e rsten oder Daumenzehe is t
0 ,0 0 3 5 lan g , das e rste Zehenglied 0 ,0 0 3 , das zwe ite oder Klanenglied
is t nicht überliefert. Von der zwe iten Zehe b e trägt die Länge
des Mittelfussknochens 0 ,0 0 5 5 , des e rsten Gliedes 0 ,0 0 2 5 , des
zweiten Gliedes unmerklich w en ig e r, vom folgenden Glied ist
nichts v o rhanden. Von der dritten Zehe m is st die Länge des Mittelfussknochens
e tw a s über 0 ,0 0 7 5 , des e rsten Gliedes 0 ,0 0 3 , des
zwe iten und d ritten je 0 ,0 0 2 , vom v ie rte n , o hne Zweifel dem
Klauengliede, is t n u r das Gelenkende überliefert. Der Millelftiss-
knoohen der v ierten Zehe is t der lä n g s te , er e rgiebt fast 0 ,0 0 9 ;
vom e rsten Glied is t d a s obere Ende weg gebroolien; d ieses Glied
wird 0 ,0 0 4 gemessen haben, das zwe ite 0 .0 0 2 5 , das dritte 0 ,0 0 2 ,
das v ie rte kaum wen ig er und das (ünflc oder Klauenglied eben so
viel, io der fünftcii, der sogeiinnnten kleinen Zehe, m is st der für
seine Kürze e tw a s b reitere, mil dem oberen Ende über den Millel-
fussknochcn der v ierten Zehe nach innen gekrümmte Mittelfns.s-
kiiocliei) e tw a s über 0 ,0 0 2 5 Länge, dieselbe Länge b e sitz t d a s e rste
Glied, diu drei folgenden Glieder, wo ru n ter das Klauenglied, zeigen
ungefähr gleiche L än g e , die e tw as über 0 ,0 0 2 b e träg t. Die Znhlen
der Glieder, w o ra u s die Zehen be steh en , bilden d aher, abgesehen vom
Mittelfuss, jedoch mit Inbegriff der K laiienglieder, vo n der Daumenzehe
anfangcnd, folgende, den Laccrten eiilsprcchende Reihe: 2. 3. 4. 5. 4.
E x em p la r Taf XI. Fig. 1. 2. 3.
Ich erhielt d ieses auch von Wagner u n lcrsnchte Exemplar im
Mai 1 854 von Herrn Dr. Oberndorfer, in dessen Sammlung es sich
befindet, mitgelheilt. Es ergänzt das zu vor beschriebene auf erfreuliche
Weise, und kommt schon deshalb e rw ü n sc h t, weil es das
Thier vo n der Bauchseite en tblösst darslellt. Der Schwanz ist
zwa r ein g u te s Stück länger, aber doch auch nicht vollständig überliefert
.Das Thier b e sitz t fast genau dieselbe Grösse wie das zu vor
beschriebene. Alle Theile des Skelets befinden sich noch in Zusammen
h an g , die Auflösung konnte dah er noch nicht seh r fortgesch
ritten gewe sen seyn, als das Thier v e rsc h ü tte t ward.
Der Schädel ergieht 0 ,0 2 Länge bei 0 ,0 1 4 Breite am hinteren
Ende und 0 ,0 1 7 an der in einiger Entfernung d avor liegenden breite
s te n Stelle. Die Form en tsp rich t der im zuvor beschriebenen
Exemplar, ln Fig. 2 is t der Schädel in doppelter Grösse dargestellt.
Der e tw as gebogene paarige Knochen am vorderen Ende wird der
Zwisclienkiefer sey n , und die ä u ssere Leisten-förmige Begrenzung
wird vom Oberkiefer, vielleicht auch zum Theil vom Unterkiefer
h e rrühren. Nirgends werden Zähne oder die von ihnen eingenommenen
Stellen erkamit. Das un te re Hinterliaiiplsbein und d a s Keilbein
sind am besten Überliefert, man kann ferner die hintere Ausdehnung
der Flügelbeine verfolgen, vo n denen ein F o rtsa tz ausgelit,
der in den lebenden Lacerten, namentlich in Monitor, dem Keilbein-
an g cb ö rt. Der Keilbeinkörper v e rschmälerte sich nach v o r n , doch
w a r nieht zu sehen, ob der schmale Fo rtsa tz sich über die davon
liegende Strecke hinaus ausdehnle. Das mehr in Form e ines Dreiecks
sich darstellende u n te re Hinterhauptsbein is t an den ä u sseren Ecken
K n o p f-a rtig aufgetrieben. Der in der v o rderen Schädelhälfle
treten d e paarige Knochen sch ein t der Pflugschaar aiizu g ch ö ren , die
sieh alsdann durch Breite au szeichnete. Die h in te r der linken
Schädelhälfte Winkel-förmig zusa.iimenliegenden feinen Knöchelchen
werden vom Zungenbeine he rrühren.
Von den Halswirbeln is t n u r der Abdruck übe rliefert, wo rau s
mehr dem vorderen Wirbel anlag und niclit von besonderen Fortsä
tzen aufgenommen wurde.
sich nicht erkennen lä sst, ob der e rste kürzer und-der zwe ite länger
w a r a ls die übrigen. Es w a r ferner nicht zu ermitteln, ob das Thiei
V,,;. oder fünf Halswirbel b e sass. Die Gelenkfortsätzc i
gut e n tw ick e lt, die Stachelfortsatze se h r gering. Bis zum Becken
zähll man ü b erhaupt drei und zwanzig Wirbel. Da, wie w ir sehen
w e rd e n , keine Lendenwirbel v o rhanden w a r e n , so betrug die Zahl
der Rückenwirbel achtzehn oder neunzehn, je nachdem der Hals fünf
oder v ie r Wirbel zahlte, die denen des Rückens se h r ähnlich waren.
Die Rippen sind einköpfig und lenken an deutlich zu erkennende
Hübel oder seh r kurze Querfortsätze e in , w a s se lb st noeh bei
dem letzten v o r dem Becken aiiftretenden Wirbel der Fall ist. Keine
der beiden Geleiikflächen des eingezogenen Wirbelkörpers is t conv
e x , w a s an die Geckonen e rinnert. Au sse r den Kückenrippen erken
n t man Bauchrippen, se lb st in der vorderen Gegend des Kumpfes,
wo sie Bnistrippen da rg e ste llt haben w erd en ; es befinden sic h .d a ru
n te r auch Verbindungslippen, die th e ilweise vo n knorpeliger Be-
schallenheit g ewe sen zu sey n scheinen. Die eigenthünilielien
Rip p en -arlig en Anhängsel, welch e Magiier amiimmt, beruhen auf
diesen Bauch- und Verbindungsrippen, und es is t wohi mir eine
durch das Zusammenliegen mit den Wirbeln v e ra n la s s te Täuschung,
wenn er glaubt geseh en zu h a b en , d a ss sie zu beiden Seiten der
Wirbelkörper p a arwe ise aiisitzeii, und vo n ihnen eben so regelmä
ssig au sstrah le ii, wie die ächlci) Kippen.
Die beiden Beckenwirbel besitzen sta rk e Querfortsätze. Der
Querfortsatz des v o rderen Beckenwirbels wird au ssen noch b reiter ;
am h interen Beckenwirbel ist der Querfortsatz g e g ab e lt, einen breiteren
v o rderen und einen Stachel - förmigen hinteren Tlieil darbietend.
Vom Schwänze wird n icht viel fohlen. Es liegen von ihm drei
und d reissig Wirbel vo r, vo n denen die vorderen se ch s oder sieben
vo n unten entb lö sst und mit deutlichen Querfortsätzen v e rsehen
sim i, währeml die übrigen sich von neben d a rstellen. Von einem
Querforlsälze wird kaum mehr e tw a s waiirgenoinmen, dafür aber
eine durch einen feinen Wulst sich v e rralh en d e Querlheiliing in der
Mitte des K ö rp e rs, die den vo rd eren Scliwanzwirbelu n ichl zugc-
stnnden zu haben sc h e in t, um! die Cuvicr schon bei den lebenden
L ac erten , den Iguanen und den Anolis wolirgenommeii h a t. An den
vo n neben en tb lö ssten Wirbeln erkennt man keinen oberen Stachelfo
rtsalz , wolil aber noch Querfortsätze und das In tervertebral-Loch,
so wie zwisch en je zwei Wirbeln einen geringen unte ren Bogen, der
Das Thier besass liicnach mehr a ls 58 Wirbel; 23 reichten
bis zum Beeken, zwei kamen auf das Becken, und vom Schwänze
ind 33 überliefert.
Von dem Brust-Sch u ltc rg ürte l is t die linke Hälfte zwa r besser
erhalten als die reclite, aber doch auch nicht deutlich. Schulterblatt
und Hakenschlüsselbein liegen noch zusammen. Der nach vorn
und au ssen g e richtete Theil vom Schulterblatt g le ich t e iner vier-
ckigen, in diagonaler Kichtung schwach gekielten Platte, die an dem
einen längeren Rande deutlicher concav sich d a rs te llt, und an dem
anderen ein nur wenig schmäleres oberes Stück aufninimt, d a s mehr
knorpeliger Natur gewe sen zu seyn scheint. Dahinter hemerkl man
der verlän gerten Richtung des Oberarmes das llakensclilüsselbein
mehr in Form einer ovalen Platte, wenn der Knochen wirklich v o llständig
seyn so llte. Weiter hinten ist so g a r ein Stück vom u n p a a rigen
rhomboidalen Brustknorpel ü b e rliefert, das ich in Fig. 3 v e rg
rö ssert d a rg e ste llt h a b e , und an d e ssen äusserem Rande drei
Stellen wahrgenommen w e rd en , wo knorpelige Rippen einlenkten,
deren Ueberreste an der durch das Zusamnienzielien des Knorpels in
der Längenricbluiig en tstandeneu geringelten BcschalTenheit erkannt
werden. Vom Brustbeinknochen w a r n ichts aufziifinden.
Die vorderen Gliedmaassen lenken noch ein. Der Oberarm
wird Ü.016 Länge gemessen haben. Vom rechten Ellenbogen-
knochen erkennt man deullich den oberen F o rtsa tz , den man versucht
werden könnte dem Oberarme beizulegen. An diesem Ende
w a r der Oberarm 0 ,0 0 3 , an der schmälsten Stelle nur halb so sta rk .
Der Vorderarm ergiebt ohne den Ellenhogeiifortsatz 0 ,0 1 3 5 Länge,
der Ellenbogeiiknochen an den Enden 0 ,0 0 2 , an der schwächs ten
Stelle mir halb so viel Breite, ln der nngefähren Milte liegt am rechte
n wie am linken Knochen die Mündung eines G efässgaiiges. der
ins Innere des Knochens führt. Der .schwächere Vorderarmknochen
oder die Speiche ergiebt se lb st an den Enden kaum mehr als 0,001
Stärke. Die Handwurzel und Finger liegen nur unvollständig vor.
Dasselbe gilt vom Becken. Nach dein rechten Darmbein zu
u rtheilen, das so umgelegt zu sey n sc h e in t, d a ss die Beekenpfanne
sich tb a r ist. ging dessen hin te res Ende spitz aus.
Der Oberschenkel w a r 0.021 lang, an den beiden Enden 0 .0 0 3 ,
an der schmälsten Stelle nur halb so breit. Die Länge des Untersch
enkels betrug 0 ,0 1 9 5 und die Breite bei dem stä ik e ren der beiden
Knocheu an den Enden 0 ,0 0 3 . an der sclimälsten Stelle halb so viel.
Von der Fu s swu rz el erk en n t man die Knoclien e rs te r Reihe, doch
nicht sc h arf b e g re n zt, so wie ein kleines Knöchelchen zweiter
Reihe. Vom linken Fuss liegt die so g en an n te kleine Zehe innen,
vom rechten au ssen. Der linke F u s s liegt v ollständiger vo r. Die
Zahlen für die Glieder der Zehen ergeben auch hier ohne den Mittelfu
ss, jedoch mit dem Klauengliede. bei der Daiimenzehe anfangend,
die Reihe 2. 3. 4. 5. 4. Die Daumzehe w a r die kürzeste, die vierte
Zehe die lä n g s te , die zwe ite von der ungefähren Länge der fünften
und die dritte Zehe stand auch in Länge zwischen der zweiten und
vie rten . .
Das Gestein ist weniger r e in , als die bei der Lithographie in
Anwendung kommenden Platten.
IIOMOEOS.AÜRUS MACRODACTYLUS.
Taf. XI. Fig. 5.
A. W .™ , i . Abh.«dl. d. ™tb. fW'-
der Akiid. /.u München, VI. 3 (1852).
S. 669. t. 18.
Diese Versteinernng fand sich zu Kelheim, wo sie in Besitz
des -eg e nwä rlig in Ueichenhall wohnenden Apothekers Mack ge-
la iw te , der die eine der beiden Platten dem Gerichtsarzte Dr. Hell
in T raunste in ü b erliess. Wagner u n tersuchte beide Platten und theilte
von der Mack-schen eine Abbildung init; meine Untersuchungen beruhen
au f der Platte des Herrn Dr. Hell, der die Gefälligkeit h alte
sie mir an zu v e rtra n cn , nnd die ich in der Abbildung wiedergebe.
Auf d ieser Pl.itlc findet sich die e tw a s g ewendete Oberseite des auf
der ändern Platte hängen g ebüebeiien, am h intern Eude gedruckten