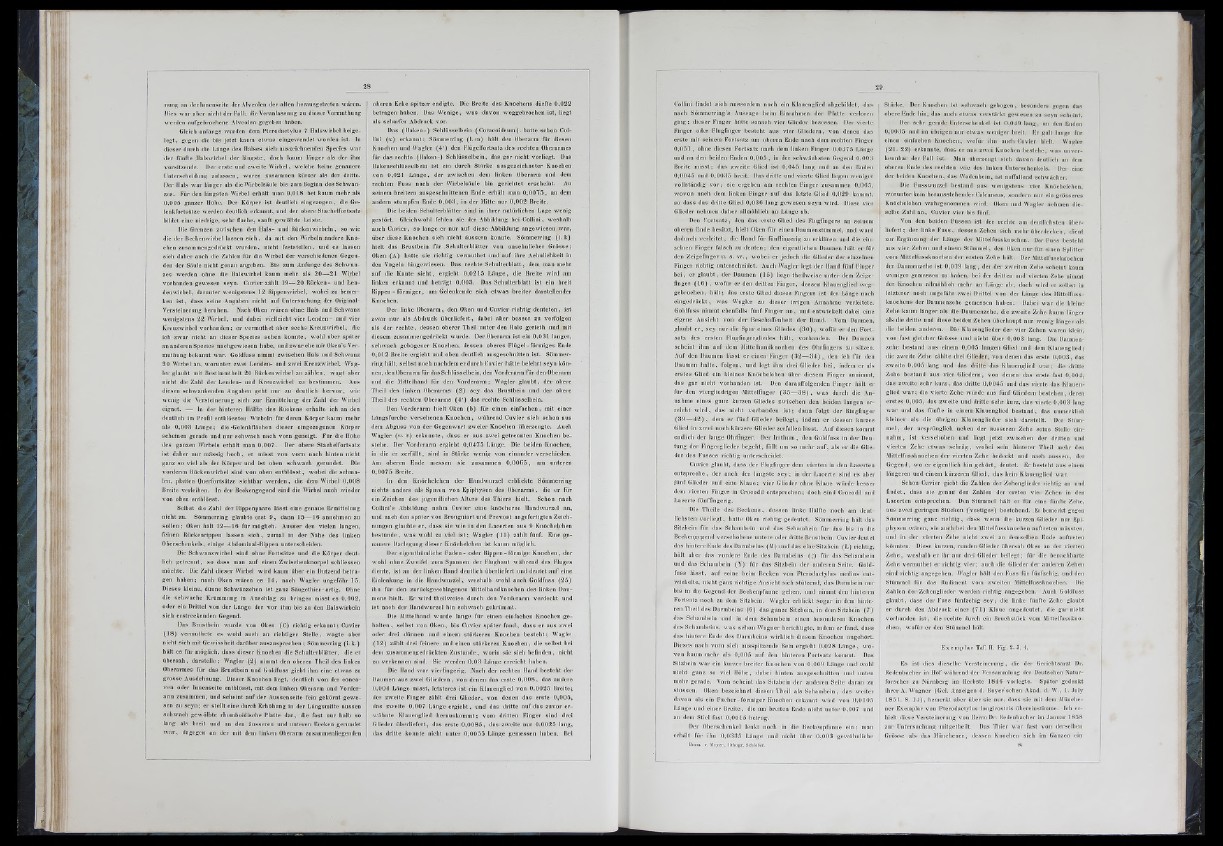
iiHiH
H"
É
Illing an ilprlnncnscife der Alveolen der allen lieraiisgefreten wären.
Dies war aber iiielil der Fall; die Veranlassung zu d ieser Vermiithiuig
werden niifgebroeliene .Alveolen gegeben haben.
(ileioii anraogs wurden dem Plerodaetyliis 7 FTaiswirbel beigelegl.
gegen die bis je tzt kaum e t« ’as eingewendel worden ist. In
d ieser diireli die Länge des Halses sieh nuszeichiienden Species war
der liinfte Halswirbel der län g ste , doch kaum länger als der ilini
Vorsitzende. Der e rste und zweite AV'irbel, welclie keine genauere
Unterscheidung ziilasseii. waren zusammen kürzer als der dritte.
Der Hals w a r länger als die Wirbelsäule bis zum Beginn des S chwanzes.
Für den längsten Wirbel erhält man 0 .0 1 8 bei kaum mehr als
0 .0 0 5 ganzer Höhe. Der Körper ist deutiicli eingezogen, die Gelenkfortsätze
werden deutlich erkannt, und der obere Stachelfortsalz
bildet eine niedrige, seh r (lache, san ft gewölbte Leiste.
Diu Grenzen zwischen den ü a is - und Uückenwirbeln, so wie
die der Ueckenwirbel lassen s ie h , da mit den Wirbeln andere Kno-
olien znsnmmeiigediückt w u rd e n , nichl feststellen , und es lassen
sicli daliiT auch die Znhlen für die Wirbel der verschiedenen Gegenden
der Säule nicht genau angeben. Bis zum Anfänge des Schwanzes
werden oliiie die Halswirbel kaum mehr a ls 2 0— 21 Wirbel
vorhanden gewesen seyn. Cuvicr zälilt 19— 2 0 Rücken- und Lendenwirbel,
darunter wen ig sten s 12 Rippenwirbel, wobei zu bemerken
is t, dass seine Angaben nicht .auf Untersuchung der Original-
Versteinerung beruhen. Nach Oken wären ohne Hals und Schwanz
w enigstens 2 2 Wirbel, und dabei vielleicht vier Len d en - und v ier
Krenzwirbel v orhanden: er vermuthet aber se ch s Kreiizwirbei, die
ich zwa r nicht an dieser Species sehen k onnte, wohl aber später
au anderen Speeies n a chgewiesen habe, und zw a r ehe mir Okeii’s Ver-
tmitinmg bekannt war. Goldfuss nimmt zwischen Hals und Schwanz
20 Wirbel an. woriinler zwei Lenden- und zwei Kreuzwirbel. Waglcr
glaubt mit Bestimmtheit 2 0 Rückenwirbel zu zäh len , w ag t aber
n icht die Zaiil der Lenden- und Kreuzwirbcl zu bestimmen. .Aus
diesen schwankenden Angaben g eh t nur zu deutlich h e rv o r , wie
wenig die Versteinerung sicli zur Ermittelung der Zahl der Wirbel
eignet. — In der hinteren Hälfte des Rückens e rhalte ich an den
deutlich im Profil entblössten Wirbeln für deren Körper kaum mehr
a ls 0 ,0 0 3 Länge: die'Gelenkiläehen d ieser eingezogenen Körper
scheinen gerade und nur schwa ch nach vo rn geneigt. F ü r die Höhe
des ganzen Wirbels e rh ä lt man 0 ,0 0 7 . Der obere Stachelfortsatz
is t daher mir massig h o ch , er misst vo n vorn nach hinten nicht
g anz 80 viel als der Körper und is t oben schwa ch gerundet. Die
vorderen Rückenwirbel sind von oben entblö.sst, wobei die schmalen.
platten Qoerfortsätze sich tb a r w e rd e n , die dem Wirbel 0 ,0 0 8
Breite verleihen. In der Beckengegend sind die Wirbel auch w ieder
von oben en tblösst.
Selbst die Zahl der Rippenpanre lä s s t eine genaue Ermittelung
n icht zu. Sömmerring glaubte e rs t 9 , dann 1 5— 16 annehmen zu
so llen ; Oken hält 12— 16 für möglich. Au sse r den vielen langen,
feinen Rückenrippen lassen s ic h , zumal in der Nähe des linken
Oberschenkels, einige Abdominal-Rippen unterscheiden.
Die Schwanzwirbel sind ohne Fo rtsä tz e und die Körper deutlich
g e tre n n t, so d a ss man a u f einen Zwischenknorpel schliessen
möchte. Die Zahi dieser Wirbel wird kaum über ein Dutzend b etragen
h ab en ; nach Oken w ären e s 1 4 , nach Waglcr ungefähr 15.
Dieses kleine, dünne Schwänzchen is t ganz Säiig e th ie r-a rtig . Ohne
die .schwache Krümmung in Anschlag zu bringen m is st e s 0 ,0 0 2 ,
oder ein Drittel von der Länge der v o r ihm bis zu den Halswirbeln
sich erstreckenden Gegend.
Das Brustbein wurde von Oken (C) richtig e rk a n n t; Cuvier
(1 8 ) vermnthete es wohl auch an rich tig er Stelle, w.igte aber
nicht sich mit Gewissheit darüber aiisziisprechen : Sömmerring (i. k.)
halt es für möglich, d.ass d ieser Knochen die Sc liu ltcib lälter, die er
ü b e rsa h , d a rs te llc ; Wagler (2 ) nimmt den oberen Theil des linken
Oberarmes für das Brustbein und Goldfuss g iebt ihm eine e tw as zu
g ro sse Ausdehnung. Dieser Knochen liegt, deutlich von der conca-
ven oder Innenseite en tb lö sst, mit dem linken Oberarm und Vorderarm
zusammen, und scheint a u f der .Aussenseite fein gek ö rn t g ewe sen
211 s e y n ; e r ste llt eine durch Erhöhung in der Längsmitte aussen
s chwa ch gewölbte rhomboidische Platte d a r, die fast nur halb so
lang als breit und an den ä u sseren nnd unteren Eeckcn gcriimiel
w a r . dagegen an der mit dein linken Oberarm zusammenliegenden
oberen Ecke sp itzer endigte. Die Breite des Knochens dürfte 0 ,0 2 2
betragen haben. Das Wenige, wa.s davon «cg g eb ro ch en ist, liegt
a ls scliarfer Abdruck vor.
Das (H a k en -) Schlüsselbein (Coracoideiim). h a tte schon Collini
(x ) e rk a n n t: Sömmerring (1. ni| hält den Oberarm für diesen
Kiioelien und Wagier ( 4 ‘) den Fliigelfortsatz des rechten Oberarmes
für das rechte (Haken-) Schlüsselbein, das g a r nicht v orliegt. Das
Bakeiischiiisscibein ist ein durch Stärke au sgezeichneter Knochen
von 0,021 Län g e , der zwischen dein linken Oberarm und dem
rechten Fiuss nach der Wirbelsäule hin g e richtet erscheint. An
seinem breitem au sgeschnittenen Ende e rh ä lt man 0 .0 0 7 5 , an dem
ändern stumpfen Endo 0 ,0 0 3 , in der Mitte nur 0 ,0 0 2 Breite.
Die beiden Schulterblätter sind in ih rer natürlichen Lage wenig
ge stö rt. Gleichwohl fehlen sie der Abbildung bei Collini, weshalb
auch Cu v ier, so lange er nur auf diese .Abbildiiiig an g ewiesen war,
über diese Knochen sich nicht äu ssern konnte. Sömmerring (i. k)
hielt das Brustbein für Schiilterblätter von ausehiiliclier G rö s s e ;
Oken (.A) h atte sie richtig v ermuthet und auf ihre .Aetuilichkeit in
den Vögeln liiiigewiesen. Das rechte Sch u lte rb latt, dem man mehr
a u f die Kante s ie h t, ergiebt 0 .0 2 1 5 L än g e , die Breite wird am
linken erk an n t nud beträgt 0.00 3 . Das Sch ulterblatt is t ein breit
Rippen - förmiger, am Gelenkeiide sich e tw a s breiter darstellender
Knochen.
Der linke Oberarm, den Oken und Cuvier rich tig d e u te te n , is t
zwa r n u r als Abdruck ü b e rliefert, dabei aber b e sser zu verfolgen
als der re c h te , dessen oberer Theil u n te r den Hals gerietii und mit
diesem zusamnieiigedrückt wurde. Der Oberarm is t ein 0,031 langer,
schwa ch gebogener Knoclien, dessen oberes Flügel - föriniges Ende
0 .0 1 2 Breite ergiebt und oben deutlich ausg esch n itten ist. Sünimer-
riiig hält, se ih st noch nachdem er durch Cuvier h ätte belehrt sey n können,
den Oberarm für das Schlüsselbein, den Vorderarm für den Oberarm
und die .Mittelhand für den Vorderarm; W.agler g la u b t, der obere
Theil des linken Oberarms (2 ) s e y das Brustbein und der obere
Theil des rechten Oberarms ( 4 ') das rech te Schlüsselbein.
Den Vorderarm hielt Oken (b) für einen e in fa ch en , mit einer
1.ängsfurclie verseh en en Knochen, wäh ren d Cuvier sich schon aus
dem Abguss von der Gegenwart zweier Knochen überzeugte. Auch
Wagler (i«- i4) e rk a n n te, dass er aus zwei g e trennten Knochen besteh
e. Der Vorderarm ergiebt 0 ,0 4 7 5 Länge. Die beiden Knochen,
in die er z erfä llt, sind in Stärke wenig von einander verschieden.
Am oberen Ende messen sie zusammen 0 ,0 0 6 5 , am unteren
0 ,0 0 7 5 Breite.
In den Knöchelchen der Handwurzel erblickte Sömmerring
nichts an d ers als Spuren von Epiphysen des O berarms, die er für
ein Zeichen des jugendlichen .Alters des Thiers hielt. Schon nach
Collini’s Abbildung nahm Cuvier eine knöcherne Handwurzel an,
und nach den sp ä te r von Brongniart und P ré v o s t angefcrtigteii Zeichnungen
glaubte e r, d a ss sie wie in den Lacerten ans 9 Knöchelchen
b e stü n d e, w a s wohl zu viel i s t ; Wagler (1 1 ) zählt fünf. Eine genauere
Darlegung d ieser Knöchelchen ist kaum möglichü
c r eigentliüinliehe Faden - oder Rippen - förmige K n o ch en , der
wohl ohne Zweifel zum Spannen der Flughaut « ’ährend des Fluges
diente, is t an der linken Hand deutlich überliefert und deutet a u f eine
Einlenkimg in die Handwurzel, wesh a lb wohl niicli Goldfuss (2 5 )
ilm für den znrückgeschlageiien .Mitteihandknochcn des linken Daumens
hielt. Er wird th e ilweise durch den Vorderarm verdeckt und
is t nach der Handwurzel hin schwa ch gekriiinint.
Die .Mittelhand wurde lange für einen einfachen Knochen geh
a lten , se ihst von Oken, bis Cuvier sp ä ter faiKl, d a ss er aus zwei
oder drei dünnen und einem stä rk eren Knochen b e s te llt; Wiigic’
(1 2 ) zählt drei feinere und einen stä rk eren Knochen, die se lb st bei
dem zusammengedrückten Z u s ta n d e , w orin sic sich befinden. nicht
zu verkennen sind. Sic werden 0 ,03 Länge e rreich t haben.
Die Hand w a r vicriingerig. Nach der rechten Hand bestellt der
Daumen aus zwei Gliedern, von denen das e rste 0 ,0 0 8 . das andere
0 .0 0 4 Länge misst, letzteres is t ein Klaiicnglictl von 0 .0 0 2 5 Breite;
der zweite Finger zählt drei Glieder, von denen das e rs te 0 ,0 0 5 ,
das zwe ite 0 ,0 0 7 Länge e rg ie lit, und das dritte auf das zuvor erwähnte
Klauenglied licraiiskommt ; vom dritten Finger sind drei
Glieder ü b e rliefert, das e rste 0 ,0 0 8 5 , das zwe ite nur 0 ,0 0 2 5 lang,
das dritte konnte nicht unter 0 ,0 0 5 5 Länge gemessen liaben. Bei
1 r
ili
(bollini findet sich aiisserdem noch ein Klauenglied ab g eb ild c l, das
nach Sömmerring's Aussage lieim Eini ahmen der l'lalte verloren
g in g ; d ieser Finger h ätte sonach vier Glieder b e sessen. Der vierte
Finger oder Fliigtinger besteht ans vier Gliedern, von denen das
e rs te mit seinem Forl.satz am oberen Ende nach dem rechten Finger
0,051 , ohne diesen Fortsatz nach dem linken Finger 0 ,0 4 7 5 Länge
und an den beiden Enden 0 ,0 0 5 , in der schwä ch s ten Gegend 0 .0 0 3
Breite m is s t; das zweite Glied is t 0 ,0 4 5 lang und an den Eiuicii
0 ,0 0 4 5 lind 0 ,0 0 3 5 breit. Das dritte und v ierte Glied liegen wenigei-
v ollständig v o r ; sie ergeben am rechten Finger zusammen 0,0 6 5 .
w o v o n nach dem linken Finger au f das letzte Glied 0 ,02 9 kommt,
so d a ss das d ritte Glied 0 ,0 3 6 lang g ewe sen seyn wird. Diese vier
Glieder nehmen dalier allmählich an Länge ab.
Den ¡ 'o r ls a lz , den das e rste Glied des Fliigfingers an seinem
oberen Ende besitzt, hielt Oken für einen Daumenstüniniel, und ward
dadurch v e rle ite t, die Hand für fünffingerig zu erklären und die einzelnen
Finger falsch zu d eu ten ; den eigentliclien Daumen hält er für
den Zeigefinger ii. s . w ., wobei e r jedoch die Glieder der einzelnen
Finger rich lig unterscheidet. Auch Wagler legt der Il.and fünf Finger
h e i, e r g lau b t, der Daumen (1 5 ) liege theilweise u n te r dem Zeigefinger
(1 6 ) , wofür e r den dritten Finger, d e ssen Klauenglied w e g geb
ro c h en . h ä lt; das e rs te Glied d ieses Fingers ist der Länge nach
e in g ed rü ck t, was Wagler zu dieser irrigen Annaliinc verleitete.
Gnidfiisa nimmt ebenfalls fünf Finger a n , und en twick e lt dabei eine
eigene Ansicht von der BcschalTenlieit der Hand. Vom Daumen,
glaubt e r, s e y n u r die Spur e ines Gliedes (3 0 ) , wofür er den Fo rtsa
tz des e rsten Flugfingeiglicdes h ä lt, vorhanden. Der Damnen
sclieint ihm au f dem .M ittelliandknochen des Ohifingcis zu sitzen.
Auf den Daumen l.ässt er einen Finger (3 2— 3 4 ) , den ich für den
Daumen h a lte, folgen, und legt ihm drei Glieder b e i, indem er .al.s
e rs te s Glied ein kleines Knöchelchen über diesem Finger annimmt,
d a s g a r nicht vorhanden ist. Den daraufrolgenden Finger liält er
für den viergliedrigen Mittelfinger (3 5— 3 8 ) , w a s durch die Aii-
nahiiie eines ganz kurzen Gliedes zwisclien den beiden langen erreich
t w ird , das n icht vorhanden i s t ; dann folgt der Ringfinger
( 3 9 - - 4 2 ) , dem er fünf Glieder b e ileg t, indem e r dessen kurzes
Glied in zwei noch kürzere Glieder zerfallen lä s s t. Auf diesen kommt
endlich der lange Ohrfinger. Der Irrth iiin , den Goldfuss in der Deutu
n g der Fingergliedcr b eg eh t, fällt um so mehr a u f, als er die Glieder
des F u s ses riclitig unterscheidet.
Cuvier glaubt, d a ss der Fliigfinger dem v ierten in den Lacerten
e n tsp re c h e , der auch der längste s e y ; in der Laeeriu sind es aber
fünf Glieder lind eine Klane; vier Glieder ohne Klaue würde besser
dem v ierten Finger in Crocodil en tsp re c h en ; doch sind Crocodil und
Lac erte fünffingerig.
Die Theile des B e ck en s, d e ssen Ünkc lläifte noch am deiil-
lielisten v o riie g t, h atte Oken richtig geduiitct. SöinmiTiina hält das
Sitzbein für das Seliambein und das Seliiiiiibeiu für das bis in die
Beckciigegeuil v e rsehnbeuc un te re oder dritte Brustbein. Cuvier deutet
das hintere Ende des Darmbeins (.M) und das eine Sitzbein (L) richtig,
hält aber das v o rd ere Ende des Darmbeins (■:) für das Schambein
und das Schambein (Y) für das Sitzbein der anderen Seile. Gold-
fiiss lä s s t, au f seine beim Becken von Pterodactylus medius entwickelte,
nicht ganz riclitige Ansicht sich sliitzeiul, das Darmbein mir
bis in die Gegend der Beckenpfaniic g eh en , uiul nimmt den hiiilcren
Fort.salz noeli zu dem Sitzbein. Waglcr erblickt so g a r in dem liinle-
rcn Theil des Darmbeins (6 ) das g anze Sitzbein, in dem Sitzbein (7 )
das Schambein und in dem Schambein einen besonderen Knochen
des Scliambeins. « as schon AVagner berichtigte, indem er fand, dass
das hintere Ende des Darmbeins wirklich diesem Knochen angehört.
Dieses iiacIi vorn sich luisspilzciidc Bein ergiebt 0 .0 2 8 Län g e , w o vo
n kaum mehr als 0 ,0 0 5 au f den liintercn Fo rtsa tz kommt. Das
Sitzbein w a r ein kurzer b reiter Knochen von 0 ,0 0 9 Länge und wohl
nielit g anz so viel Höhe, dabei hinten ausgeschnitten und iinten
mehr gerade. Vorn sclieint das Sitzbein der anderen Seile daran zn
slo ssü ii. Oken bezeichnet diesen Theil als Schambein, das weiter
davon a ls ein Fä ch er-förm ig e r Knoclien erkamit wird von 0 ,0 1 0 5
Länge und einer Bre ite, die am breitcii Ende nicht u n te r 0 ,0 0 7 und
an dem Stiel fast 0 ,0 0 1 5 betrug.
Der Ohersclicnkel lenkt noeli in die Bcckcnpfaniie e in ; mau
erh ä lt für ihn 0 ,0 3 3 5 Länge und nielli über 0 ,0 0 3 gewöhnliclie
Ikrm. V. .Ikjc'r, lilliogr. Scliletur.
Stärke. Der Knoclien is t schwa ch g e bogen, besonders gegen das
obere Ende hin, das auch e tw a s ve rstärk t gewe sen zu seyn scheint.
Der seh r gerade Unterschenkel ist 0 ,0 4 9 lau g , an den Enden
0 ,0 0 3 5 und im übrigen nur e tw as weniger breit. Er galt lange für
einen cinfaclien Kiiuclicn, wofür ihn aiieli Cuvier hielt. W»g|er
(2 1 . 2 2 ) e rkannte, das» er aus zwei Knochen be steh e , was iinver-
keniibar der Fall i.st. Man überzeugt sieh davon deutlich an dem
oberen Ende des rechten wie des linken I ntersehenkcis. Der eine
der beiden Knochen, das Wadenbein, ist aiilfallend sehwäelier.
Die Fu s swmzc l bestand aus weiiigsleiis vier Knöelielebcn,
worunter kein herausstetieiiiier Calcaneiis, sonclei ii nur ein g rö ssere s
Knöchelclien walirgenommeii wird. Oken und Wagler nehmen dieselbe
Zahl a n , Cuvicr v ier bis fünf.
Von den beiden Füssen ist der rechte am deiitliehsten iihcr-
lie fert; der linke F u s s , dessen Zehen sicli melir nbeideckeii, dient
zur Ergänzung der Länge der .Mittelfiisskiioeiien. Her Fuss b e sieht
aus vier Zehen und einem Sliimmei, den Oken mir für einen S)>!itter
vom Miltelfiisskiioclieii der e rsten Zehe hält. Der .Mitleifiisskiloclien
der Daiimenzehe is t 0 ,0 1 9 la n g , der der zweiten Zclie scheint kaum
weniger gemessen zn haben, hei der dritten und vierten Zehe nimmt
der Knochen allmählich mehr an Länge a b , doch wird er seihst in
letzterer noeli imgefähr zwei Dritte! von der Länge des Mitteifuss-
knocliens der Daiimenzehe gemessen haben. Dabei w a r die kleine
Zehe kanin länger als die Daiimenzehe, die zwe ite Zehe kaum länger
als die dritte und diese beiden Zehen iiherliaiipt nur wenig länger aks
die beiden anderen. Die Klaiienglieder der v ier Zehen waren klein,
von fast gleielier Grösse und nicht über 0 ,0 0 3 lang. Die Daimien-
zche bestand aus einem 0 ,0 0 5 langen Glied und dem Klauenglied;
die zwe ite Zehe zählte drei Glieder, von denen das e rste 0 ,0 0 3 , das
zweite 0 ,0 0 5 lang nnd d.as dritte das Klauenglied w a r ; die dritte
Zehe bestand aus vier Gliedern, von denen das e rste fast 0 ,0 0 4 ,
das zweite se h r ku rz, das dritte 0 ,0 0 4 5 und das v ierte das Klauenglied
w a r ; die v ierte Zehe würde aus fünf Gliedern be steh en , deren
e rs te s 0 ,0 0 5 , das zwe ite und dritte seiir kurz, das v ierte 0 ,0 0 3 lang
w a r und das fünfte in einem Klauenglied b e stan d , das unmerklich
kleiner a ls die übrigen Klaiienglieder sich darslellt. Der Stümm
e l, der ursprünglich neben der ä u sseren Zehe seine Stelle ein-
n ahm , is t verscliohen und liegt je tz t zwischen der dritten und
v ierten Zehe e tw a s s c h rä g , wobei sein liiiiterer Theii mehr den
.Miltelfussknoclieii der v ierten Zehe bedeckt und nach a u s s e n , der
Gegend, wo er eigcnllicli liin g e h ö rt, deutet. Er hesleht aus einem
längeren und einem kürzeren Glied, das kein Klauenglied war.
Schon Cuvier giebt die Zaliien der Zeliengiieder richtig an und
. findet, d a ss sie genau den Zahlen der e rsten vier Zehen in den
I Laccrten entsprechen. Den Stümmel liält er für eine fünfte Zehe,
' aus zwei geringen Stücken (v e s tig e s ) bestehend. Er bemerkt gegen
! Sömmerring ganz rich tig , dass wenn die kurzen Glieder nur Epiphysen
wären , sie auch bei den Mitteifussknoehen auftreten müssten,
«nd in der v ierten Zehe nicht zwei an demselben Ende auftrctcii
könnten. Diese kurzen, runden Glieder übersah Oken an der vierten
Zeh e , wcsiialb e r ihr mir drei Glieder beilegt; für die benachbarte
Zclic v e rmu th et er riclitig v ie r; auch die Glieder der anderen Zehen
sind richtig angegeben. Wagier hält den Fu s s für fünfzeilig, und den
Stüminel für das Rudiment vom zweiten .M ittelfussknoclien. Die
Zaiilen der Zehcngliedcr werden richlig angegeben. Auch Goldfuss
g la u b t, dass der Fuss fünfzehig se y ; die linke fünfte Zehe glaubt
er durch den Abdruck e iner (7 1 ) Kl.nie an g ed cu fe l, die gar nicht
vorhanden i s t , die rech te durch ein Bruchstück vom .Mittelfusskno-
chcii, w ofür er den Stümmel hält.
E .x em p la r Taf. II. Fig. 2. 3. 4.
Es is t dies dieselbe Versteinerung, die der Gerichtsarzt Dr.
Kedenbacher in Hof während der Ver.sanimlung der Deutschen Nalur-
forscher zu Nürnberg im Herbste 1 846 vorlcgte. Später gedenkt
ihrer A. Wagner (Gel. Anzeigen d. Bayer'sclieii Akad. d. W., I . .luly
1851. S. 1 4 ) , bemerkt aliur über sie nur. dass sie mit dem .Müuche-
ncr Exemplar von Plcrodaclylus longirostris ilberein.stiinine. Ich er-
hiclt diese Versteinerung von Herrn Dr. Rcdcnbaclicr im Jan u ar 1858
zur Untersuchung niitgetlieüt. Das Thier w a r fast von derselben
Grösse als das .Münclicncr, dessen Knochen sich im Ganzen eia