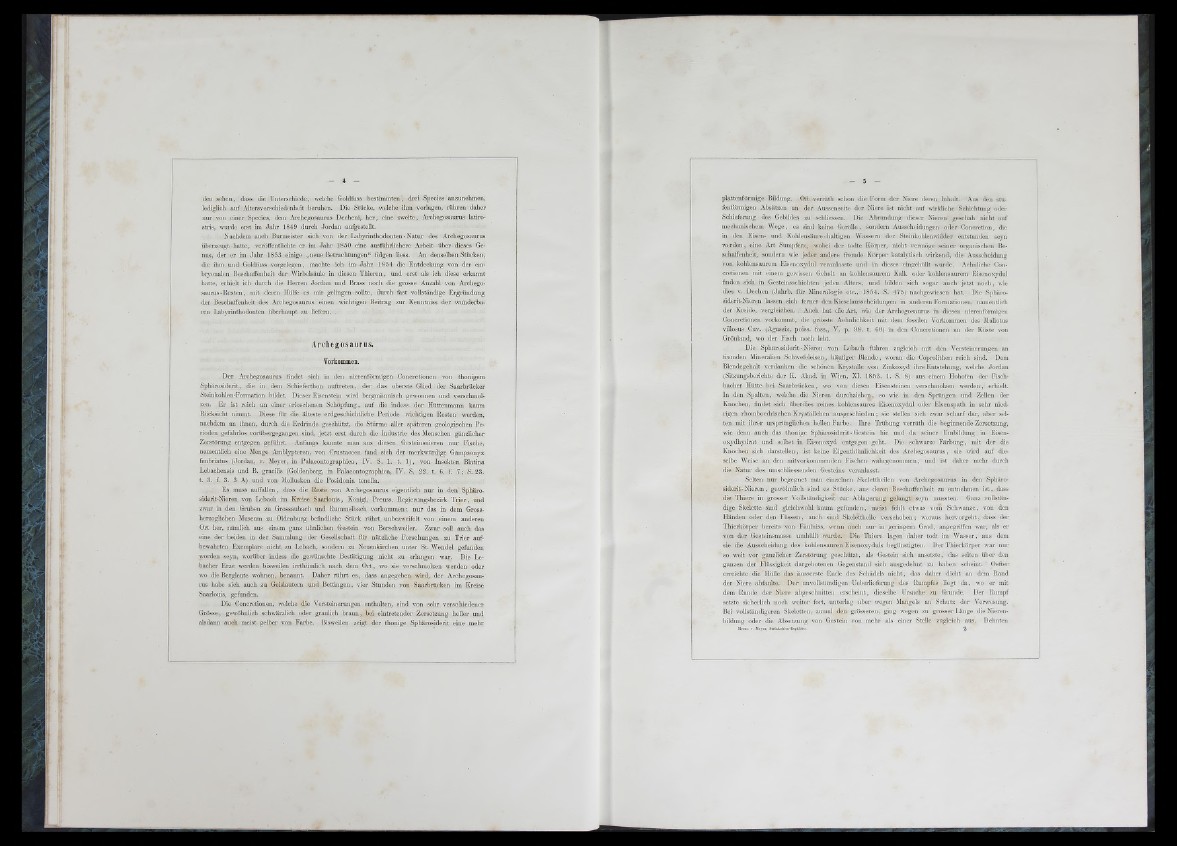
- 4 -
den sehen, dass die Unterschiede, welche Goldfuss bestimmten, drei Species anzunehmen,
lediglich auf Altereverechiedenhcit beruhen. Die Stücke, welche ihm Vorlagen, nihren daher
nur von einer Speeles, dem Ai-cheg;os!iui'us Decheni, her, eine zweite, Archegosaurus latiro-
stris, wurde erst im Jah r 1849 dm-cli Joi-dan aufgestellt.
Nachdem auch Bmnneister sich von der Labyrintbodonten-Natur des Archegosaiu-us
iibeiY.eugt hatte, veröffentlichte er im Jah r 1850 eine ausfiihrlichere Arbeit Uber dieses Genus,
der er im Jah r 1853 einige „neue Betrachtungen“ folgen Hess. An denselben Stücken,
die ihm und Goldl'uss Vorgelegen, machte ich im Jah r 1854 die Eutdeckung von der embryonalen
Beseliatfenheit der Wh'belsäule in diesen T bieren, und eret als ich diese erkannt
hatte, erhielt ich durch die Herren Jordan und Brass noch die grosse Anzalil von Archego-
saurus-R esten, mit dei-eu Hülfe es mh' gelingen sollte, durch fast vollständige Ergründuiig
der Beschaffenheit des Archegosaurus einen wichtigen Beitrag zur Kenntniss der wunderbaren
Labyrintbodonten überhaupt zu liefern. .
A r c h e g o s a u r u s .
VorkommeD.
Der Archegosaurus findet sich in den nierenföitnigen Concretionen von thonigem
Sphärosiderit, die in dem Schieferthon auftreten, der das oberste Glied der Saarbrücker
Steinkohlen-Fonnation bildet. Dieser Eisenstein wird berginänniseh gewonnen und verschmolzen.
Er ist reich an einer erloschenen Schöpfung, auf die inde.ss der Hüttenmann kaum
Rücksicht nimmt. Diese für die älteste erdgescbiclitliche Periode wichtigen Resten werden,
nachdem an ihnen, durch die Erdrinde geschützt, die Stürme aller späteren geologischen Perioden
gefahrlos vorübergegangen sind, jetzt erst durch die Industrie des Menschen gänzlicher
Zerstörmig entgegen geführt. Anfangs kannte man aus diesen Gesteinsnieren nur Fische,
namentlich eine Menge Amblj-pteren, von Crustaceen fand sich der merkwürdige Gampsonj’x
fimbriatus (Jordan, v. Meyer, in Palaeontographica, IV. S. 1. t. 1), von Insekten Blatina
Lebachensis und B. gracilis (Goldenberg, in Palaeontographica, IV. S. 22. t. 6. f. 7; S. 23.
t. 3. f. 3. 3 A) und von Mollusken die Posidonia tenella.
Es muss auffalien, dass die Reste von Archegosaurus eigentlich nur in den Sphäre-
siderit-Nieren von Lebach im Kreise Saarloiiis, Königl. Preuss. Regierungsbezirk T rier, und
zwar in den Gruben zu Grossaubach und Rummelbach Vorkommen ; nur das in dem Gross-
herzoglicben Museum zu Oldenburg befindliche Stück rührt unbezweifelt von einem anderen
Ort her, nämlich aus einem ganz ähnlichen Gestein von Berschweiler. Zwar soll auch das
eine der beiden in der Sammlung der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier auf-
bewahrteu Exemplare nicht zu Lebach, sondern zu Neuenkirchen unter St. Wendel gefunden
worden seyn, worüber indess die gewünschte Bestätigung nicht zu erlangen war. Die Le-
bacher Erze werden bisweilen iiTthumlich nach dem O rt, wo sie verschmolzen werden oder
wo die Bergleute wohnen, benannt. Daher rührt e s , dass angegeben wird, der Archegosaurus
habe sich auch zu Geislautern und Bettingen, vier Stunden von Saarbiücken im Kreise
Saarlouis, gefunden.
Die Concretionen, welche die Versteinerungen enthalten, sind von sehr verscliiedener
Grösse, gewöhnlich schwärzlich oder graulich braun, bei eintretender Zersetzung heller und
alsdann auch meist gelber von Farbe. Bisweilen zeigt der thonige Sphärosiderit eine mehr
plattenfönnigc Bildung. Ott verrätli schon die Form der Niere deren Inlialt. Aus den stu-
feiifbi-migen Absätzen an der Aussenseite der Niei-e ist nicht auf wirkliche Schichtung oder
Schieterung des Gebildes zu scliliessen. Die Abi'imdung dieser Nieren geschah nicht auf
mechanischem W ege, es sind keine Gerölle, sondern Aasscheidungen oder Concretion, die
in den Eisen- und Kohlensäure-haltigen Wassern der Steinkolilenwälder entstanden seyn
w erden, eine A rt Sumpfei-z, wobei der toclte Körper, nicht vennöge seiner oi'ganischen Beschaffenheit,
sondern wie jeder andere fremde Köi'per katalytisch wirkend, die Aiissclieidung
von kobleiisaurem Eisciio.xydul veranlasste und in dieses eingehüllt wurde. Aelmliche Con-
cretionen mit einem gewissen Gehalt an kohlcnsnurcm Kalk oder kohlensaiirem Eisenoxydul
finden sich in Gesteinsschichten jeden A ltere, und bilden sich sogai- auch jetzt noch, wie
dies V. Dechen (Jahrb. iür Mineralogie etc., 1854. S. 475) nachgewiesen hat. Die S|)häro-
siderit-Nierun lassen sich ferner den Kieselausseheidungen in anderen Formationen, namentlich
der Kreide, vergleichen. Auch hat die Art, wie der Archegosaurus in diesen nierenförmigeii
Concretionen vorkommt, die grösste Aehnlichkeit mit dem fossilen Vorkommen des Mallotus
villosus Cuv. (Agassiz, poiss. foss., V. p. 98. t. 60) in den Concretionen an der Küste von
Grönland, wo der Fisch noch lebt.
Die Sphärosiderit-Nieren von Lebach führen zugleich mit den Versteinerungen an
fremden Mineralien Sohwefeleisen, häufiger Blende, woran die Coprolithen reich sind. Dem
Blenclegehalt verdanken die schönen Krystalle von Zm koxjü ihre Entstehung, welche Jordan
(Sitzungsberichte der K. Akad. in Wien, XI. 1853. 1. S. 8) aus einem Hohofen der Fischbacher
Hütte bei Saarbrücken, wo von diesen Eisensteinen vei-schmolzen werden, erhielt.
In den Spalten, welche die Nieren dui'cbzieben, so ^v•ie in den Spriingen und Zellen der
Knochen, findet sich überdies reines kohlensaures Eisenoxydul oder Eisenspath m sehr niedrigen
rhoinboedi-ischen Kryställclien ausgescliieden; sie stellen sich z^var scharf dar, aber selten
mit ihrer ui-spriüiglicheu hellen Farbe. Ihre Trübung verräth die beginnende Zersetzung,
wie denn auch das thonige Sphärosiderit-Gestein hie und da seiner Umbildung in Eisen-
oxydhydi-at und selbst in Eisenoxyd entgegen gellt. Die schwarze Färbung, mit der die
Knocbeu sich darstcUcn, ist keine Eigentliüinlichlveit des Ai-chegosaurus, sie vvii'd auf dieselbe
Weise an den mirtorkommeuden Fisclien wahrgenommen, und ist daher mehr durch
die Natiu' des umsclilicsseiiden Gesteins veranlasst.
Selten nur begegnet man einzelnen Skelettheileii von Archegosaurus in den Sphärosiderit
N ieren, gewöhnlich sind cs Stücke, aus deren Beschaffenheit zu entnehmen ist, dass
die Thiere in grösser ^’ollstäudigkeit zur Ablagerung gelangt seyn mussten. Ganz vollständige
Skelette sind gleichwohl kaum gefunden, meist fehlt etwas vom Schwänze, von den
Händen oder den Füssen, auch sind Skelettheile verschoben; woraus hervorgeht, dass der
Thierkörper bereits von Fäulniss, wenn auch nur in geringem Grad, angegriffen war, als er
von der Gestelnsmasso umhüllt wurde. Die Thiere lagen daher todt im Wasser, aus dem
sie die Ausscheidimg des kohlensauren Eisenoxyduls begünstigten. Der Thierkörper war nur
so weit vor gänzlicher Zeretorung geschützt, als Gestein sich aiisetzte, das selten Uber den
ganzen der Flüssigkeit dargebotenen Gegenstand sich ausgedehnt zu haben scheint. Oeftei'
erreichte die Hülle das äusserete Ende des Schädels nicht, das daher dicht an dem Rand
der Niere abfaulte. Der unvollständigen Ucberliefermig des Rumpfes Hegt d a , wo er mit
dein Rande der Niere abgcselmitteu erscheint, dieselbe Ursache zu Grunde. Der Rumpf
setzte sicherlich nocli weiter fort, unterlag aber wegen Mangels an Schutz der Venvesung.
l^ei vollständigeren Skeletten, zumal den grösseren, ging wegen zu grösser Länge die Nieren-
bilduiig oder die Absetzung von Gestein von mehr als einer Stelle zugleich aus. Dehnten
Ilvn., V 2