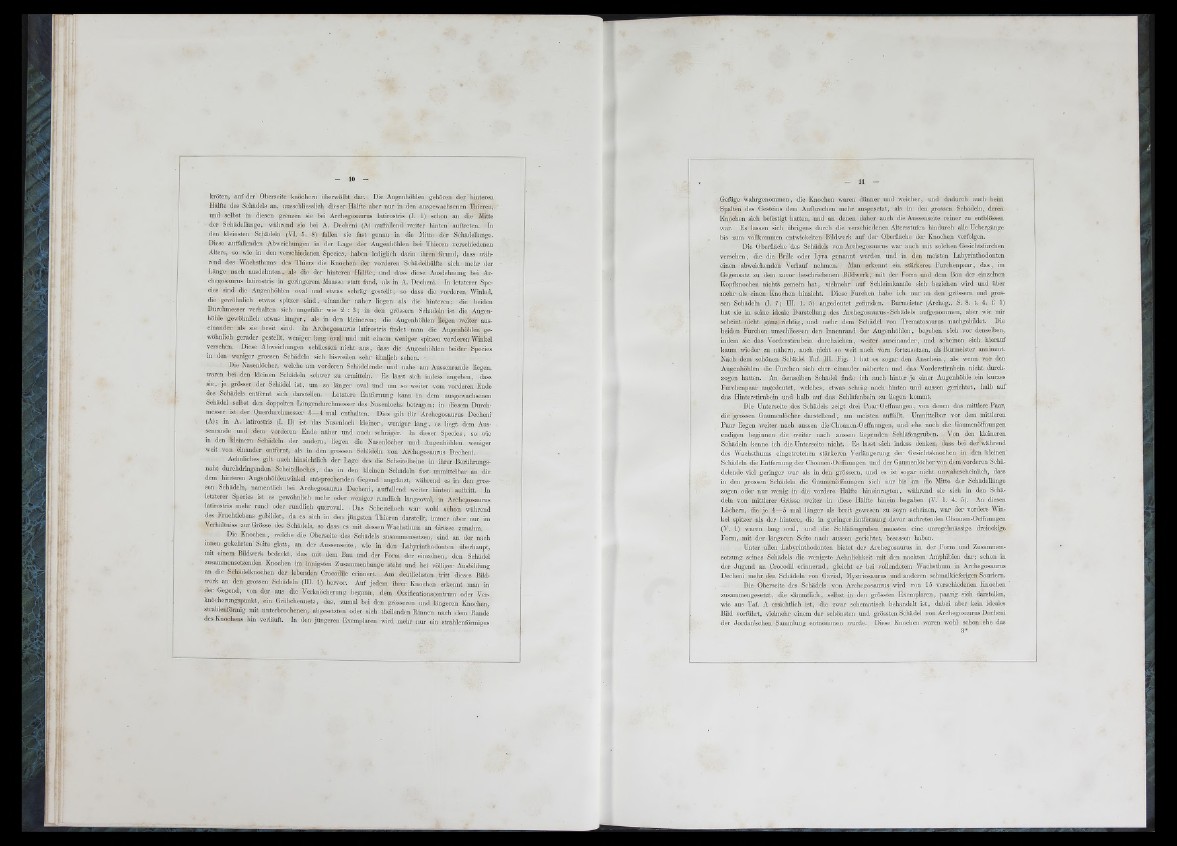
ki-öten, auf der Oberseite knöchern übei-wölbt dar. Die Augenhöhlen gehören der hinteren
Hälfte des Schädels an, ausschliesslich dieser Hälfte aber nur in den ausgewachsenen Thieren, '
und selbst in diesen grenzen sie bei Archegosauras latirosftis (I. 1) schon an die Mitte
der ScliHdellänge, wiilircnd sie bei A. Decheni (A) auffallend weiter hinten aufb-cten. In
den kleinsten Sciiädeln (TT. 5, 8) fallen sie fast genau in die Mitte der Scliädellänge.
Diese auffallenden Abweicluingcii in der Lage der Augenhöhlen bei Thieren verschiedenen
Alters, so -wie in den verschiedenen Species, haben lediglich darin iluen Grand, dass wählend
des TVachstluiins des Thiei's die Knochen der vorderen SchädeDiälfte sich mehr der
Länge nach ausdehnteii, als die der hinteren H älfte, und dass diese Ausdehnung bei Archegosaurus
latirostris in geringerem Maasse statt fand, als in A. Decheni. In letzterer Species
sind die Augenhöhlen oval und etwas schräg gestellt-, so dass die vorderen TVinkcl,
die gc-wühnlicli ebvas spitzer sind, einander näher liegen als die hinteren; die beiden
Durchmesser verhalten sich ungefähr wie 2 : 3 ; in den gi-össern Schädeln ist die Augenhöhle
gewöhnlich etwas länger, als in den kleineren; die Augenhöhlen liegen weiter auseinander
als sie breit sind. In Archegosaurus latirostris findet man die Augenhöhlen ge-
wölmlich gerader gestellt, weniger lang oval und mit einem weniger spitzen vorderen TVinkel
versehen. Diese Abweichungen scliUessen nicht aus, dass die Augenhölilen beider Species
in den weniger grossen Schädeln sich bisweilen sehr ähnlich sehen.
Die Nasenlöcher, welche am vorderen Schädelende und nahe am Aussenrandc liegen,
waren bei den kleinen Schädeln scliwer zu ennitteln. Es lässt sich indess angeben, dass
sie, je grösser der Schädel ist, um so länger oval und um so weiter vom vorderen Ende
des Scliädels entfernt sich daretellen. Letztere Entfcraung kann in dem ausgewachsenen
Schädel selbst den doppelten Längendurehmesser des Nasenlochs betragen; in diesem Durchmesser
ist der Querdurchmesscr 3 - 4 mal enthalten. Dies gilt für Arciiegosaurus Decheni
(A); in A. latirosüis (I. II) ist das Nasenloch kleiner, weniger lang, es liegt dem Aus-
senrande und dem vorderen Ende näher und auch schräger. In dieser Species, so wie
in den kleinern Schädeln der ändern, liegen die Nasenlöcher und Augenhöhlen weniger
weit von einander entfernt, als in den grossen Schädebi von Archegosaurus Decheni.
Aehnliches gilt auch liinsiclitlich der Lage des die Scheitelbeine in ihrer Berülu-ungs-
naht durchdringenden ScheiteEoches, das in den kleinen Schädeln fast unmittelbar an die
dem hinteren Augenhöhlenwiiikel entsprechenden Gegend aiigränzt, während es in den grossen
Schädeb, namentlicli bei Archegosauras Decheni, auffallend iveiter hinten aufti-itt. In
letzterer Species ist es gewöhnlich mehr oder weniger ruiidlicli längsoval, in Archegosaurus
latirostris mehr rund oder rundlich queroval. • Das Scheitclloch w ar wohl schon während
des Fruchtlcbens gebildet, da es sich in den jüngsten Thieren darstellt, immer aber nur im
Verhältiiiss zur Grösse des-Schädels, so dass es mit dessen TVachsthura an Grösse zunahm.
Die Knochen, w-elche die Oberseite des Schädels zusammeiisetzen, sind an der nach
innen gekehrten'Seite glatt, an der Aussenseite, wie in den Labyrintbodonten überhaupt,
mit einem Bildwerk bedeckt, das mit dem Bau und der Form der einzelnen, den Schädel
zusammensetzenden Knochen im innigsten Zusammenhänge steht und bei völliger Ausbildung
an die Schädelknochen der lebenden Crocodile erinnert. Am deutliclisten tritt dieses Bildwerk
an den grossen Schädeln (TU. 1) hervor. A uf jedem ihrer Knochen erkennt man in
der Gegend, von der aus die Verknöcherung begann, dem Ossificationscentrum oder Ver-
knöcherangspunkt, ein Grübchermetz, das, zumal bei den grösseren und längeren Knochen,
strahlenförmig mit unterbrochenen, abgesetzten oder sich theilcndeii Rinnen nacli dem Rande
des Knochens liin verläuft. In den jüngeren Exemplaren wird mehr nur ein strahlenföi-miges
- 11 -
Geftigc wahrgenommen, die Knochen waren dünner und weicher, und dadureh auch beim
Spalten des Gesteins dem Aufbrechen mehr ausgesetzt, als in den grossen Schädeln, deren
Knochen sich befestigt hatten, und an denen daher auch die Aussenseite reiner zu entblössen
■war. Es lassen sich übrigens durch die verscluedeneii Altersstufen hindurch alle Uebergänge
bis zum vollkommen entwickelten Bildwerk auf der Oberfläche der Knochen verfolgen.
Die Oberfläche des Schädels von Archegosaurus war auch mit solchen Gesichtsfurchen
versehen, die die Brille oder Lyra genannt werden und in den meisten Labyrintbodonten
einen abweichenden Verlauf nehmen. Man erkennt ein stärkeres Furchenpaar, das, im
Gegensatz zu dem zuvor beschriebenen Bildwei-k, m it der Form und dem Bau der-einzelnen
Kopfknochen nichts gemein b at, vielmehr auf Schleimkanäle sich beziehen wird und über
mehr als einen Knochen hinzicht. Diese Furchen habe ich nur an den grösscm und grossen
Schädehi (I. 7; III. 1. 5) angedoutet gefunden. Burmcister (Archeg., S. 8. t. 4. f. 1)
hat sie in seine ideale Darstellung des Archegosauras-Schädels aufgenommen, aber wie mir
scheint nicht ganz richtig, und mehr dem Schädel von Treinarösaurus nachgebildet. Die
beiden Furchen umschliessen den Innenrand der Augenhöhlen, begeben sich vor denselben,
indem sie das Vorderstirnbein durchziehen, weiter auseinander, und scheinen sich hierauf
kaum wieder zu nähern, auch nicht so weit nach vom fortzusetzen, als Buiineister annimmt.
Nach dem schönen Sehadel Taf. HI. Fig. 1 hat es sogar den Anschein, als wenn vor den
Augenhöhlen die Fm'chen sieh eher einander naheiäen und das Vorderstimbein nicht dui'ch-
zogen hatten. An demselben Schädel finde ich auch hinter je einer Augenhöhle ein kurzes
Fui'chenpaar angedcutet, welches, etwas schräg nach hinten und aussen gerichtet, halb auf
das Hinterstimbein und halb auf das Schläfenbein zu liegen kommt.
Die Unterseite des Schädels zeigt drei P aar Oeffiiungen, von denen das mittlere Paar,
die grossen Gaumenlöcher daretellend, am meisten auffällt. Unmittelbar vor dem mittleren
P aar liegen weiter nach aussen die Cboanen-Oeffhungcn, mid ehe noch die Gaumeiiöffiiungen
endigen beginnen die weiter nach aussen liegenden Schläfengruben. Von den kleineren
Schädehi kemie ich die Unterseite nicht. Es lässt sich indess denken, dass bei der während
des TVacbsthums eingetreteneu stärkeren T'erlängerung der Gesiclitsknochen in den kleinen
Schädeln die Entfernung der Choanen-Oeffuungcii und dei- Gaumenlöcher von dem vorderen Schädelende
viel geringer war als in den gi-össern, und es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass
in den grossen Schädeln die Gaumenöffiiungen sich nui- bis an die Mitte der Schädellänge
zogen oder nur wenig in die vordere Hälfte hineinragten, während sie sich in den Schädeln
von mittlerer Grösse weiter in diese Hälfte hinein begaben (V. 1. 4. 5). An diesen
Löchern, die je 4—5 mal länger als breit gewesen zu se}m scheinen, war der vordere TVin-
kel spitzer als der hintere, die in geringer Entfernung davor auftretenden Choaneii-Oeffiiungen
(V. 1) wai-en lang oval, und die Schläfengruben mussten eine unregelmässige dreieckige
Form, m it der längeren Seite nach aussen gerichtet, besessen haben.
Unter allen Labyrinthodonteii bietet der Ai-chegosaurus in der Form und Zusammensetzung
seines Schädels die wenigste Aehnlichkeit mit den nackten Amphibien dar; schon in
der Jugend an Crocodil eriniierud, gleicht er bei vollendetem TVachsthum in Ai-chegosaurus
Deeheni mehr den Schädeln von Gavial, Mystriosaiu-us und anderen sehmalkieferigen Sauriera.
Die Obei-seite des Schädels von Archegosam-us wird von 15 verschiedenen Knochen
zusammengesetzt, die säimntUch, selbst in den gi-össten Exemplaren, paarig sich darstellen,
wie aus Taf. A ei-sichtlich ist, die zwar schematisch behandelt ist, dabei aber kein ideales
Bild voifülirt, viehnebr einem der schönsten und grössten Schädel von Arciiegosaurus Decheni
der Jordan’schen Saimnluug entnommen wurde. Diese Knoclien waren wolil schon ehe das
3 ‘