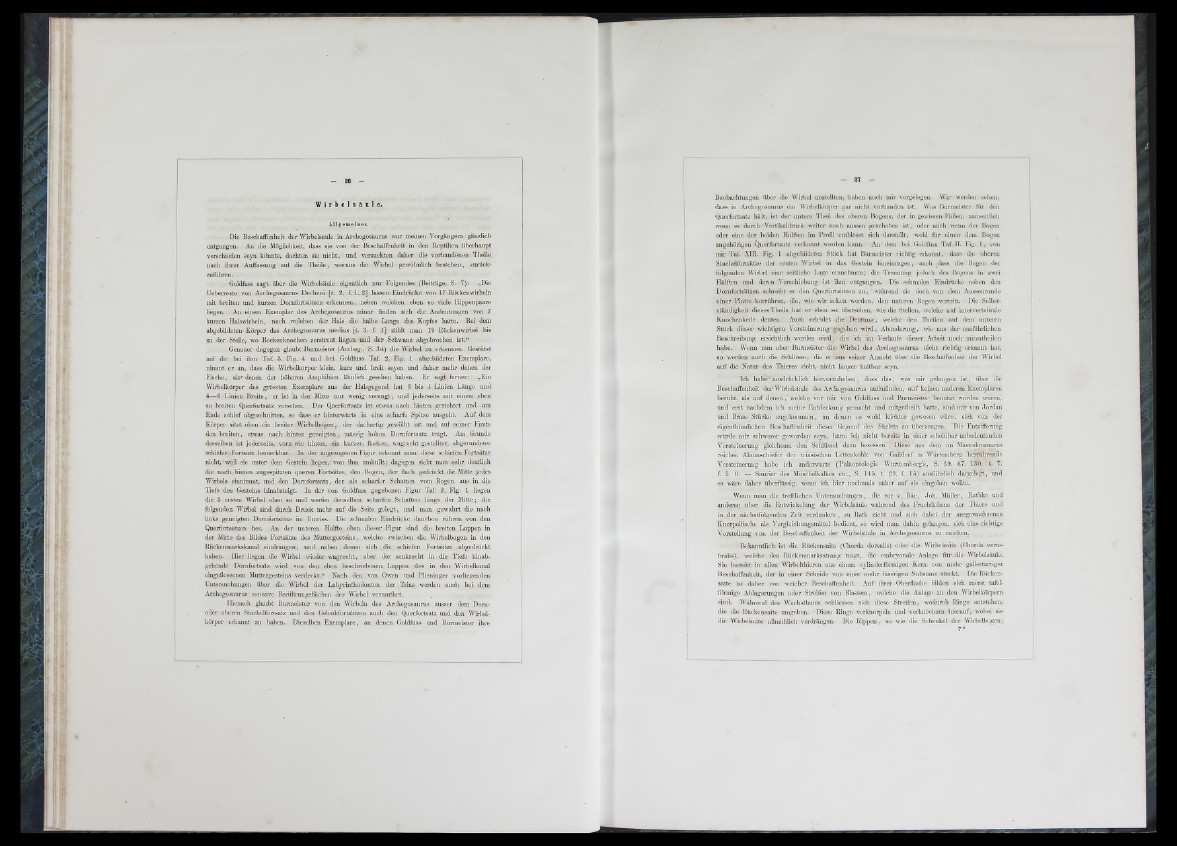
W i r b e I s I u 1 e.
A l l g o ü i e i c e s .
Die Beschaffenheit der Wirbelsäule in Ai'cbegosaurus war meinen Vorgängen
entgangen. An die Möglichkeit, dass sie von der Beschaffenheit in den Reptilien überhaupt
vei-schieden seyn könnte, dachten sie nicht, und vei-suchten daher die vorhandenen Theile
nach ihrer Auffassung auf die Theile, woraus die Wirbel gewölmlich bestehen, zurück-
zufiibren.G
oldfuss sagt Uber die Wirbelsäule eigentlich nur Folgendes (Beiträge, S. 7): „Die
Ueberreste von Ai-chegosaurus Decheni [t. 2. f. 1. 2] lassen Eindrücke von 17 Rückenwirbeln
mit breiten und kurzen Dornfortsätzen erkennen, neben welchen eben so viele Rippenpaare
liegen. An einem Exemplar des Archegosamnas minor finden sich die Andeutungen von 7
kui-zen Halswirbeln, nach welchen der Hals die halbe Länge des Kopfes hatte. Bei dem
abgebildeten Körper des Archegosam-us medius [t. 3. f. 1] zählt man 19 Rückemvirbel bis
zu der Stelle, wo Beckenknochen zerstreut liegen und der Schwanz abgebrochen ist.“
Genauer dagegen glaubt Bui-meister (Ai-cheg., S. 34) die Wirbel zu erkennen. Gestützt
auf die bei ihm Taf. 3. Fig. 4 und bei Goldfuss Taf. 2. Fig. 1 abgebildeten Exemplare,
nimmt er an, dass die Wirbelkörper klein, kurz und breit seyen und dabei- mehr denen der
Fische, als’ denen der höheren Amphibien ähnlich gesehen haben. E r sagt iem er: „Ein
Wlrbelkörpci- des grössten Exemplars aus der Halsgeg.end hat 3 bis 4 Linien Länge und
4—6 Linien B reite, er ist in der Mitte nur wenig verengt, und jedei-seits mit einem eben
so breiten Querfortsatz vei-sehen. Der Querfoitsatz ist etwas nach hinten gerichtet und am
Ende schief abgeschnitten, so dass er hinterwärts in eine scharfe Spitze ausgeht. Auf dein
Körper sitzt oben ein breiter Wirbelbogen, der dachartig gewölbt ist imd auf seiner Firste
den breiten, etwas nach hinten geneigten, massig hohen Dornfortsatz trägt. Am Grunde
desselben ist jederseits, vom wie hinten, ein kurzer, flacher, wagi-echt gestellter, abgerundeter
scliiefer Fortsatz bemerkbar. In der angezogenen Figur erkennt man diese schiefen Fortsätze
nicht, weil sie unter dem Gestein liegen, von ihm umhüllt; dagegen sieht man sehr deutlich
die nach hinten zugespitzten queren Fortsätze, den Bogen, der flach gedi-Uckt die Mitte jedes
Wirbels einnimmt, und den Domfortsatz, der als scharfer Schatten vom Bogen aus in die
Tiefe des Gesteins hinabsteigt. In der von Goldfuss gegebenen Figur Taf. 2. Fig. 1 liegen
die 3 ersten Wirbel eben so und werfen denselben scharfen Scliatten längs der Mitte; die
folgenden Wirbel sind durch Druck mehr auf die Seite gelegt., und man gewahrt die nach
links geneigten Domfortsätze im Umriss. Die schmalen Eindrücke daneben rühren von den
Querfortsätzen her. An der unteren Hälfte eben dieser Figur sind die breiten Lappen m
der Mitte des Bildes Fortsätze des Miittergesteins, welche zwischen die Wirbelbogen in den
Rückenmarkskanal eindrangen, und neben denen sich die scliiefen Foi-tsätze abgedi-ückt
haben. Hier liegen die Wirbel wieder wagrecht, aber der senkrecht in die Tiefe hinabgehende
Dornfortsätz wird von den eben beschriebenen Lappen des in den Wirbelkanal
eingeflossenen Muttergesteins verdeckt.“ Nach den von Owen und Plieninger vorliegenden
Untei-sucliungen über die Wirbel der Labyrinthodonten der Trias werden auch bei dem
Archegosaurus concave Berührungsflächen der Wirbel vennuthet.
Hienach glaubt Bunneister von den Wirbeln des Archegosaurus ausser dem Dorn-
oder oberen Stachelfoi-tsatz und den Gelenkfortsätzen auch den Querfortsatz und den Wirbelkörper
erkannt zu haben. Dieselben Exemplare, an denen Goldfuss und Bunneister ihre
Beobachtungen über die Wirbel ansteUten, haben auch mir Vorgelegen, W ir werden sehen,
dass in Archegosauru.s ein Wirbelkörper gar nicht verbanden ist. Was Burmeister für den
Querfoi-tsatz hält, ist dui- untere Theil des oberen ]3ogcns, der in gewissen Fällen, namentlich
wenn er durch Vertikaldruck weiter nach aussen geschoben ist, oder auch wenn der Bogen
oder eine der beiden Hälften im l’rofil entblösst sich darstcllt, wohl für einen dem Bogen
angehörigen Querförtsatz verkannt werden kann. An dem bei Goldfuss Taf. D. Fig. 1 , von
mir Taf. XIIl. Fig. 1 abgebildeten Stück hat Burmcister richtig erkannt, dass dje oberen
Stachelfortsätze der ersten Wirbel in das Gestein hineinragen, auch dass dio Bogen der
folgenden Wirbel eine seitliche i.age cinnehmen', die Trennung jedoch des Bogens in zwei
Hälften und deren T'erschicbung ist ihm entgangen. Die schmalen Eindi-ücke neben den
Domfoi-tsätzen schreibt er den Quei-fbrtsätzen zu, während sie doch von dem Aussenrande
einer Platte heri-ühi-en, die, wie \vir sehen werden, den unteren Bogen vertritt. Die Selbstständigkeit
dieses Theils hat er eben so iibei-sehen, wie die Stellen, welche auf intervei-tebrale
Knochenkeile deuten. Auch erleidet die D eutung, welche d,cn Theilen auf dem unteren
Stück dieser wichtigen Versteinerung gegeben -wird, Abänderung, wie aus der ausführlichen
Beschreibung ersichtlich werden w ird, die ich im Verlaufe dieser Arbeit noch mitzutheilen
habe. Wenn nun aber Burmeister die Wirbel des Ai-chcgosaurus nicht richtig erkannt hat,
so werden auch die Schlüsse, die er aus seiner Ansicht Uber die Bescbaffcnlieit der Wirbel
auf die Natur des Thieres zieht, nicht länger haltbar seyn.
Ich habe ausdriickUch hei-vorzuheben, dass d a s, was mir gelungen ist, über die
Beschaffenheit der Wirbelsäule des Archegosaurus aufzufinden, auf keinen anderen Exemplaren
beruht, als auf denen, welche vor mir von Goldfuss und Bunneister benutzt worden waren,
und erst nachdem ich meine Entdeckung gemacht und mitgetheilt hatte, sind mir von Jordan
und Brass Stücke zugekommen, an denen es wohl leichter gewesen wäre, sich von dei-
eigenthümlichen Beschaffenheit dieser Gegend des Skelets zu übeiv-eugcn. Die Entzifferung
würde mir schwerer ge\vorden seyn, hätte ich nicht bereits in einer scheinbar unbedeutenden
Versteinerung gleichsam den Schlüssel dazu besessen. Diese aus dem an Mastodonsam-üs
reichen Alaunschiefci- der ■ triasischen Lettenkohle von Gaildorf in Würtcmberg herrtihrende
Versteinerung habe ich andenväi-ts (Paläontologie Wiirtteinbcrg’s, S. 39. 67. 130. t. 7.
f 5. 6. — Saurier des Muschelkalkes etc., S. 145. t. 29. f. 15) ausführlich dargelegt, und
es wäre daher überflüssig, wenn ich hier nochmals näher auf sie eingehen wollte.
Wenn man die trefflichen Untersuchungen, die wir v. Bäi-, Joh. Müller, Ralhke und
anderen über dio Entwickehuig der Wirbelsäule während des Fruchtlebens der Thiere und
in der näclistfolgenden Zeit verdanken, zu Rath zieht und sich dabei der ausgewachsenen
Knorpelfische als Vei-gleichungsinittel bedient, so wird man dahin gelangen, sich eine richtige
Vorstellung von der Beschaffenheit der Wirbelsäule in Archegosam-us zu machen.
Bekanntlich ist die Rückensaite (Chorda dorsalis) oder die Wii-belsaite (Chorda verte-
bralis), welche den Rückenmarksstrang trägt, die embryonale Anlage für.die Wirbelsäule.
Sie besteht in allen Wirbelthieren aus einem cylbiderföi-migen Kern, von mehr gallei-tartiger
Beschaffenheit, der in einer Scheide von einer mehr faserigen Substanz steckt. Die Rückensaite
ist daher von weicher Beschaffenheit. Auf ihrer Obei-fläche bilden sich zuerst tafelförmige
Ablagerungen oder Streifen von Blastem, welche die Anlage zu den Wirbelkörpem
sind. Während des Wachsthuins schliessen sich diese Streifen, wodurch Ringe entstehen,
die die Hückcnsnite umgeben. Diese Ringe vcrluiorpeln und verknöchern hierauf, wobei sie
die Wirbeisaite allmählich verdrängen. Die Rippen, so ivie die Schenkel der Wirbelbogen,