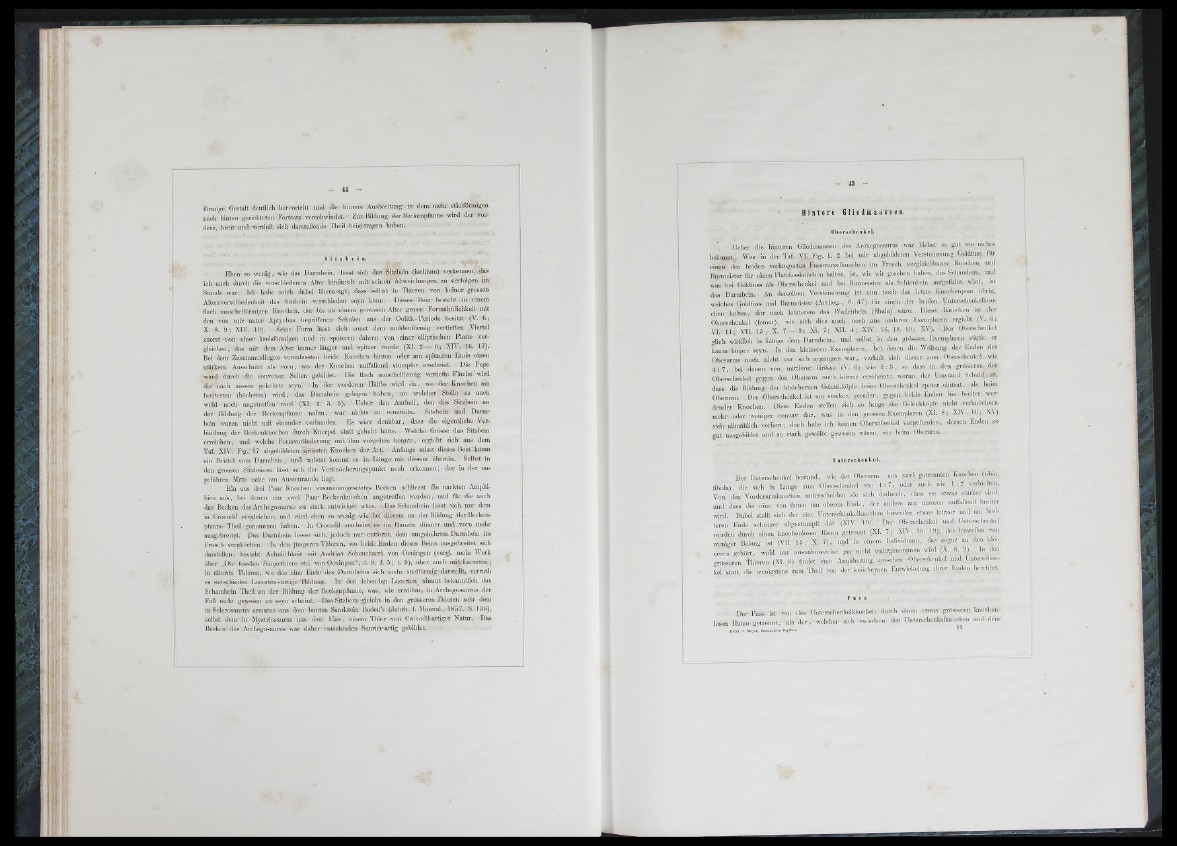
förmige Gestalt deutlich liervortrift und die hintere Ausbreitung in dem mehr stielfönnigeu
nach hinten gerichteten Foi-tsatz verschwindet. Zur Bildung der Beckenpfanne wii-d der vor-
da-e, breit und vertieft sich darstellende Theil beigetragen haben.
Eben so wenig, wie das Darmbein, lässt sich das Sitzbein (ischium) verkennen, das
ich auch, durch die verschiedenen Alter hindurch mit seinen Abweichungen zu verfolgen im
Stande war. Ich habe mich dabei überzeugt, dass selbst in Thieren von keiner grossen
Altci-svei-schiedenlieit das Sitzbein vci-schieden sejm kann. Dieses Bein' besteht in einem
flach muschelfönnigen Knochen, der bis zu einem gewissen Alter grosso Fonnähnlicbkeit mit
den von mir unter Aptychus begriffenen Schalen aus der O olith-Periode besitzt (V. C;
X. 8. 9 ; XIV. 19). • Seine' Form lässt sich sonst dem muldenföi-mig vertieften Viertel
zuerst -von einer kreisförmigen und in späteren Jahren von einer elliptischen Platte vergleichen,
das mit dem Alter immer längei- und spitzer w d e (XI. 2 — 6 ; XIV. 16. 17).-
Bei dem Zusammenlicgen veranlassten beide Knochen hinten oder am spitzeren Ende einen
starkem Ausschnitt als vorn, wo der Knochen auffallend stmnpfer erscheint. Die Fuge
wai-d durch die convexen Seiten gebildet. Die flach muschelföi-mig vertiefte Fläche wird
die nach aussen gekehrte seyn. In der vorderen' Hälfte wird d a, wo der Knochen am
breitesten (liöcbsten) ivird, das Darmbein gelegen' haben, an welcher Stelle es auch
wohl noch angetroffen wird {XI. 2. 3. 5). ^ Ueber den A ntheil, den das Sitzbein an
der Bildung der Beckenpfanne nahm , war nichts zu ermitteln. Sitzbein und Darmbein
waren nicht mit einander verbunden. Es wäre denkbar, dass die eigenüicbe Verbindung
der Beckenknochen durch Knorpel statt gehabt hätte. Welche Grösse das Sitzbein
erreichen, und welche Formverändei-ung mit ihm vorgohen konnte, ergiebt sich' aus dem
Taf. XIV; Fig.; 17 abgebildeten gi-össten Knochen der Art. Anfangs misst dieses Bein kaum
ein Drittel vom D am ibein, und zailctzt kommt es in Länge mit diesem überein. Selbst in
den grossen Sitzbeinen lässt sich der Verknöclierungspunkt noch erkennen; der in der ungefähren
Mitte nahe am Aussenrande liegt.
Ein aus drei Paar Knochen zusammengesetztes Becken schliesst die nackten Amphibien
aus, bei denen nur zwei Paar Beckenknochen angetroffen w erden, und für die auch
das Becken des Ai-chegosaurus zu stark entwickelt wäre. Das Schambein lässt .sieb nur dem
in Crocodil vergleichen, und wird eben so wenig wie bei diesem an der Bildung der Beckenpfanne
Theil-genommen haben. In Crocodil erscheint es im Ganzen dünner und vom mehr
ausgebreitet. Das Darmbein Hesse sich, jedoch nur entfernt, dem umgekehi-ten Darmbeui im
Frosch vergleichen. In den jüngeren Thieren, wo beide Enden dieses Beins ausgebreitet sich
darstellen, besteht Aehnlichkeit mit Andrias Scheiichzeri von Oeningen (vergl. mein Wei-k
über „Die fossilen Säugcthiere etc. von Oeningen“, t. 8. f. 5 ; t. 9), aber auch in itL acerten;
in älteren Thieren, wo das eine E nde'des Dannbeins sich mehr stielförmig darsteUt, verräth
es entschieden Lacerten - artige'Bildung. In" den lebenden Lacerten nimmt bekanntlich das
Schambein Theil an der -Bildung der Beckenpfanne, was, wie erwähnt, in Archegosaurus der
Fall nicht gewesen zu seyn scheint. Das Sitzbein -gleicht in den grösseren Thieren sehr dem
in Sclerosaui-us armatus aus dem bunten Sandstein Baden's (Jahrb. f. Mineral., 1857. S. 136),
selbst dem in Mystriosaurus t>us dem L ias, einem Thier von Crocodil-artigcr Natur. - Das
Becken des Archegosaurus war daher entschieden Saurier-artig gebildet.
H i n t e r e G l i e d m a a s s e n .
Ueber die hinteren Gliedmaassen des Archegosaurus war bisher so gut wie nichts
bekannt. W as in der T af VL Fig. 1. 2 bei mir abgebildeteii Versteinerung Goldftiss für
einen den beiden verlängerten Fusswurzelknochen im Frosch vergleichbaren Knochen, und
Bunneister lür einen Plattfussknocheii halten, ist, wie wir gesehen haben, das Schambein, imd
was bei Goldfuss als Oberschenkel und bei Burmeistcr als Schienbein autgcfiihrt wird, ist
das Darmbein. An derselben Versteinening ist nun noch das letzte Knochenpaai- übrig,
welches Goldfuss und Bunneister (Archeg., S. 4-7) fiir euieii der beiden Unterschenkelknochen
halten, der nach letzterem das Wadenbein (tibnla) wäre. Dieser Knochen ist der
Oberschenkel (femur), wie sich dies auch noch aus anderen Exemplaren ergiebt (V. 6;
VI. 11; VII. 15; X. 7 - 9 ; XI. 7; XII. 4 ; XIV. 16. 18. 19; XV). Der Oberschenkel
glich irii-kHch in Länge dem Darmbein, und selbst-in den grössten Exemplai-en wiü'de er
kaum länger seyn. In den kleineren Exemplaren, bei denen die Wölbmig der Enden des
Obei-ai-ms noch nicht vor sicli gegangen w ar, verhält sich dieser zum Oberschenkel wie
4 : 7 , bei denen von mitüerei- G rösse'(V . 6) wie 2 : 3 , so dass in den grösseren der
Oberschenkel gegen den Oberarm noch kürzer ei-sclieiiit; woran der Umstand Schuld ist,
dass die Bildung der knöchernen Gelcnkköpfe beim Oberschenkel später eintrat, als beim
Oberarm Der Oberschenkel ist ein starker, gerader, gegen beide Enden hin breiter, werdender
Knochen. Diese Enden stellen sich so lange die Gelenkköpfe nicht verknöchern
m ehr oder weniger concav dar, was in den grossen Exemplaren (XI. 8 ; XIT . 16; X \)
sich allmählich verliert; doch habe ich keinen Oberschenkel vorgefunden, dessen Enden so
gnt ausgebildet und so stark gewölbt gewesen wären, wie beim Obcrai-m.
D er Unterschenkel bestand, wie der O beranii, aus zwei getrennten Knochen (tibia,
fibula), die sich in Länge zum Oberechenkel ivie 4 : 7 , oder auch wie 1 :2 verhielten.
Von den T'orderai-mknochen unterscheiden sie sich dadurch, dass sie etwas stärker sind,
mul dass der eine von ihnen am oberen Endo, der andere am unteren auffallend l.reiter
wird Dabei stellt sich der eine Unterschenkelknochen bisweilen etwas kiirzvi- und am breiteren
Ende sehniger abgestumpft dar (XITT 19). Der Oberschenkel und üntersclienkel
werden durcli einen knochenlosen Raum getrennt (XI. 7 ; XITT 18. 1.9); der bisweilen von
wenigei- Belang ist (VIL 15; X. 7 ), und in einem Individuum, das sogar zu -den kleineren
gehört, wohl nur ausnahmsweise gar nicht waiirgcnommen wird (X. 8. 9). In den
gi-össeren Thieren (XI. 8) findet eine Aimäherung, zwischen -Oberschenkel mul Unterschenkel
statt, die M-cnigstens zum Theil von der knöchernen Entivickelung ihrer Enden herrührt.
Der Fuss ist von den Unterschenkelknonhen durch einen etwas grösseren, knochenlosen
Raum getrennt, als der, welcher sich zwischen den Untersclienkclknochen und dem
llcnii. V. Mwcr, Scetakollltn-U'ylUaii