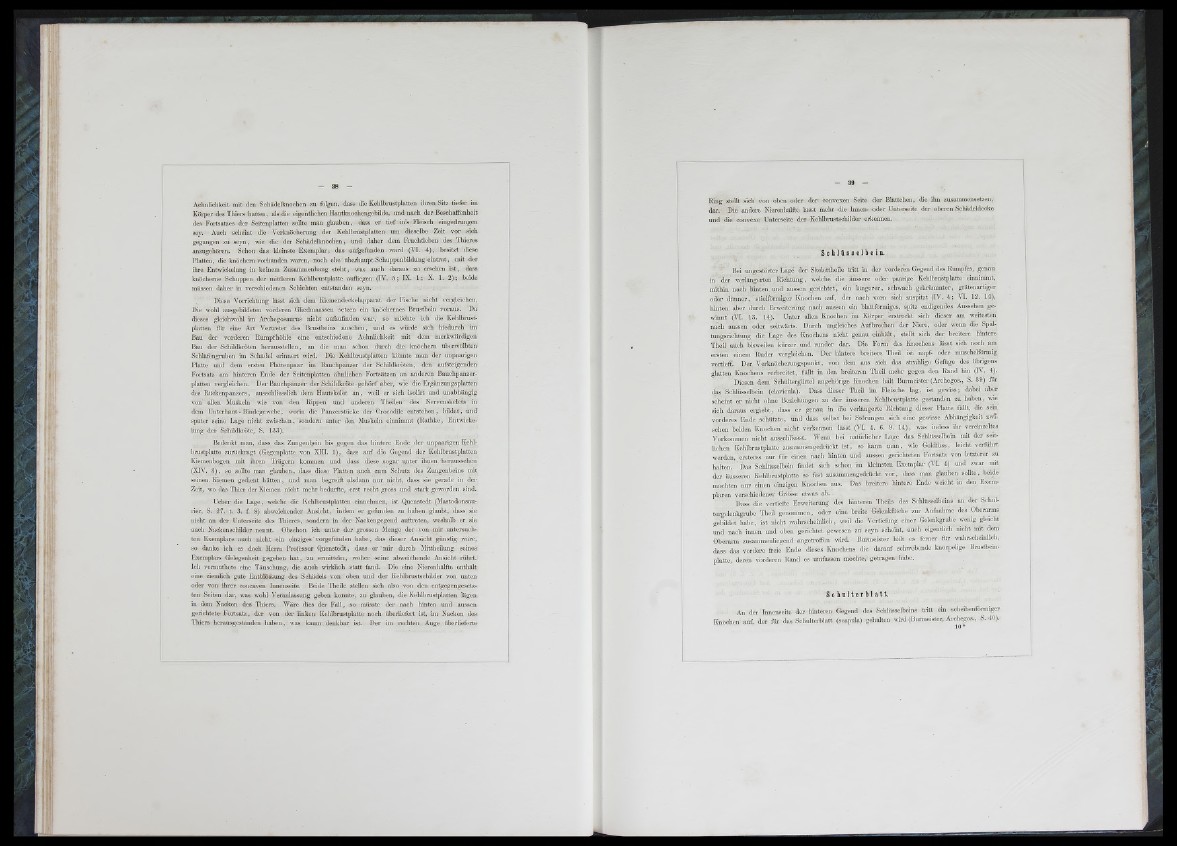
Aehnliclikcit mit den Schädelknoehen zu folgen, dass die Kehlbrustplatten ihren Sitz tiefer im
Körper des Tliiers hatten, als die eigentlichen Hautknochengebilde, und nach der Beschaffenheit
des Fortsatzes der Seitenplatten sollte man glauben, dass er tief in’s Fleisch eingedrungen
sey. Auch scheint die Verknöcherung der Kehlbrustplatten um dieselbe Zeit vor sich
gegangen zu seyn, wie die der Schädelknochen, und daher dem Fruchtleben des Thieres
anzugchöi-en, Schon das kleinste Exem plar, das aufgeftmden wai-d (VI. 4 ), besitzt diese
l’latten, die knöchern vorhanden waren, noch ehe übei-haupt Schuppenbildung eintrat, mit der
ihre Entwickelung in keinem Zusammenhang steht, was auch daraus zu ersehen ist, dass
knöcherne Schuppen der mittleren Kehlbrustplatte aufliegen (IV. 5 ; IX. 1 ; X. 1. 2); beide
miisscn daher in verschiedenen Schichten entstanden seyn.
Diese Von-ichtung lässt sich dem Kiemendcckclapparat der Fische nicht vergleichen.
Die wohl ausgebildeteii vorderen Gliedmaassen setzen ein knöchernes Brustbein voraus. Da
dieses gleichwohl im Archegosaurus nicht aufzufinden w ar, so möchte ich die Kehlbrustplatten
fiir eine Art Vertreter des Brustbeins anseben, und es \iüi-de sich hiedimch im
Bau der vorderen Rumpfhöhle eine entschiedene Aehnlichkeit mit dem merkivürdigen
Bau der Schildkröten herausstellen, an die man schon durch die knöchern überwölbten
Schlälengruben im Schädel erinnert wii-d. Die Kehlbrustplatten könnte man der unpaarigen
Platte mid dem ersten Plattenpaar im Bauchpanzer der Schildkröten, den aufsteigenden
Foi-tsatz am hinteren Ende der Seitenplatten ähnlichen Fortsätzen an arideren Bauchpanzerplatten
vergleichen. D er Bauchpanzer der Schildki-öte gehört' aber, wie die Ergänzuiigsplatten
des Rlickenpanzers, ausschliesslich dem Hautskelet an , weil er sich isolirt und unabhängig
von allen Muskeln wie von den Rippen und anderen Theilen des Neiwenskelets in
dem Uiitcrhaut-Bindegewebe, worin die Panzerstücke der Crocodile entstehen, bildet, und
später seine Lage nicht zwischen, sondern unter den Muskeln einnimmt (Rathke, Entwioke-
Imig der Schildb-ötc, S. 133).
Bedenkt man, dass das Zungenbein bis gegen das hintere Ende der impaaiigen Kehlbrustplatte
zuruckragt (Gegenplattc von XIII. 1), dass auf die Gegend der Kehlbrustplattcn
Kiemenbogen mit ihren Trägern kommen und dass diese sogar unter ihnen hcraussehen
(XIV. 3 ), so sollte man glauben, dass diese Platten auch zum Schutz des Zungenbeins mit
seinen. Kiemen gedient hätten, und man begreift alsdann nur nicht, dass sie gerade in der
Zeit, wo das Thier der Kiemen nicht mehr bedurfte, erst recht gross und stark geworden sind.
Ueber die L age, welche die Kehlbrustplatten einnchmen, ist Quenstedt (Mastodonsaurier,
S. 27. t. 3. f. 8) abweichender Ansicht, indem er gefunden zu haben glaubt, dass sie
nicht an der.Unterseite des Thieres, sondern in der Nackengegend auftreten, weshalb er sie
auch Nackenschilder nennt. Obschon ich unter der grossen Menge der . von mir untersuchten
Exemplare auch nicht ein einziges' vorgefimden habe, das dieser Ansicht günstig iväre,
so danke ich es doch Herrn Professor Q uenstedt, dass er ' mir durch Mittheilung seines
Exemplars Gelegenlieit gegeben hat, zu ermitteln, woher seine abweichende Ansicht rührt.
Ich venuuthete eine Täuschung, die aucli wirklich statt fand. Die eine Nierenhälfte enthält
eine ziemlich gute Entblössung des Schädels von oben und der Kehlbrustschildcr von unten
oder von ihrer concaven Innenseite. Beide Theile stellen sich also von den entgegengesetzten
Seiten dar, was wohl Veranlassung geben konnte, zu glauben, die Kehlbrustplatten lägen
in dem Nacken des Thiers. Wäre dies der F all, so müsste der nach hinten und aussen
gerichtete Fortsatz, der von der linken Kehlbrustplatte noch überlieicrt ist, im Nacken des
Thiers hei-ausgestauden haben, i\’as kaum denkbar ist. Der im rechten Auge überlieferte
Ring stellt sich von oben oder der convexen Seite der Blättchen, die ihn zusammensetzen,
diu-. Die andei-e Nierenliälftc lässt mehr die Innen- oder Untei-seite der oberen Schädeldecke
und die convexe Unterseite der Kehlbrustschildcr erkennen.
S c h l t s s e l b e i n .
Bei ungestörter Lage der Skeletthelle tritt in der vorderen Gegend des Rumpfes, genau
in der verlängerten R ichtung, welche die äussere oder paarige Kehlbrustplatte cinnim'rat,
m ithin nach hinten und aussen gerichtet, ein längerer, schwach gekriimmter, gräteiiartiger
oder dünner, stielföi-miger Knochen aiff, der nach vom sich zuspitzt (IV. 4 ; VI. 12. 14),
hinten aber durch Erweiterung nach aussen ein blattförmiges, spitz endigendes Aussehen gewinnt
(VI. 13. 14). Unter allen Knochen im Körper erstreckt sich dieser am weitesten
nach aussen oder seitwärts. Dui-ch ungleiches Aufbrechen der Niere, oder wenn die Spal-
tungsrichtimg die Lage des Knochens nicht genau einhält, stellt sich der breitere hintere
Theil auch bisweilen kiü-zer und runder dar. Die Foi-ni des Knochens lässt sich noch am
ersten einem Ruder vergleichen. Der hintere breitere Theil ist napf- oder muschelförmig
vertieft. Der Verknöcherangspunkt, von dem aus sich das strahligc Gefüge des übrigens
glatten Knochens verbreitet, fäflt in den breiteren Theil mehr gegen den Rand hin (IV. 4).
Diesen dem Schultergiii-tel angehörige Knochen hält Burmeister (Archegos,, S. 39) für
das Schlüsselbein (clavicula). Dass dieser Theil im Fleische lag, ist gewiss; dabei aber
scheint er nicht ohne Beziehungen zu dei- äusseren Kehlbrastplatte gestanden zu haben, wie
sich daraus ergiebt, dass er genau in die verlängerte Richtung dieser Platte fällt, die sein
vorderes Ende schützte, und dass selbst bei Störungen sich eine gewisse Abhängigkeit zwischen
beiden Knochen nicht verkennen lässt. (VI. 4. 6. 9. 14), was indess ihr vereinzeltes
Vorkommen nicht ausschliesst. Wenn bei natiü-licher Lage das Scblüsselbein mit der seitlichen
Kehlbrustplatte zusammengednickt ist, so kann m an, wie Goldfuss, leicht verführt
iverden, ersteres nur für einen nach hinten und aussen gerichteten Fortsatz von letzterer zu
halten. Das Schlüsselbein findet sich schon im kleinsten Exemplar- (VI. 4) und zwar init
der äusseren Kehlbrustplatte so fest zusammengedrückt v o r, dass man glauben sollte, beide
machten nur einen einzigen Knochen aus. Das breitere hintere Ende weicht in den Exemplaren
verschiedener Grösse etwas ab.
Dass die vertiefte Enveiterung des hinteren Theils des Schlüsselbeins an der Schul-
tei-gelenkgi-ube Theil genommen, oder eine breite Gelenkfläche zur Aufnahme des Oberarms
gebildet habe, ist niclit wahrscheinlich, weil die T^ertiefung einer Gelcnkgrube wenig gleicht
und nach innen und oben gerichtet gewesen zu seyn scheint, auch eigentlich nicht mit dem
Oberarm zusammenliegend angetroffen wii-d. Burmeister hält es ferner für wahrscheinlich,
dass das vordere freie Ende dieses Knocliens die darauf schwebende knorpelige Brustbeinplatte,
deren vorderen Rand es umfassen mochte, getragen habe.
S c h u l t e r b l a t t .
An der Innenseite der hinteren Gegend des Schlüsselbeins tritt ein scheibenförmiger
Knochen auf, der für das Schulterblatt (scapula) gehalten wird (Burmcister, Archegos., S. 40).
1 0 »