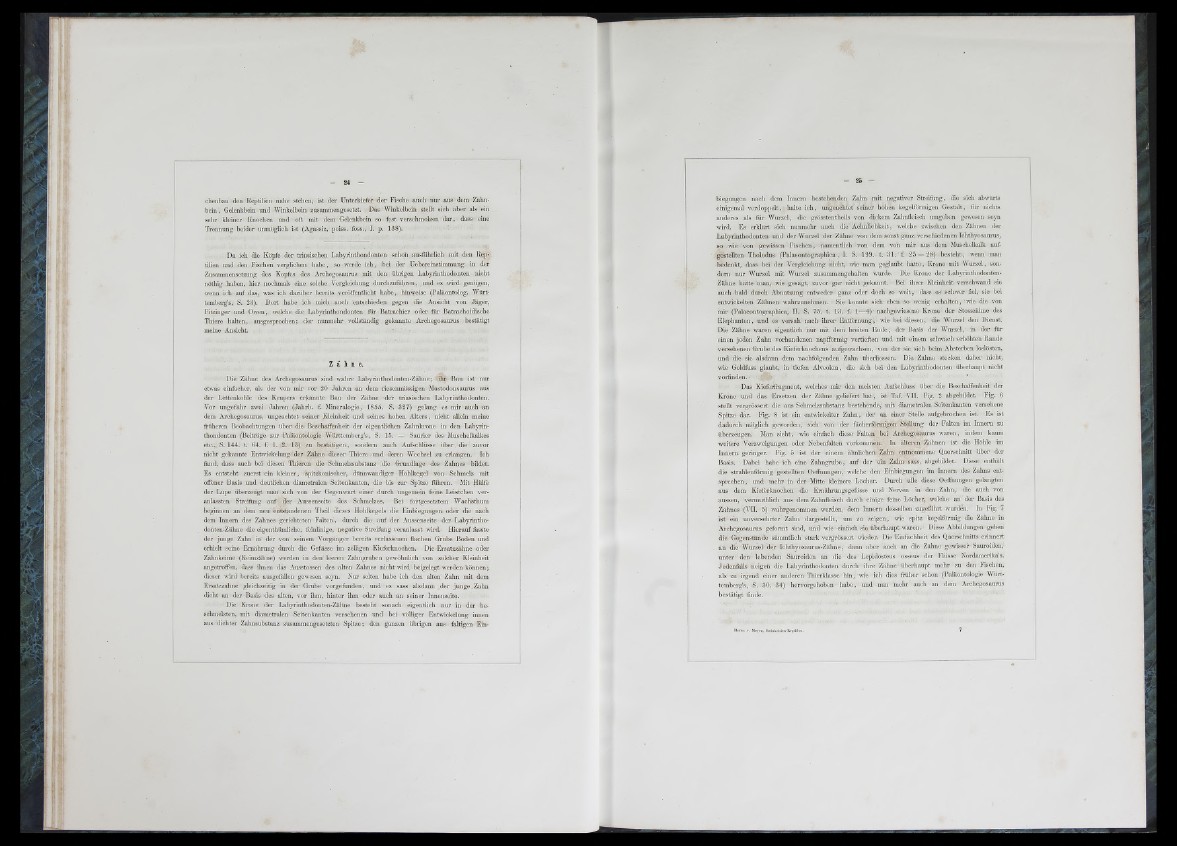
chenbau den Reptilien nahe stehen, ist der Untcrkiet'ci- der Fische aucli nur aus dem Zahnbein,
Gclonkbein und Winkelbein zusammengesetzt. Das Winkelbein stellt sich aber als ein
sein- kleiner Knochen und oft mit dem Gelenkbein so fest verschmolzen d ar, dass eine
Trennung beider unmöglich ist (Agassiz, poiss. foss., I. p. 138).
D a ich die Köpfe der triasischen LabyTinthondonten schon ausfiihrlioh mit den Reptilien
und den Fischen verglichen habe, so werde ich, bei der Uebcrcinstitiunung in der
Zusammensetzung des Kopfes des Avchegosaui-us mit den übrigen Labyrinthodonten nicht
nötliig haben, hier nochmals eine solche T'erglciclimig durchzuführen, und es ivird genügen,
wenn ich auf das, was ich darüber bereits veröftentlicbt iiabe, liinweise (Paläontolog. Würt-
temberg’s, S. 23). D ort habe ich mich auch entschieden gegen die Ansicht von Jäger,
Fitainger und Owen, welche die Labyrinthondonten fiü- Bati-achier oder fiu- Batrachoidische
Thiere halten, ausgesprochen; der nunmehr vollständig gekannte Archegosam-us bestätigt
meine Ansicht.
Die Zähne des Ai-chegosam-us sind walire LabjTiiithodoiiten-Zäbne ; ihr Bau ist mii-
etwas einfacher, als der von mir vor 20 Jahren an dem riesenmässigen Mastodonsaurus aus
der Lettenkohle des Keupers erkannte Bau der Zähne der ti-iasischen Labyrinthodonten.
Vor ungerälir zwei Jahren (Jahrb. f. Mineralogie, 1855. S. 327) gelang es mir auch an
dem Ai-chegosaurus, ungeachtet seiner Kleinheit und seines hohen A lters, nicht allein meine
früheren Beobachtungen über die Beschaffenheit der eigentlichen Zahnkrone in den Labyi-in-
thondontcn (Beitrage ziu- Paläontologie Württembci-g’s , S. 15. Saurier des Muschelkalkes
etc., S. 144. t. 64. f. 1. 2. 13) zu bestätigen, sondern auch Aufschlüsse über die zuvor
nicht gekannte Enrivickelimg der Zähne dieser Thiere und deren Wechsel zu erlangen. Ich
fand, dass auch bei diesen Thiei-en die Schmelzsubstanz die Grundlage des Zahnes bildet.
Es entsteht zuerst ein kleiner, spitzkoiiiscber, dimnwandiger Hohlkegel von Schmelz mit
offener Basis und deutlichen diametralen Seitenkanten, die bis zur Spitze fuhren. Mit Hülfe
der Lupe überzeug man sieh von der Gegenwart einer durch ungemein feine Leistchen ver-
anlassten Streifung auf der Aussenseite des Schmelzes. Bei fortgesetztem Wachsthum
beginnen an dem neu entstandenen Theil dieses Hohlkegels die Einbiegungen oder die nach
dem Innern des Zahnes gerichteten Falten, durch die auf der Aussenseite der Labyrintho-
donten-Zähne die eigenthümlichc, feinlinige, negative Streifung veranlasst wird. Hierauf fasste
der junge Zahn in dev von seinem Vorgänger bereits verlassenen flachen Grube Boden und
erhielt seine Ernährung durch die Gefässe im zelligen Kieferknochen. Die Ersatzzähne oder
Zahiikeime (Keimzähne) werden in den leeren Zahngi-uben gewöhnlich von solcher Kleinheit
angetroffen, dass ihnen das Aasstossen des alten Zahnes nicht wird beigelegt werden können;
dieser wird bereits ausgefallen gewesen seyn. Nur selten habe ich den alten Zahn mit dem
Ersatzzahne gleichzeitig in der Grube vorgefunden, und cs sass alsdann der junge Zaini
dicht an der Basis des alten, vor ihm, hinter ihm oder auch an seiner Innenseite.
Die Krone der Labyrinthodonten-Zähne besteht sonach eigentlich nur in der bc-
schmelzten, mit diametralen Seitenkanten versehenen und bei völliger Entwickelung innen
aus dichter Zahnsubstanz zusammengesetzten Spitze ; den ganzen übrigen aus faltigen Einbiegungen
nach dem Innern bestehenden Zahn mit negativer Streifung, die sich abwärts
einigemal verdoppelt, halte ich, ungeachtet seiner hohen kegelförmigen Gestalt, für nichts
anderes als für Wurzel, die gi-össtentheils von dickem Zahnfleisch umgeben gewesen seyn
wird. Es erklärt sieli nunmehr auch die Aehnlichkeit, welche zwischen den Zäliiien der
Labyrinthodonten und der Wurzel der Zähne von dem sonst ganz verschiedenen Ichthyosaurus,
so wie von gewissen Fisclien, namentlich von dem von mir aus dem Muschelkalk auf-
gestellten Tholodus (Palaeontographica, I. S. 199. t. 31. f. 25 — 28) besteht, wenn inan
bedenkt, dass bei der Vergleichung nii:ht, wie man geglaubt hatte, Krone mit Wurzel, sondern
nur Wurzel mit Wurzel zusammengehalten wurde. Die Krone der Labyrinthodonlen-
Zähnc hatte man, wie gesagt, zuvor gar nicht gekannt. Bei ihrer Kleinheit verschwand sie
auch bald durch Abnutzung entweder ganz oder doch so w eit, dass es schwer fiel, sie bei
enrivickelten Zähnen wahrzunehmen. Sie konnte sich- eben so wenig erhalten, ' wie die von
mir (Palaeontogi-aphica, II. S. 75. t. 13. f. 1—4) nachgewiesene Krone der Stosszähne des
Elephanten, und es versah nach ihrer Entfernung, wie bei diesen, die Wui-zel den Dienst.
Die Zähne waren eigentlich nur mit dem breiten E nde, der Basis der Wui-zel, in der für
einen jeden Zahn vorhandenen napfföi-inig vertieften und mit einem schwach erhöhten Rande
versehenen Grube des Kieferknochens aufgewachsen, von der sie sich beim Absterben loslösten,
und die sie alsdann dem nachfolgenden Zahn überliessen. Die Zähne stecken daher nicht,
wie Goldfuss glaubt, in tiefen Alveolen, die sich bei den Labyi-inthodonten überhaupt nicht
vorfinden.
Das Kieferfragraent, welches mir den meisten Aufschluss über die Beschaffenheit der
Krone und das Erseteen der Zähne geliefert h at, ist T af VII. Fig. 2 abgebildet. Fig. 6
stellt vergrössert die aus Schmcizsubstanz bestehende, mit cliameti-alen Seitenkanten versehene
Spitze dar. Fig. 8 ist ein entwickelter Zahn, der an einer Stelle aufgebi-ocben ist. Es ist
dadm-ch möglich geworden, sich von der fächerförmigen Stellung der Falten im Innern zu
überzeugen. Man sieht, wie einfach diese Falten bei Archegosaurus waren, indem kaum
weitere Verzweigungen oder Nebenfalten Vorkommen. In älteren Zähnen ist die Höhle im
Innern geringer. Fig. 5 ist der einem ähnlichen Zahn entnommene Querschnitt über der
Basis. Dabei habe ich eine Zahngrube, auf der ein Zahn sass, abgebildet. Diese enthält
die strablenfÖi-mig gestellten Oeffnungen, welche den Einbiegungen im Innern des Zahns ent-
sprechen, und mehr in der Mitte kleinere Löcher. Durch alle diese Oeffnungen gelangten
aus dem Kieferknochen die Ernährungsgefasse und Nei-ven in den Zahn, die auch von
aussen, vennuthlich aus dem Zahnfleisch durch einige feine Löcher, welche an der Basis des
Zahnes (TTI. 5) ^valll-genomme)^ werden, dem Innern desselben zugefülut \vurden. In Fig. 7
ist ein unversehrter Zahn dargestellt, um zu zeigen, m e spitz kegelförmig die Zähne in
Archegosauras gefonnt sind, und wie einfach sie überhaupt waren. Diese Abbildungen geben
die Gegenstände sämmtlich stark vergrössert wieder. Die Einfachheit des Querschnitts erinnert
an die Wurzel der Ichthyosam-us-Zäline, dann aber auch an die Zähne gemssei- Sauroiden,
unter den lebenden Sauroiden an die des Lepidosteus osseus der Flüsse Nordamerika’s.
Jedenfalls neigen die Labyrinthodonten durch ihre Zähne überhaupt mehr zu den Fischen,
als zu irgend einer anderen Thierklasse hin, wie ich dies früher schon (Paläontologie Würt-
tcmbcrg's, S. 30. 34) hei-vorgehoben habe, und nun raelir nucli an dem Archegosaurus
bestätigt finde.
Ilvroi. V. Mcyor, SldiikuliIcn-RcptlllTO.