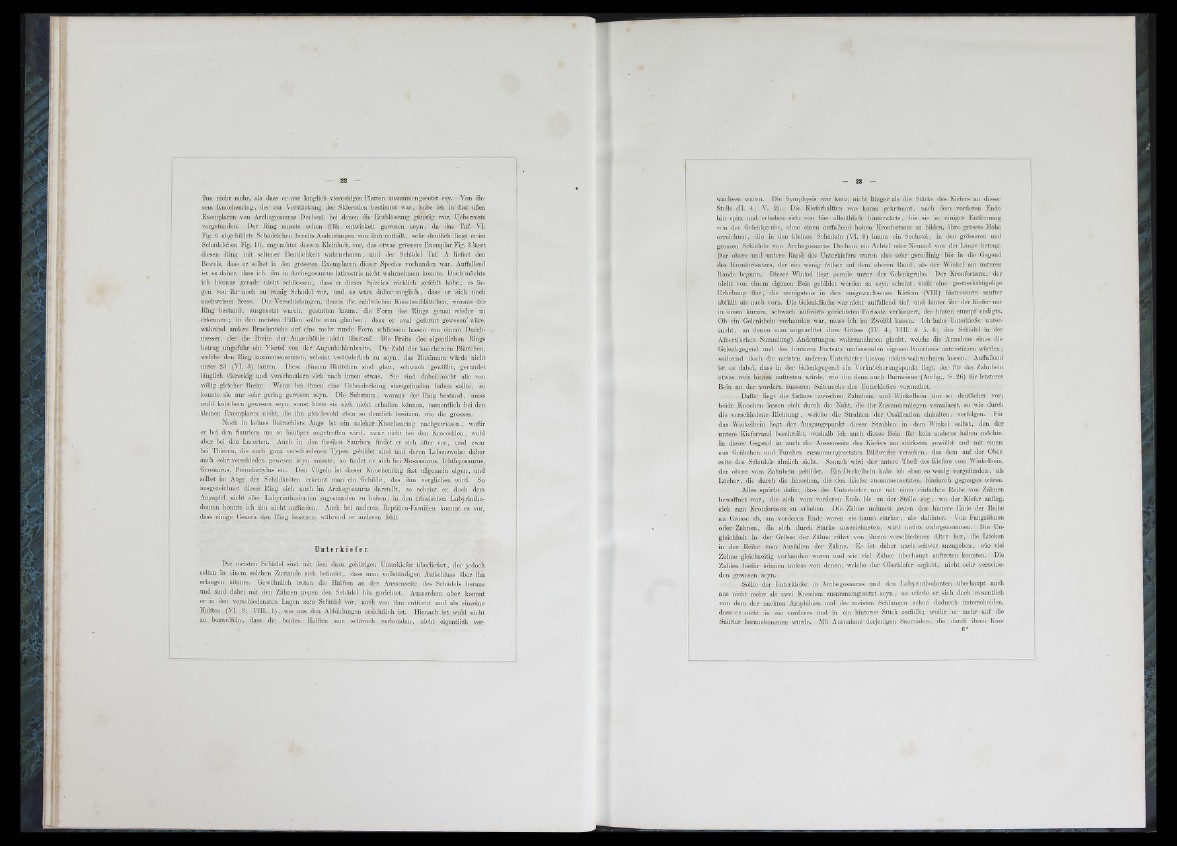
iliiii nicht mehr, als dass er aus länglich viereckigen Platten zusammengesetzt sey. T on diesem
Knochenriiig, der zur Vei'stärkung der Sklerotica bestimmt w ar, habe ich in fast allen
Exemplaren von Archegosaurus Declieni, bei denen die Entblössung günstig war, Ueberreste
vorgeluiulen. Der i3ii,ig musste sclion früh entwickelt gewesen seyn, da das Taf. TT.
Fig. 6 abgebiklete Schädelclien bereits Andeutungen von ihm enthält, sehr deutlich liegt- er im
Sclüidclchen Fig. 10, ungeachtet dessen Kleinheit, vor, das etwas grössere Exemplar Fig. 3 lässt
diesen Ring mit seltener Deutlichkeit w-alirnchmen, und der Schädel Taf. A liefert den
Beweis, dass er selbst in den grössten Exemplaren dieser Species vorhanden war. Auffallend
ist es daher, dass ich ihn in Archegosaurus latirostris nicht wahrnehmen konnte. Doch möchte
ich hieraus gerade nicht schliessen, dass er dieser Species wirklich gefehlt habe, es liegen
von ihr noch zu wenig Schädel vor, und es wäre daher möglich, dass er sich noch
nachweisen Hesse. Die T'’erschiebuiigcn, denen die. zahlreichen Kiiochenblättchen, w’oraus der
Ring bestand, ausgesetzt n-aren, gestatten kaum, die Form des Rings genau wieder zu
erkennen; in den meisten Fällen sollte man glauben, dass er oval geformt gewesen' wäre,
wälirend andere Bruchstücke auf eine mehr runde Form schliessen lassen von einem Durchmesser,
der die Breite der Augenhöhle nicht übeiti-af. Die Breite des eigentlichen Rings
betrag ungeftihr ein T’ierte! von der Augenhöhlenbreite. Die Zahl der knöchernen Blättchen,
welche den Ring zusa'mmcnsetzten, scheint veränderlich zu seyn, das Maximum ivürde nicht
unter 23 (TT. 3) lauten. Diese dünnen Blättchen sind glatt, scliwach gewölbt, gerimdet
länglich viereckig und verschmälem sich nach innen etwas. Sie sind dabei nicht alle von
vöUig gleicher Breite. TVenn bei ihnen eine Ueberdeckung stattgefunden haben sollte, so
konnte sie nur sehr gering gewesen seyn. Die Substanz, woraus der Ring bestand, muss
wohl knöcheiTi gewesen seyn, sonst hätte sie sich nicht erhalten können, namentlich bei den
kleinen Exemplaren nicht, die ihn gleichwohl eben so deutlich besitzen, wie die gi-ossen.
Noch in keines Batrachiers Auge ist ein solcher Knocbenring nachgewiesen, wofür
er bei den Sauriern um so liäufigcr angetroffen w ird, zwar nicht bei den Krocodilen, wohl
aber bei den Laceiten. Auch in den fossilen Sauriern findet er sich öfter vor, und zwar
bei Thieren, die nach ganz verschiedenen Typen gebildet sind und deren Lebensweise daher
auch sehr verschieden gewesen seyn m usste; so findet er sich bei Mosasaurus, Ichthyosam-us,
Geosaurus, Pterodactylus etc. Den T^ögeln ist dieser Knocheuring fast allgemein eigen, und
selbst im Auge der Schildkröten erkennt man ein Gebilde, das ihm vergHchen wird. So
ausgezeichnet dieser Ring sich auch im Archegosaui-us darsleUt, so scheint er doch dem
Augapfel nicht allei- Labyrinthodonten zugestanden zu haben; in den triasischen Labyriiitho-
donten konnte ich ihn nicht aiiftindeu. Auch bei anderen Reptilien-Familicn kommt es vor,
dass einige Genera den Ring besitzen, während er anderen fehlt.
U n t e r k i e f e r .
Die meisten-Schädel sind mit dem dazu gehörigen Unterkiefer überliefert, der jedoch
selten in einem solchen Zustande sich befindet, dass man vollständigen Aufschluss über ihn
erlangen könnte. Gewöhnlich treten die Hälften an der Aussenseite des Schädels heraus
und sind dabei mit den Zähnen gegen den Schädel hin gerichtet. Ausscrdcm aber kommt
er in den verschiedensten Lagen zum Schädel vor, auch von ihm entfernt und als einzelne
Hälften (\T. 9; TTII. 1), wie aus den Abbildungen ersiclitlich ist. Hienach ist wohl nicht
zu bezweifeln, dass die beiden Hälften nur schwach verbunden, nicht eigentlich verwaciiscn
waren. Die Symphysis war kurz, nicht länger als die Stärke des Kiefers an dieser
Steüe (11. 4 ; 2), Die Kieferhälften war kaum gela-iimmt, nach dem vorderen Ende
liin spitz und erholien sich von hier allmählich hinterw ärts, bis sie in einiger Entfernung
von der Gclcfikgrube, ohne einen auffallend hohen Kronfoifsatz zu bilden, ihre grösste Höhe
erreichten, die in den kleinen Schädeln (VL 9) kamn ein Sechstel, in den grösseren und
gres.scn Schädeln von Archegosauras Decheni ein Achtel oder Neuntel von der Länge betrug.
Der obere und untere Rund dés Unterkiefers waren also sehr geradHnig bis in die Gegend
des Kronfortsatzcs, der ein v-enig früher auf dem oberen R and, als der Winkel am unteren
Rande begann. Dieser TVinkel liegt gerade unter der Gelenkgrube. Der Kronfortsatz, der
nicht von einem eigenen Bein gebildet worden zu seyn scheint, stellt eine gestrecktbügeligc
Erhebung d a r, die wenigstens in den ausge\vachsenen Kiefern (VIII) hintenvärts sanfter
abfällt als nach vom. Die Gclcnkfläche w ar nicht auffallend tief, und hinter ihr der Kiefer nur
in einen kurzen, schwach aufwärts gerichteten Fortsatz verlängert, der hinten stumpf endigte.
Ob ein Gelenkbein vorhanden war-, muss ich im Zweifel lassen. Ich habe Unterkiefer untersucht,
an denen man ungeaclftet ihrer Grösse (IV. 4 ; TTII. 4. .5. 6; der Schädel in der
Alberti’schen Sammlung) Andeutungen wabrzunehmen glaubt, welche die Annahme eines die
Gelenkgegend luid den hinteren Fortsatz umfassenden eigenen Knochens unterstützen würden ;
während doch die meisten anderen Unterkiefer hievon nichts wahniehmen lassen. Auffallend
ist es dabei, dass in der Gelenkgegend ein T'^erknÖcherungspunkt Hegt, der fiir das Zahnbein
etwas weit hinten auftreten vüi-de, wie ilin denn auch Bunneister (Archg., S. 26) für letzteres
Bein an der vordem äusseren Seitenecke des Unterkiefers vennuthet.
. Dafür liegt die Gränze zwischen Zahnbein und TVinkelbein um so deutlicher vor;
beide Knochen lassen sich durch die Naht, die ilir Zusaramenliegen veranlasst, so wie durch
die verschiedene R ichtung, welche die Strahlen der Ossification einhalten, verfolgen. Für
das Winkelbein liegt der Ausgangspunkt dieser Strahlen in dem TVinkel selbst, den der
untere Kieferrand beschreibt, weshalb ich auch dieses Bein für kein anderes halten möchte.
In dieser Gegend ist auch die Aussenseite des Kiefern am stärksten gewölbt und mit einem
aus Grübchen und Furchen zusammengesetzten Bildwerke versehen, das dem aut der Oberseite
des Schädels ähiiHch sieht. Sonach wird der untere Theil des Kiefers vom Winkelbein,
der obere vom Zahnbein gebildet. Ein Deckelbein habe icli eben so wenig vorgefunden, als
Löcher, die durch die Knochen, die den Kiefer zusammensetzten, hindurch gegangen wären.
Alles spricht dafür, dass der Unterkiefer nm- mit einer einfachen Reihe von Zähnen
bewafihet w ar, die sich imm vorderen Ende bis zu der Stelle zog, wo der Kiefer anfing,
sich zum Kronfortsatz zu erheben. Die Zähne nahmen gegen das hintere Ende der Reihe
an Grösse ab, am vorderen Ende waren sie kauni stärker, als dahinter. Von Fangzähnen
oder Zähnen, die sich dm-ch Stärke aiiszeichneten, ^vil-d niclits wahrgenommen. Die Ungleichheit
in der Grösse der Zähne i-ührt von ilirem verschiedenen Alter her, die Lücken
in der Reihe vom Ausfallen der Zähne. Es ist daher auch schwer anzugeben, wie viel
Zahne gleichzeitig vorhanden waren mul wie viel Zäline überhaupt auftreten konnten. Die
Zahlen liiefVu- können indess von denen, welche der Oberkiefer ergiebt, niclit sehr verschieden
gewesen seyn.
Sollte dej- Unterkiefer in Archegosaurus und den Labyrinthodonten überhaupt auch
aus nicht mein- als zwei Knocheu zusammengesetzt seyn, so würde er sich doch wesentlich
von dem der nackten- Amphibien und dev meisten Schlangen schon dadurch unterscheiden,
dass er nicht in ein vorderes und in ein hinteres Stück zerfällt; wofür er mehr auf die
Saurier heranskommen würde. .Mit Au.snahmc deijenigen Sauroiden, die durch ihren Kno