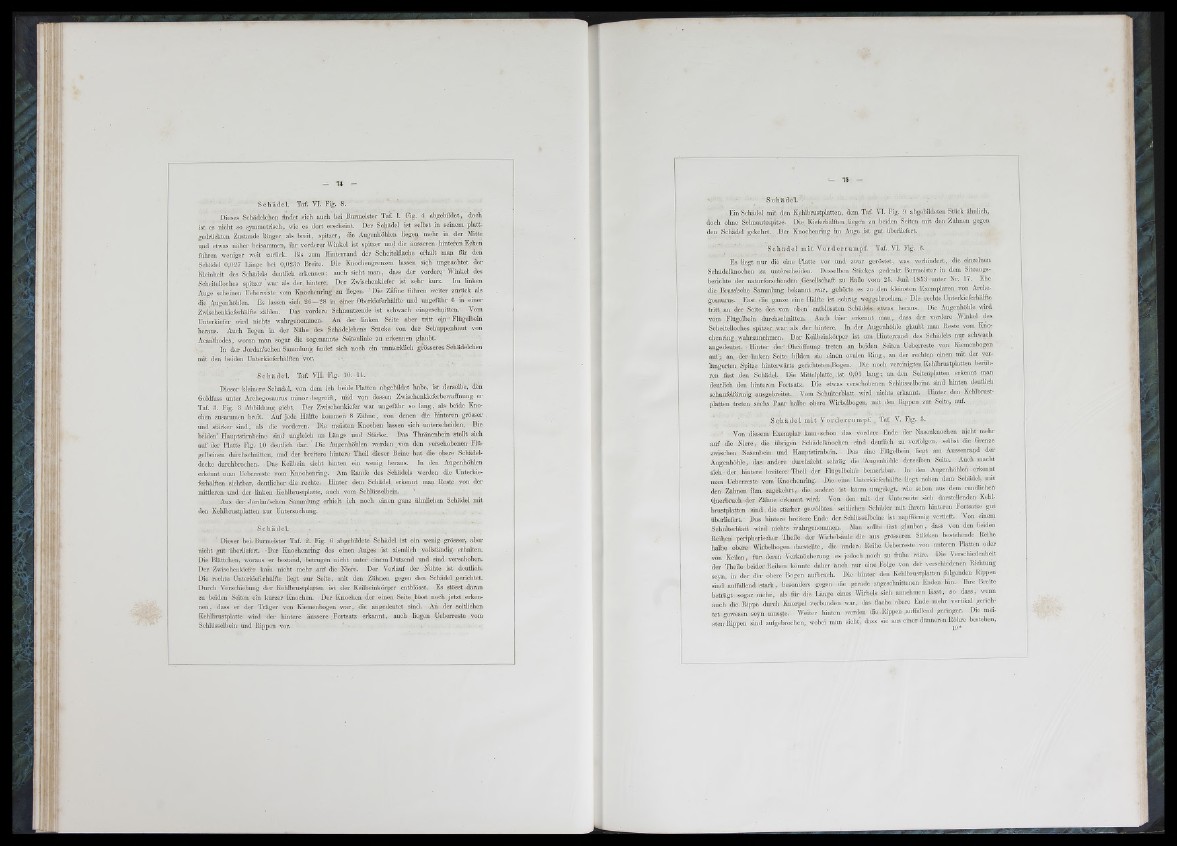
S c h ä d e l. Taf. VI. Fig. 8.
Dieses Scbädelchen findet sich auch bei Burmeister Taf. I. Fig. 4 abgebEdet , doch
ist es nicht so symmetrisch, wie es dort erscheint. Der Schädel ist selbst in seinem platt-
gedi-ückten Zustande läqger als breit, spitzer, die Augenhöhlen licgeu mehr in der Mitte
imd etwas näher beisammen, ihr vorderer Winkel ist spitzer und die äusseren hinteren Ecken
führen weniger weit zurück. Bis zum Hinterrand der Scheitelfläche erhält man fiü- den
Schädel 0,027 Länge bei 0,0235 Breite. Die Knochengrenzen lassen sich ungeachtet der
Kleinheit des S c h ä L s deutlich erkennen; auch-sieht m an, dass der vordere'W inkel des
ScheiteEoches spitzer 'w ar als der hintere. Der Zwisebenkiefer ist sehr kurz. Im Enken
Auge scheinen Ueberreste vom Knocbenring zu liegen. ' Die ZaBne führen weiter zm-ück als
die Augcnhühlcn. Es lassen sich 26—28 in einer Oberkieferhälfte und ungefähi- 6 in einer
Zwischenkiefcrhälfte zählen. Das vordere Sclmautzende ist schwach eingeschnitten. Vom
Unterkiefer ivii-d nichts wahrgenommen. An der linken Seite aber tritt ein • Fliigelbeln
heraus. Auch Eegen in der^N ähe des Schädelchens Stücke von der Schuppenhaut von
Acanthodes, woran man sogar die sogenannte Seitenlinie zu erkennen glaubt.
In der Jordan’schen Sammlung findet sich noch ein unmerklich grösseres Scbädelchen
mit den beiden Unterkieferhnlften vor.
S c h ä d e l, Taf. VII. Fig. 10. 11.
Dieser kleinere Schädel, von dem ich beide Platten abgebüdet habe, ist derselbe, den
Goldfuss unter Aj-chegosaui-us minor-begi-eift, und von dessen Zwischenkieferbcwaffnung er
Taf. 3. Fig. 3 Abbildung giebt. Der Zwisebenkiefer war migefähr so lang, als beide Knochen
zusammen breit. Auf jede Hälfte kommen 8 Zähne, von denen die hinteren grössei-
und stärker sind, als die vorderen. Die meisten Knochen lassen sich unterscheiden. Die
beiden’ Hauptstirnbeine sind ungleich an Länge und Stärke. Das Thränenbein steEt sich
auf der Platte Fig. 10 deuthch dar. ' Die Augenhöhlen werden .von den verschobenen Flügelbeinen
durchschnitten, imd der breitere hintere Theil dieser Beine hat die obere Schädeldecke
durchbrochen. Das Keilbein sieht hinten ein wenig heraus. In den Angenliöhlen
erkennt man Ueberreste vom Knochenring. Am Rande des Schädels werden dio Unterkie-
fei-hiEfteii sichtbar, deutücher die rechte. Hinter dem Schädel erkennt mau Reste von der
mittleren und der Enken Kehlbrustplatte, auch vom Schlüsselbein.
Aus der Jordan’schen Sammlung erhielt ich noch einen ganz ähnlichen Schädel mit
den Kehlbrustplatten zur Untersuchung.
S c h ä d e l. . .
Dieser bei- Burmeister Taf. 2. Fig. 6 abgebildete Schädel ist ein wenig grösser, abei-
nicht gut überEefert. Der Knochcm-ing des einen Auges ist zieinüch vollständig erhalten.
Die Blättchen, woraus er bestand, betrugen nicht unter einem Dutzend und sind verschoben.
Der Zwischenkiefer kam nicht mehr auf die Niei-e. Der Verlauf der Nähte ist deutlich.
Die rechte ünterkieferhälfte liegt zur Seite, mit den Zähnen gegen den Schädel gerichtet.
Durch Verschiebung der Kehlbrustplatten ist der Keübeinköi-per entblösst. Es stösst daran
zu beiden Seiten ein kurzer Knochen. Der Knochen der einen Seite lässt noch jetzt erkennen,
dass er der Träger von Kiemenbogen w ar, die angedeutet sind. An der seitlichen
Kehlbrustplatte w-ird der hintere äussere Fortsatz erkannt, auch liegen Ueberreste vom
Schlüsselbein und Rippen vor.
S c h ä d e l.
Ein Schädel mit den Kehlbrustplatten, dem Taf. VI. Fig. 9 abgebildeten Stück ähnlich,
doch ohne Schnautzspitze. Die Kieferhälften.liegen zu beiden Seiten mit den Zähnen gegen
den Schädel gekehrt. Der Knochenring im Auge ist gut überliefert.
S c h ä d e l m it V o rd c ri-u m p f. Taf. VI. Fig. 6.
Es hegt nui- die eine Platte vor und zivar geröstet, was verhindert, die einzelnen
Schädelknochen zu unterscheiden. Desselben Stückes gedenkt Bunneister in dem Sitzungsberichte
der natuiforschenden Gesellschaft zu Hallo vom 25. Juni 1853 unter Nr. 17. Ehe
die Brass’sche Saimnlung bekannt w ar, gehörte cs zu den Ideinsten Exemplaren von Arche-
gosaui-us. Fast die ganze eine Hälfte ist schräg weggebrochen. • Die rechte Ünterkieferhälfte
ti-itt an der Seite des von oben entblössten Schädels etwas heraus. Dio Augenhöhle wird
vom Flügelbein dui-chschmtteii. Auch hier erkennt m an, dass der vordere Winkel des
Scheitelloches spitzer wrn- als der hintere. In der Augenhöhle glaubt man Reste vom Kno-
chenring wahi-zunehmen. Der Keilbeinköi-per ist am Hinterrand des Schädels mu- schivach
angedeutet. ■ Hinter der Ohi-öffnung treten an beiden Seiten Ueberreste von Kiemeubogen
auf; an der linken Seite bEden sie einen ovalen R ing, an der rechten einen mit der verlängerten
Spitze hintenvärts gerichtetemBogen. Die noch vereinigten Kehlbrustplatten berühren
fast den Schädel. Die Mittelplatte, .ist 0,01 lang; an den Seitenplatten erkennt man
deutlich den hinteren Fortsatz. Dio etwas verschobenen Schlüsselbeine sind hinten deutlich
schaufelfönnig ausgebreitet. Vom Schulterblatt wird nichts erkannt. Hinter den Kehlbrustplatten
treten sechs Paar halbe obere Wübelbogen, mit Jeu Rippen zur Seite, auf.
S c h ä d e l m it y o r d e r r u m p f . . T a t V. Fig. 3.
Von diesem Exemplar kam • schon das Vordere Ende der Nasenknochen nicht mehr
auf dio Niere, die übrigen Schädelkiiochen sind deutlich zu verfolgen, selbst die Gi-enze
zwischen Nasenbein und Hau])tstiniboin. Das eine Flügelbein hegt am Aussenvapd der
Augenhöhle, das andere dm-chzieht schräg die Augenhöhle derselben Seite. Auch macht
sich der hintere breitere Theil der Fliigelbeine bemerkbar. In den Augeiihölden erkennt
man Ueberreste vom Knochenring. Die eine Ünterkieferhälfte liegt neben dem Schädel, mit
den Zähnen ihm zugekehrt,- die andere ist kaum umgelegt, wie schon aus dem i-undlicheft
Querbruch der Zähne erkannt wird. Von den mit der Unterseite sich darsteÜenden Kehlbrustplatten
sind die stärker gexiölbten seitEchen Schilder mit ihrem hinteren Fortsatze gut
ÜberEefert Das lüntere breitere Ende der. Schlüsselbeine ist napfföimig vertieft. Von einem
Schulterblatt wird nichts wahrgenommen. Man sollte fast glauben, dass von den beiden
Reihen peripherischer Theile dei- Wirbelsäule die aus grösseren Stücken bestehende Reihe
halbe obere Wirbelbogen darsteüte, die andere Reihe Ueberreste von unteren Platten oder
von Keilen, fü r deren’ Verknöcherung cs jedoch noch zu frühe wäi-c. Die Vei-schiedenheit
der Theile beider Reihen könnte daher auch nur eine Folge von der verschiedenen Richtung
seyn, in dev dbr obere Bogen aufbrach. Die liinter den Kehlbi-ustplatten folgenden Rippen
sind’auffallend stark, besonders gegen die gerade zugeschnitteiien Enden hin. Ihre Breite
bcttiK^t sogar m ehr, als füi-'die Länge eines Wirbels sich aimehmon lässt, so dass, wenn
aucli “die Rippe durch Knorpel verbunden ivar, das flache obere Ende mehr vertikal gcrich-
tet o-ewesen seyn musste. TVfeiter hinten werden die Rippen .auffallend geringer. Die meisten
Rippen sind aufgebrochen, ivobei man sicht; dass sic aus einer dünneren Rölu-e bestehen,