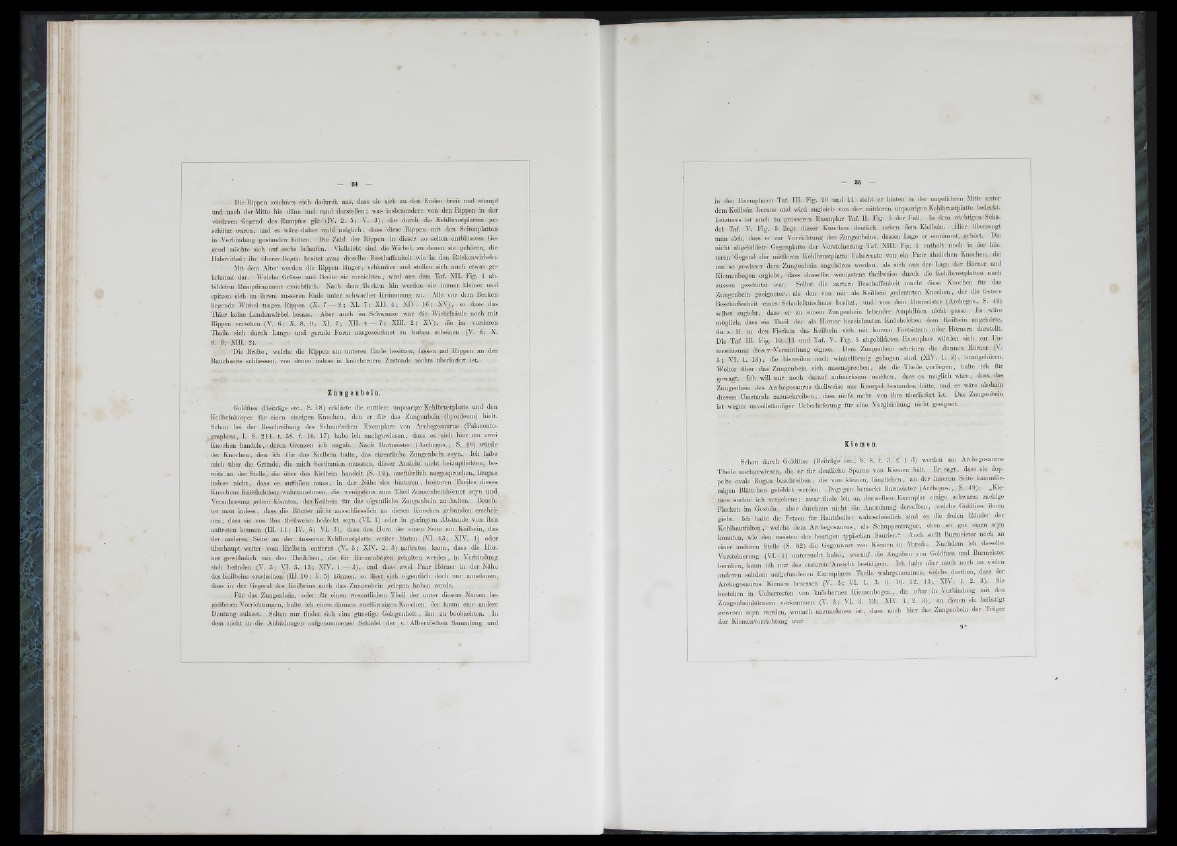
- 34 -
Die Kippen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich an den Enden breit und stumpf
und nach der Mitte hin dünn und rund dai-stellen ; was insbesondere von den Rippen in der
vorderen Gegend dos Rumpfes gilt (ITT 2. 5; TT 3 ), die durch die Kehlbrustplatten geschützt
w aren, und es wiire daher v'ohl möglich, dass diese Rippen mit den Seitenplatten
in Tterbindung gestanden hatten. Die Zahl der Rippen in dieser so selten entblössten Gegend
möchte sich auf sechs bchiulcii. Vielleicht sind die Wirbel, zu denen sie gehören, die
Halswirbel; iiir oberer BogCn besitzt ganz dieselbe Beschaffenheit wie in den Rückenwirbeln.
Mit dem Alter iverclen die Rippen länger, schlanker und stellen sich auch etwas gekrümmt
dar. Welche Gressc und Breite sie eiTeichtcn, wird aus dem Taf. XII. Fig. 1 abbildeten
Rumpffragmeiit ersichtlich. Nach dem /Becken hin werden sie immer Ideiner und
•spitzen sich an ihrem äusseren Ende unter schwacher Krümmung zu. Allo vor dem Becken
liegende Wirbel tragen Rippen (X. 7 — 9 ; XI. 7; XII. 4 ; XiV. 16; X V ), so dass das
Thier keine Lendenwirbel besass. Aber auch im Schwänze w ar die Wirbelsäule itoch mit
Rippen versehen {TT 6; X. 8. 9; XI. 7 ; XII. 4 — 7 ; X lll. 2 ; X V ), die im vorderen
Tbeile sich dureh Lange und gerade Form ausgezeichnet zu haben scheinen (T'^. 6; X.
8. 9; XIII. 2). .
Die B reite, welche die Rippen am unteren Ende besitzen, lassen auf Rippen an der
Bauchseite schliessen, von denen indess bi knöchernem Zustande nichts überliefert ist
Z n n g e n h e i D .
Goldfuss (Beiträge etc., S. 18) erklärte die mittlere impaarige Keblbmstplatte und den
Keilbeinkörper für einen einzigen Knochen, den er für das Zungenbein (hj'oideum) hielt.
Schon bei der Beschreibung des Sohnufsebeii Exemplars von Archegosaurus (Ralaeonto-
graphica, I. S. 214. t 38. f. 16. 17) habe ich nachgewiesen, dass es sich hier um zwei
Knochen handele, deren Grenzen ich angab. Nach Burmeister (Ai-chegos., S, 48) Avüi-de
der Knochen, den ich für das Kielbcin halte, das eigentliche Zungenbein seyn. Ich habe
mich über die Giiinde, die mich bestimihen mussten, dieser Ansicht nicht beizupflichten, bereits
an der Steilei die über das Kielbein handelt (S. 19), ausführlich ausgesprochen, läugne
indess n ich t, dass es auffalien m uss, in der Nähe des -hinteren, breiteren Theiles dieses
Knochens Knöchelchen walu-zunehmen, die n-enigstens zum Theil Zungenbeinhörner soj'n und
T^eranlassung geben könnten, das Keilbein für das eigentliche Zungenbein zu halten. Beachtet
man indess, dass die Höi-ner nicht ausschliesslich an diesen Knochen gebunden erscheinen
, dass sie von ihm theilweise bedeckt seyu (TT 1) oder in geringem Abstande von ihm
auftreten können (III. 11; IV. 5 ; TT. 3), dass das Horn der einen Seite am Keilbein, das
der anderen Seite, an der äusseren Kehlbrustplatte weiter huiten (VI. 13; XIV. 1) oder
überhaupt weiter vom Kielbein entfernt (V. 3 ; XIV. 2. 3) aufti'eteii k an n , dass die Hörner
.ge\\’öhnlich mit den Theilcben, .die für Kiemenbogen gehalten worden, in Verbindung
sich befinden (V. 3 ; TT. 3. 13; XIV. 1 — 3), und dass zwei ITuir Hörner in der Nähe
des Keilbeins erscheinen (III. 10; V. 5) können, so lässt sich eigentlich doch nur annelimen,
dass in der Gegend des Keilbeins auch das Zungenbein gelegen haben w'erde.
Für das Zungenbein, oder für einen ivcsentlichen Tlicil der unter diesem Namen begriffenen
Vorrichtungen, halte ich einen dünnen stielföi-migen Knochen, der kaum eine andere
Deutung zulässt. Selten nur findet sich eine günstige Gelegenheit, ihn zu beobacliten. lit
dem nicht in die Abbildungen aufgenoinmenen Schädel der v. Alberti’schen Sammlung und
in den Exemplaren Taf. III. Fig. 10 und 11 steht er hinten in der ungefähren Mitte unter
dem Keilbein heraus und wü-d zugleich von der mittleren unpaarigen Kelilbmstplatte bedeckt.
Letzteres ist auch im grösseren Exemplar 'l'af. II. Fig. 5 der Fall, ln dem wichtigen Schädel
Taf. V. Fig. .5 liegt dieser Knochen deutlich neben dem Kielbeiii. Hier überzeugt
man sich, dass er zur Vorrichtung des Zimgenbeins, dessen Lage er einnimmt, gehört. Die
nicht abgcbildetc Gegenplatte der Verstemerung Taf. XIU. Fig. 1 entliält noch in der hinteren
Gegend der mittleren Kehlbrastplatte Ueberreste von ein Paar ähnliclmn Knocheu, die
um so gewisser dem Zungenbein angehören w erden, als sich aus der Lage 'der Horner und
Kiemenbogen ergiebt, dass dasselbe wenigstens tlieilweise durch die Kehlbrustplatten nach
aussen geschützt war. Selbst die zartere Beschaffenheit macht diese Knochen für das
Zungenbein geeigneter,, als den von mir als Keilbein gedeuteten Knochen, der die festere
Beschaffenheit eines Scliädelknocliens besitzt, und' von dem Bunneister (Archegos., S. 49)
selbst zugiebt, dass er zu einem Zungenbein lebender Amplijbicn nicht passe. I..S wäre
möglich, dass ein Theil der als Hörner bezeichneten Knöchelchen dem Keilbein angebörte,
da z. B. in den Fisclien das Keilbein sich mit kurzen Fortsätzen oder Hörnern darstellt.
Die Taf. III. Fig. 10. 11 und Taf. V. Fig. 5 abgebildeten Exemplare würden sich zur Unterstützung
dieser T'ermuthung eignen. Dem Zungenbein scheinen die dünnen Hörner (V.
3 ; VI. 1. 13), die bisweilen auch winkelförmig gebogen sind (XITT 1. 2 ), anzugebören.
Weiter über das Zungenbein sich auszusprechen, als die Theile vorliegen, halte ich für
gewagt. Ich will nur noch darauf aufmerksam m achen, dass es möglich w äre, dass das
Zungenbein des Ai-chegosaurus tlieilweise aus Knorpel bestanden hätte, und es wäre alsdann
diesem Umstande zuzuschreiben, dass nicht mehr von ihm überliefert ist. Das Zungenbein
ist wegen unvollständiger Ueberlieferang ftir eine Vergleichung nicht geeignet.
Schon durch Goldfuss (Beiträge etc., S. 8. t. 3. f. 1 d) werden am Archegosam-us
Theile nachgewiesen, die er für deutliche Spuren von Kiemen halt. Er sagt, dass sie doppelte
ovale Bogen beschreiben, die von kleinen, länglichen, an der inneren Seite kammförmigen
Blättchen gebildet werden. -Dagegen bemerkt Bunneister (Archegos., S. 49): „Kiemen
suchte ich vergebens; zwar finde ich an demselben Exemplar einige schwarze zackige
Flecken im Gestein, aber durchaus nicht die Anordnung derselben, welche Goldl'uss ihnen
giebt. Ich halte die Fetzen für Hautthcile: wahrscheinlich sind es die fi-eien Ränder der
Kehlbautfaltcn, welche dem Archegosaurus, als Schuppenträger., eben so gut eigen seyn
konnten, wie den meisten der heutigen typischen Saurier.“ Auch stellt Bui-meister noch an
einer anderen Stelle (S. 62) die Gegenwart von Kiemen in Abrede. Nachdem ich dieselbe
Versteinerung (\T . i) untersucht habe, worauf die Angaben von Goldfuss und Burmcister
• beruhen, kann ich nur des ersteren Ansicht bestätigen. Icli habe aber auch noch an vielen
anderen seitdem aufgefundenen Exemplaren Theile wahrgenomnien, welche dartUun, dass der
Archegosam-us Kiemen besessen (V. 3 ; VI. 1. 3. 6. 10. 12. 13; XIV. 1. 2. 3). Sie
bestehen in Ucberresten von knöchernen Kiemenbogon, die öfter in Verbindung mit den
Zungcnbeinhörnem Vorkommen (V. 3; VI. 3. 13; XIV, 1. 2. 3 ), an denen sie befestigt
gewesen seyn werden, wonach anzunehmen ist, dass auch hier da.s Zungenbein der Träger
der Kicmenvorrichtung war.