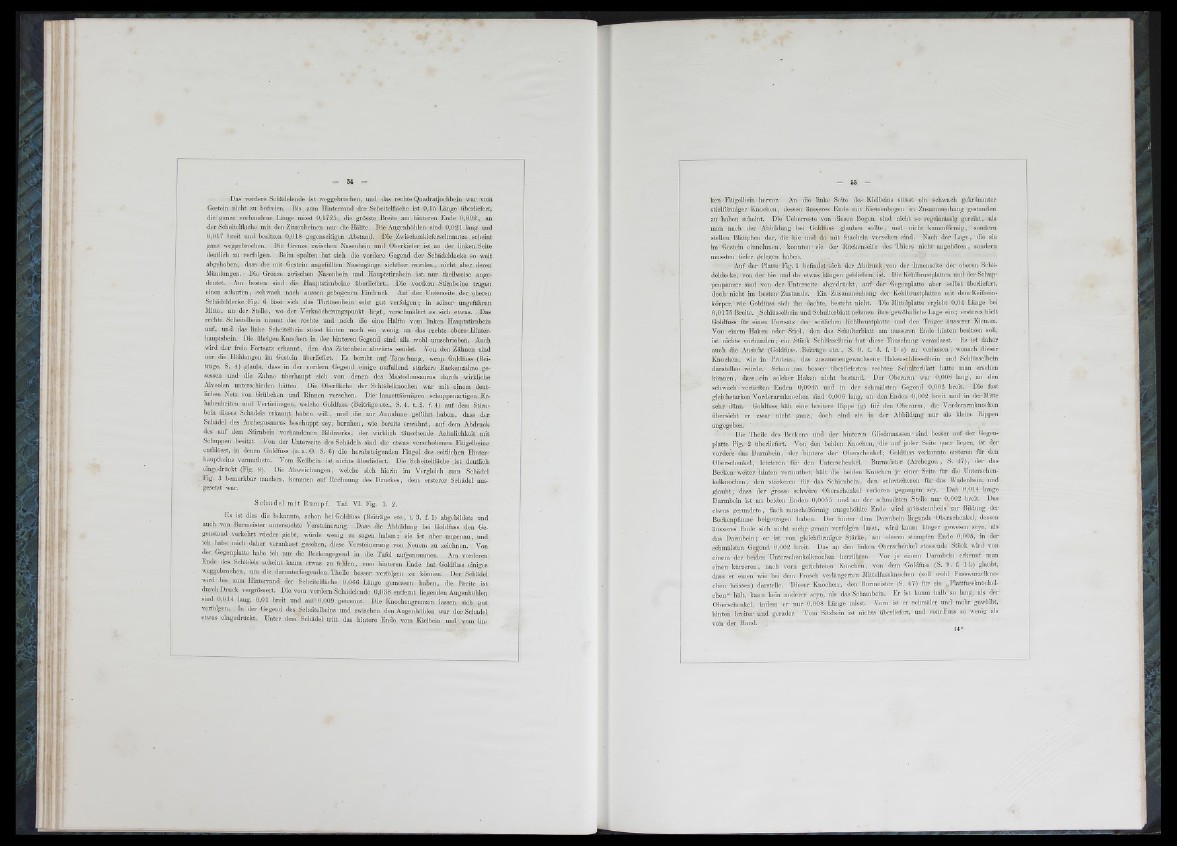
- 3* -
Das vordere Sclmdclende ist weggebrochen, und dos rechte Quadratjochbein war vom
Gestein nicht zu befreien. Bis zum Hinterrand der Sclieitelfläche ist 0,15 Länge überliefert,
die ganze vorhaudene Länge misst 0,1725, die grösste Breite am hinteren Ende 0,092, an
•der Scheitelfläche mit den Zitzenbeinen nur die Hälfte. Die Augenhöhleu sind 0,021 lang und
0,017 breit und besitzen 0,018 gegenseitigen Abstand. Die Zivischenkieferschnautze scheint
ganz weggebrochen. Die Grenze zwischen Nasenbein und Oberkiefer ist an der linken, Seite
deutlicli zu vei-folgen. Beim spalten hat sich die vordere Gegend der Schädeldecke so weit
abgehoben, dass die mit Gestein angefüllten Nasengänge sichtbar.w urden, nicht aber deren
Mündungen. Die Grenze zwischen Nasenbein und Hauptstimbein ist nur theilweise angedeutet.
Am besten sind die Hauptstirnbeine überliefert.. Die vordem Stimibeine tragen
einen scharfen, schwach nach aussen gebogenen Eindruck. Auf der Unterseite der oberen
Scliädeldecke Fig. 6 lässt sich das Thränenbein sehr gut verfolgen; in seiner uiigetähr.en
Mitte, an der Stelle, wo der Verknöcherungspunkt liegt, verschmälert es sich etwas. Das
reclite Scheitelbein nimmt das ¡-echte und noch die eine Hälfte vom linken Hauptstimbein
auf, und das linke Scheitelbein stösst hinten noch ein wenig an das rechte obere Hinterhauptsbein.
Die übrigen Knochen in der hinteren Gegend sind alle wohl umschrieben. Auch
wird der freie Fortsatz erkannt, den das Zitzenbein abwärts sendet. Von den Zähnen sind
nur die Höhlungen im Gestein überliefert. Es beruht auf Täuschung, wenji Gqldfuss (Beiträge,
S. 4) glaubt, dass in der vordem Gegend einige auffallend stärkere Backenzähne gesessen
und die Zähne überhaupt sich von denen des Mastodonsaurus durch wirkliche
Alveolen unterschieden hätten. Die Oberfläche der Schädelknochen war mit einem deutlichen
Netz von Grübchen und Rinnen versehen. Die lanzettfömiigen schuppenai-tigen E rhabenheiten
und Vertiefungen, welche Goldfuss (Beitiäge etc., S. 4. t. 2. f. 4) auf dem Stirn-
bein dieses Schädels erkannt haben will, und die zur Annahme geführt haben, dass der
Schädel des Archegosaurus beschuppt sey, beruhen, wie bereits erw ähnt, auf dem Abdruck
des auf dem Stirnbein vorhandenen Bildwerks, der wirklich täuschende Aehnlichkeit mit
Scluippen besitzt. Von der Unterseite des Schädels sind die etwas verschobenen Fliigelbeine
entblösst, in denen Goldfuss (a. a. 0 . S. 6) die herabsteigenden Flügel des seitlichen Hinterhauptbeins
vermutliete. Vom Keilbein ist nichts überliefert. Die Scheitelfläche ,ist deu.tlich
eingednickt (Fig, 8). Die Abweichungen, welche sich hierin im Vergleich zum Schädel
Fig. 3 bemerkbar machen, kommen auf Rechnuug des Druckes, dem, ersterer Schädel ausgesetzt
war.
S c h ä d e l m it R u m p f. Taf. VI. Fig. 1. 2.
Es ist dies die bekannte, schon bei Goldfuss (Beiträge etc., t. 3. f. 1) abgebildete und
aucli von Burmeister untersuchte Versteinerung. Dass die Abbildung bei Goldfuss den Gegenstand
verkehrt xvieder giebt, würde wenig zu sagen haben; sie ist aber ungenau, und
ich habe mich daher veranlasst gesehen, diese Versteiperung von Neuem zu zeichnen. Von
der Gegenpiatte habe idi nur die Beckengegeiid in die Tafel aufgenommen. A,n vorderen
Ende des Schädels scheint kaum etwas zu fehlen, vom hinteren Ende hat Goldfuss einiges
weggebrochen, um die darunterliegenden .Theile besser verfolgen zu können. Der Schädel
;vii-d bis zum Hintei-rand der Scheitelfläche 0,066 Länge gemessen haben, die Breite ist
durch Druck vergrössert. Die vom vordem Schädclende 0,038 entfernt liegenden Augenhöhlen
sind 0,014 lang, 0,01 breit und auf'0,009 getrennt. Die Knochengrenzen lassen sich gut
verfolgen. In der Gegend des Scheitelbeins und zwischen den Augenliohleii war der Schädel
etwas eingedrückt. Unter dem Schädel tritt das hintere Ende vom Kielbcin und vom lin—
55 —
ken Flügelbeiii hervor. An die Unke Seite des Kiclbeins stösst ein schwach gekrümmter
stielförmiger K nochen, dessen äusseres Ende mit Kieinenbogen in Zusammenhang gestanden
zu haben scheint. Die Ueberreste von diesen Bogen sind nicht so regelmässig gereiht, als
man nach der Abbildung bei Goldfiiss glauben sollte, und nicht kammförmig, sondern
stellen Blättchen dar, die hie und da mit Stacheln versehen sind. Nach der L age, die sie
im Gestein einnehmen, konnten sic der Rückenseite des Thiers nicht' angehören, sondern
mussten tiefer gelegen haben.
Auf der Platte Fig. 1 befindet sieb der Abdruck von der Innenseite der oberen Schädeldecke,
von der hie und da etwas hängen geblieben ist. Die Kehlbj-ustplatten und der Schuppenpanzer
sind von -der Unterseite abgcdrückt, auf der Gegenplatte aber selbst überliefert,
doch nicht im besten Zustande. Ein Zusammenhang der Kehlbrustplatten mit demKeilbein-
köipei-,' wie Goldfuss sich ihn dachte, besteht nicht. Die Miltelplatte ergiebt 0,04 Länge bei
0,0175 Breite. Schlüsselbein und Schultei-blatt nehmen ihre gewöiinliclie Lage ein ; ersteres hielt
Goldfnss für einen Fortsatz der seitlichen Kehlbrustplatte und den Triiger äusserei- Kiemen.
Von einem Haken oder Stiel, den das Schulterblatt am äusseren Ende hinten besitzen soll,
ist nichts vorhanden; ein Stück Sclüüsselbein hat diese TTiuschung veranlasst. Es ist daher
auch die Ansicht (Goldfuss, Beiträge etc., S. 9. t. 3. f. 1 -e) zu verlassen, wonach dieser
Knochen, wie in P roteus, das ziisammengmvachsene Hakenschlüsselbein und Schlüsselbein
darstellen würde. Schon am besser überlieferten rechten Schultci-blatt hätte man ersehen
können, dass ein solcher Haken nicht bestand. Der Obei-ai-m war 0,008 lang, an den
schwach vei-tieften Enden 0,0045 und in der schmälsten Gegend 0,003 breit. Die fast
gleichstaj-kcn Vorderannknochen sind 0,006 lang; an den Enden 0,002 breit und in der Mitte
sehr dünn. Goldfuss liält eine breitere Rippe (g) für den O berann, die Vorderarmknochen
übersieht er zwar nicht ganz, doch sind sie in der Abbildung nur als kleine Rippen
angegeben.
Die Theile des Beckens und der hintereil Gliedmaassen • sind besser auf der Gegenplatte
Fig. 2 überliefert. T'on den beiden Knochen, die auf jeder Seite quer liegen, ist der
vordere das D armbein, der hintere der Oberselienkel; Goldfuss verkannte ersteren für den
Oberschenkel, letzteren für den Unterschenkel. Burmeister (Archegos., S. 47), der das
Becken weiter hinten vennuthet, hält die beiden Knochen je einer Seite fiir die Unterschen-
kelknochen, den stärkeren für das Schienbein, den schwächeren für das Wadenbein, und
glaubt, dass der grosse scliwöi-e Oberschenkel verloren gegangen sey. Das 0,014 lange
D armbein ist an beiden Enden 0,0055 und au der schmälsten Stelle nm- 0,002 breit. Das
etwas gerundete-, flach muschelfonnig ausgchöhlte Ende wird grösstentheils zur Bildung der
ßeckenpfänne beigetragen haben. Der hinter dem Darmbein liegende -Oberschenkel, dessen
äusseres Ende sich nicht mehr genau verfolgen lässt, wird kaum länger gewesen seyn, als
das Darmbein; er ist von gleichföi-miger Stärke, am oberen stumpfen Ende 0,005, in der
schmälsten Gegend 0,002 breit. Das an den linken Obei-sclicnkel stossende Stück wird von
einem der beiden 'Unterschenkelknochen hen-ühren. T^'or je einetn Darmbein erkennt man
einen kürzeren, nach vom gerichteten Knochen, von dem "Goldfuss (S. 9. f. 1 k) glaubt,
dass er einen wie bei dem Frosch v e r l ä n g e r t e n -Mittelfussknochen (soll wohl l'uss;vurzelkno-
chen heisscn) darstelle. Dieser Knochen, den Burmeister (S. 47) für ein „Plattfussknöchel-
chcn“ hält, kann kein anderer sejm, als das Scliambein. Er ist kaum halb so lang, als der
Oberschenkel, indem er nur 0,008 Länge misst. '\'om ist er schmäler und mehr gewölbt,
hinten breiter und gerader. T’om Sitzbein ist nichts überliefert, und vom Fuss so wenig als
von der Hand. 14*