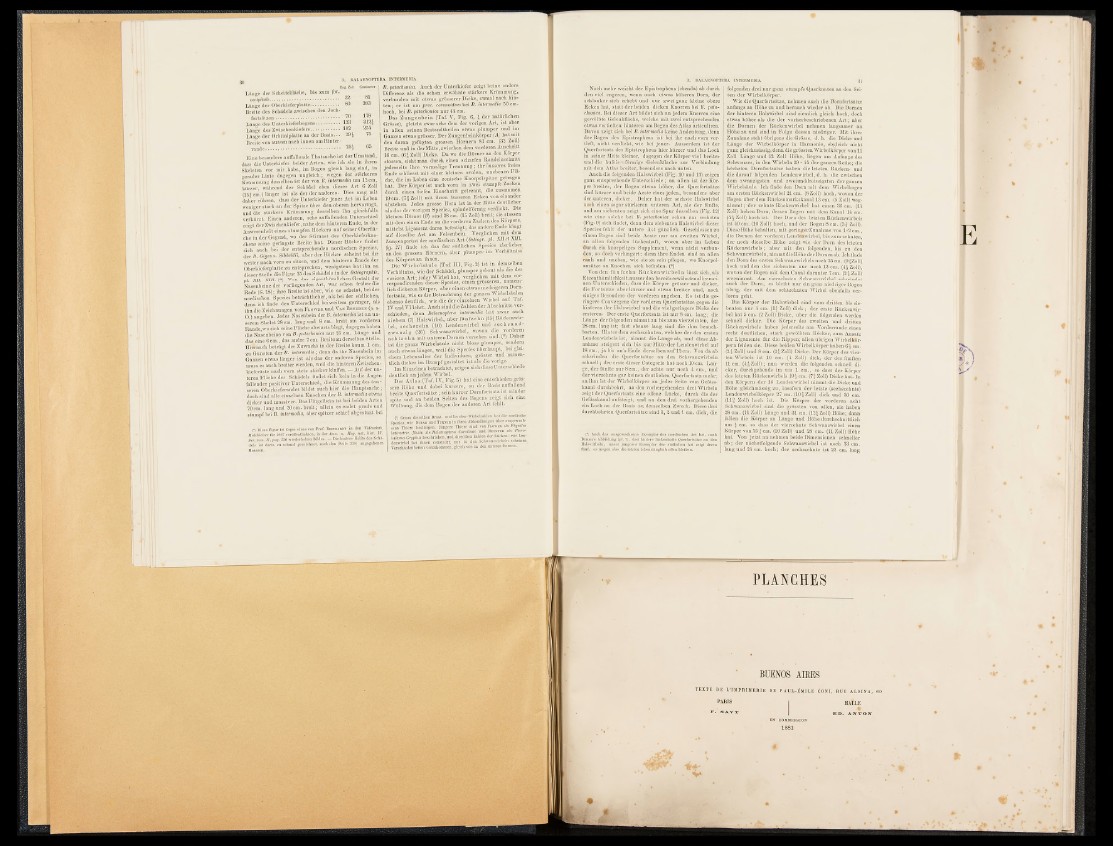
3 . BALAENOPTERA INTERMEDIA
Lange der Scheitelfläche, bis zum for.
occipilale........................................................
Länge der Oberkieferplatte....................... 80
Breite des Schädels zwischen den Jochfortsätzen
........................................... 70
Länge des Unterkieferbogens......................123
Länge des Zwischenkiefers..........................102
Länge der Orbitalplatte an dr--"-~:~ 00
Breite von aussen nach innen
B. palachonica. Auch der Unterkiefer zeigt keine andere
n Hinter-
65
Eine besonders auffallende Thatsache ist der Umstand,
dass die Unterkiefer beider Arten, wie ich sie in ihren
Skeleten vor m ir.habe, im Bogen gleich lang sind, in
gerader Linie dagegen ungleich; wegen der stärkeren
Krümmung desselben ist der von B. intermedia um 12cm,
kürzer, während der Schädel eben dieser A rt 6 Zoll
(15J cm.) länger ist als der der anderen. Dies mag mit
daher rühren, dass der Unterkiefer jener A rt im Leben
weniger stark an der Spitze über den oberen hervorragt,
und die stärkere Krümmung desselben ihn gleichfalls
verkürzt. Einen anderen, sehr auffallenden Unterschied
zeigt der Zwischenkiefer, nahe dem hinteren Ende, in der
Anwesenheit eines stumpfen Höckers auf seiner Oberfläche
Differenz als die schon erwähnte stärkere Krümmung,
verbunden m it etwas grösserer Dicke, zumal nach hinten;
er ist am proc. coronoidexis bei ß . intermedia 50 cm.
hoch, bei B. palachonica nur 44 cm.
Das Z u n g e n b e in (Taf. V, Fig. 6, $ der natürlichen
Grösse), gleicht zwar sehr dem der vorigen A rt, ist aber
in allen seinen Bestandtheilen etwas plumper und im
Ganzen etwas grösser. Der Zungenbeinkörper (A) hat m it
den daran gefügten grossen Hörnern 81 cm. (32 Zoll)
Breite und in der Mitte, zwischen dem vorderen Auschritt
16 cm. (6$ Zoll) Dicke. Da wo die Hörner an den Körper
stossen, sieht mau durch einen scharfen Randeinschnitt
jederseits ihre vormalige Trennung ; ihr äusseres freies
Ende schliesst m it einer kleinen ovalen, unebenen Fläche,
die im Leben eine conische Knorpelspitze getragen
hat. Der Körper ist nach vorn in zwei stumpfe Zacken
durch einen tiefen E inschnitt getrennt, die zusammen
19cm. (7g Zoll) m it ihren äusseren Ecken von einander
abstehen. Jedes grosse Horn ist in der Mitte deutlicher
als das der vorigen Species, spindelförmig verdickt. Die
kleinen Hörner (ß) sind 38 cm. (15 Zoll) breit; sie stossen
mit dem einen Ende an die vorderen Zacken des Körpers,
m ittelst Ligament daran befestigt; das andere Ende hängt
auf dieselbe A rt am Felsenbein. Verglichen m it dem
Zungengerüst der nordischen A rt (Osléogr. pl. XII cl XIII,
ftg. 27) finde ich das der südlichen Species zierlicher
I an den grossen Hörnern, aber plumper im Verhältniss
des Körpers zu ihnen.
I Die W irb e ls ä u le (Taf. III, Fig. 2) ist in dëmselben
Verhältniss, wie der Schädel, plumper gebaut als die der
vorigen A rt; jeder Wirbel hat, verglichen m it dem cor-
respondirenden dieser Species, einen grösseren, namentlich
in der Gegend, wo der Stirnast des Oberkieferknochens
seine geringste Breite hat. Dieser Höcker findet
sich auch bei der entsprechenden nordischen Species,
der B. Gigas s. Sibbaldii, aber der Höcker scheint bei ihr
weiter nach vorn zu sitzen, und dem hinteren Rande der 1
Obcrkieferplatte zu entsprechen, wenigstens h at ihn an
dieserStelle die F igur 25 des Schädels in der Osliographxe,
Pl. XII. XIII. (*) Von der eigentüm lichen Gestalt der
Nasenbeine der vorliegenden A rt, war schon früher die
Rede (S. 18); ihre Breite ist aber, wie es scheint, bei der
nordischen Species beträchtlicher, als bei der südlichen,
denn ich finde den Unterschied bei weitem geringer, als
ihn die Zeichnungen von F lo w e r und Vau Bereden (a. a.
0.) angeben. Jedes Nasenbein d erß. intermedia ist an unserem
Skelet 28 cm. lang und 8 cm. breit am vorderen
Rande,wo sich seine Fläche abwärts biegt, dagegen haben
die Nasenbeine von ß. palachonica nur 25 cm. Länge und
das eine 6cm ., das andre 7 cm. BreiteanderselbenStelle.
Hiernach beträgt der Zuwachs in der Breite kaum 1 cm.
zu Gunsten der ß . intermedia; denn da ih r Nasenbein im
Ganzen etwas länger ist als das der anderen Species, so
muss es auch breiter werden, weil die hinteren Zwischenkieferäste
nach vorn stets stärker klaffen. — Auf der unteren
Fläche des Schädels findet sich kein in die Augen
fallender positiver Unterschied, die Krümmung des äusseren
Oberkieferandes bildet auch hier die H auptsache;
doch sind alle einzelnen Knochen der ß. intermedia etwas
dicker und massiver. Das Flügelbein ist bei beiden Arten
70 cm. lang und 20 cm. b re it; allein es endet grade und
stumpf bei B. intermedia, aber spitzer schief abgestuzt bei
(*) Biese Figur ist Copie eines von Prof. B eindaudt in den Kidonskafc.
Sleddetelser für 1867 veröffentlichten, in der Ann. ti. Mag. nat. hat. 1 K.
Ser. tom. II, pag. SSO wiederholten Bildes. — Die
dcls ist darin zu schmal gezeichnet, nach den (i
dickeren Körper, aber einen etwas niedrigeren Dorn-
fortsatz, wie es die Betrachtung der ganzen Wirbelsäulen
ebenso deutlich, wie die der einzelnen Wirbel auf Taf.
IV und V I lehrt. Auch sind die Zahlen der Abschnitte verschieden,
denn Balaenoptera intermedia hat zw ar auch
sie b e n (7) Halswirbel,- aber fü n fz e h n (15) Rückenwirbel,
se c h s z e h n (16) Lendenwirbel und s e c h s u n d zw
a n z ig (26) Schwanzwirbel, wovon die vorderen
a c h tz e h n m it unteren Dornen versehen sind. (*) Daher
ist die ganze Wirbelsäule nicht bloss plumper, sondern
auch etwas länger, weil die Species überhaupt, bei gleichem
Lebensalter der Individuen, grösser und namentlich
dicker im Rum pf gestaltet ist als die vorige.
Im Einzelnen betrachtet, zeigen sich dieseUntescbiede
deutlich D er A atlna jse d(Temaf .W IVir,b Feli.g. 5) hat eine entschieden grössere
Höhe und dabei kürzere, an der Basis auffallend
breite Querfortsätze ; sein kurzer Dornfortsalz ist minder
spitz und an beiden Seiten dès Bogens zeigt sich eine
Wölbung, die dem Bogen der anderen A rt fehlt.
I Lcnden-Wirbclzohlcn hat die nordische
in ihren Abhandlungen über nusgcwach-
! und Mubnter als Ptcro-
■ dieselben Brust- un<
re bestätigen; längere 1s Balaenoplert
Gryphus beschrieben, und dieselben Zahlt»
denwirbol bei ihnen constalirt; nur in den Sei
Verschiedenheiten vorzukommen, gleich wie in de
wirbeln scheinen
Noch mehr weicht der Epistropheus (ebenda) ab durch
den viel engeren, wenn auch etwas höheren Dorn, der
schlanker sich erhebt und nur zwei ganz kleine obere
Ecken hat, statt der beiden dicken Knorren bei ß . pata-
chonica. Bei dieser A rt bildet sich an jedem Knorren eine
gewölbte Gelenkfläche, welche mit zwei entsprechenden
etwas vertieften hinteren am Bogen des A tlas articuliren.
Davon zeigt sich bei B. intermedia keine Andeutung, denn
der Bogen des Epistropheus ist bei ih r nach vorn vertieft,
nicht verdickt, wie bei jener. Ausserdem ist der
Querfortsatz des Epistropheus hier kürzer und das Loch
in seiner Mitte kleiner, dagegen der Körper viel breiter
und die hufeisenförmige Gelenkfläche zur Verbindung
m it dem Atlas breiter, besonders nach unten.
Auch die folgenden Halswirbel (Fig. 10 und 11) zeigen
ganz entsprechende U nterschiede; an allen ist der Körper
breiter, der Bogen etwas höher, die Querfortsätze
sind kürzer und beide Aeste eines jeden, besonders aber
der unteren, dicker. Daher hat der sechste Halswirbel
noch einen sogar stärkeren unteren Ast, als der fünfte,
und am siebenten zeigt sich eine Spur desselben (Fig. 12)
wie eine solche bei ß . palachonica schon am sechsten
(Fig. 9) sich findet, denn dem siebenten Halswirbel dieser
Species fehlt der untere A st gänzlich. Geschlossen zu
einem Bogen sind beide Aeste nur am zweiten Wirbel,
an allen folgenden lückenhaft, waren aber im Leben
durch ein knorpeliges Supplement, wenn nicht verbunden,
so doch verlängert; denn ihre Enden sind an allen
rauh und uneben, wie sie zu sein pflegen, wo Knorpel-
anzätze an Knochen sich befinden. (*)
Von den fü n fz e h n R ü c k e n w irb e ln lässt sich, als
E igentüm lichkeit, ausser den bereits erwähnten allgemeinen
Unterschieden, dass die Körper grösser und dicker,
die Fortsätze aber kürzer und etwas breiter sind, noch
einiges Besondere der vorderen angeben. E s ist die geringere
Convergenz der vorderen Querfortsätze gegen die
hinteren der Halswirbel und die viel geringere Dicke der
ersteren. Der erste Querfortsatz ist nur 8 cm. lang; die
Länge der folgenden nimmt zu bis zum vierzehnten, der
28 cm. läng ist; fast ebenso lang sind die ihm benachbarten.
Hinter dem sechszehnten, welcher der des ersten
Lendenwirbels ist, nimmt die Länge ab, und diese Abnahme
steigert sich bis zur Mitte der Lendenwirbel auf
18 cm., ja bis an’s Ende derselben auf 12cm. Von da ab
schwinden die Querfortsätze an den Schwanzwirbeln
.schnell; der erste dieser Categorie hat noch 10 cm. Länge,
der fünfte nur 8 cm., der achte nur noch 4 cm., und
der vierzehnte gar keinen deutlichen Querfortsatz mehr;
an ihm ist der Wirbelkörper an jeder Seite vom Gefäss-
kanal durchbohrt, an den vorhergehenden drei Wirbeln
zeigt der Querfortsatz eine offene Lücke, durch die der
Gefässkanal aufsteigt, und an den drei vorhergehenden
ein Loch an der Basis zu demselben Zweck. Diese drei
durchbohrten Querfortsätze sind 3 ,2 und 1 cm. dick, die
n Art zeigt deren
mögen also die letzten lebenslänglich offen bleiben.
folgenden drei nur ganz stumpfe Querkanten an den Seiten
der Wirbelkörper.
Wie die Querfortsätze, nehmen auch die Dornfortsätzo
anfangs an Höhe zu und hernach wieder ab. Die Dornen
der hinteren Halswirbel sind ziemlich gleich hoch, doch
etwas höher als die der vorherbeschriebenen A rt; aber
die Dornen der Rückenwirbel nehmen langsamer an
Höhe zu und sind in Folge dessen niedriger. Mit ihrer
Zunahme steht übrigens die Grösse, d. h. die Dicke und
Länge der Wirbelkörper in Harmonie, obgleich nicht
ganz gleichmässig, denn die grössten Wirbelkörper von 11
Zoll Länge und 12 Zoll Höhe, liegen am Anfänge des
Schwanzes, in den Wirbeln 39 - 44 der ganzen Reihe; die
höchsten Dornfortsätze haben die letzten Rücken- und
die darauf folgenden Lendenwirbel, d. h. die zwischen
dem zwanzigsten und zweiunddreissigsten der ganzen
Wirbelsäule. Ich finde den Dorn m it dem Wirbelbogen
am ersten Rückenwirbel 21 cm. (8Zoll) hoch, wovon der
Bogen über dem Rückenmarkskanal 13 cm. (5 Zoll) wegnimm
t; der zehnte Rückenwirbel hat einen 36 cm. (14
Zoll) hohen Dorn, dessen Bogen m it dem Kanal 14 cm.
(4ä Zoll) hoch ist. Der Dorn des letzten Rückenwirbels
ist 40 cm. (16 Zoll) hoch, und der Bogen 8 cm. (3$ Zoll).
Diese Höhe behalten, m it geringer Zunahme von l-2 cm .,
die Dornen der vorderen Lendenwirbel;, bis zum zehnten,
der noch dieselbe Höhe zeigt wie der Dorn des letzten
R ückenwirbels; aber m it den folgenden, bis zu den
Schwanzwirbeln, nimmt dieHöhe derDornenab. Ich finde
den Dorn des ersten Schwanzwirbels noch 25 cm. ( 9 Zoll)
hoch und den des siebenten .nur noch 12 cm. (41 Zoll),
wovon der Bogen m it dem Canal darunter 7cm. (21 Zoll)
wegnimmt. Am vierzehnten Schwanzwirbel schwindet
auch der Dorn, es bleibt nu r ein ganz niedriger Bogen
übrig, der m it dem achtzehnten Wirbel ebenfalls verloren
geht.
Die Körper der Halswirbel sind vom dritten bis siebenten
nur 4 cm. (1$ Zoll) d ic k ; der erste Rückenwirbel
h at 5 cm. (2 Zoll) Dicke, aber die folgenden werden
schnell dicker. Die Körper des zweiten und dritten
Rückenwirbels haben jederseits am Vorderrande einen
recht deutlichen, stark gewölbten Höcker, zum Ansatz
der Ligamente für die Rippen; allen übrigen Wirbelkörpern
fehlen sie. Diese beiden Wirbelkörper haben 61 cm.
(2$ Zoll) und 8 cm. (3$ Zoll) Dicke. Der Körper des vierten
Wirbels ist 10 cm. (4 Zoll); dick, der des fünften
11cm. (4$ Zoll); nun werden die folgenden schnell dicker,
durchgehends im um 1 cm., so dass der Körper
des letzten Rückenwirbels 19$ cm. (7® Zoll) Dicke hat. In
den Körpern der 16 Lendenwirbel nimmt die Dicke und
Höhe gleichmässig zu, insofern der letzte (sechszehnte)
Lendenwirbelkörper 27 cm. (10$ Zoll) dick und 30 cm.
(111 Zoll) hoch ist. Die Körper der vorderen acht
Schwanzwirbel sind die grössten von allen, sie haben
28 cm. (11 Zoll) Länge und 31 cm. (12$ Zoll) Höhe; dann
fallen die Körper an Länge und Höhe durchschnittlich
um $ cm. so dass der vierzehnte Schwanzwirbel einen
Körper von 25$ cm. (10 Zoll) und 28 cm. (11 Zoll) Höhe
hat. Von jetzt an nehmen beide Dimensionen schneller
ab ; der nächstfolgende Schwanzwirbel ist noch 23 cm.
lang und 24 cm. hoch; der sechszehnte ist 22 cm. lang
E
PLANCHES
BUENOS AIRES
T E X T E D E L ’IM P R IM E R I E D E P A U L -Ë M IL E C O N I, R U E A L S IN A ,
P A W S I H A E L E
K. SA V T | ED. ANTON
E N C O M M IS S IO N
1881