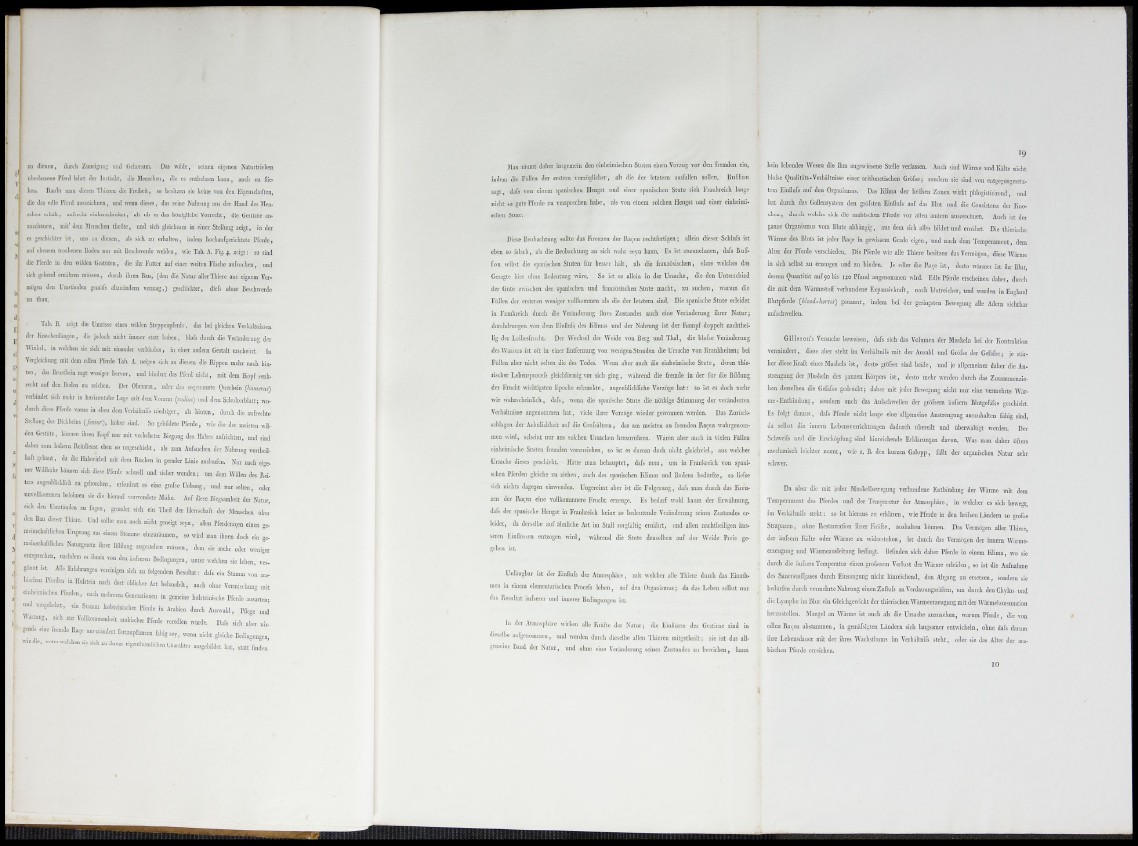
in dienen, durch Zuneigung und Gehorsam. Das wilde, seinen eigenen Naturtrieben
übeiiasscne Pferd lehrt der Instinkt, die Menschen, die es entbehren kann, auch zu fliehen.
Raubt man diesen Thieren die Freiheit, so besitzen sie keine von den Eigenschaften,
die das edle Pferd auszeichnen, und wenn dieses, das seine Nahrung aus der Hand des Menschen
erhalt, aufrecht ciuherschreitet, als ob es das königliche Vorrecht, die Gestirne anzuschauen,
mit dem Menschen thcilte, und sich gleichsam in einer Stellung zeigt, in der
es geschickter ist, uns zu dienen, als sich zu erhalten, indem hochaufgerichtete Pferde,
auf ebenem trockenen Boden nur mit Beschwerde weiden, wie Tab. A. Fig. 4. zeigt: so sind
die Pferde in den wilden Gestüten, die ihr Futter auf einer weiten Flache aufsuchen, und
sich gehend ernähren müssen, durch ihren Bau, (den die Natur allerThiere aus eignem Vermögen
den Umstünden gemäfs abzuändern vermag,) geschickter, diefs ohne Beschwerde
Tab. B. zeigt die Umrisse eines wilden Steppenpferds, das bei gleichen Verhältnissen
der Knochenlängen, die jedoch nicht immer statt haben, blofs durch die Veränderung der
Winkel, in welchen sie sich mit einander verbinden, in einer andern Gestalt erscheint. In
Vergleichung mit dem edlen Pferdo Tab. A. neigen sich an diesem die Rippen mehr nach hinten
, das Brustbein ragt weniger hervor, und hindert das Pferd nicht, mit dem Kopf senkrecht
auf den Boden zu reichen. Der Oberarm, oder das sogenannte Querbein (liumeriu)
verbindet sich mehr in horizontaler Lage mit dem Vorarm (radiiis) und dem Schulterblatt; wodurch
diese Pferde vorne in eben dem Verhältnis niedriger, als hinten, durch die aufrechte
Stellung des Dickbeins (/«nur), hoher sind. So gebildete Pferde, wie die der meisten wilden
Gestüte, können ihren Kopf nur mit verkehrter Biegung des Halses aufrichten, und sind
daher zum höhern Reitdienst eben so ungeschickt, als zum Aufsuchen der Nahrung vortheil.
haft gebaut, da die Halswirbel mit dem Rücken in gerader Linie auslaufen. Nur nach eigener
Willkühr können sich diese Pferde schnell und sicher wenden; um dem Willen des Reiters
augenblicklich zu gehorchen, erfordert es eine grofse Uebung, und nur selten, oder
unvollkommen belohnen s,e d.e hierauf verwendete Mühe. Auf diese Biegsamkeit der Natur,
sich den Umständen zu fugen, gründet sieh ein Theil der Herrschaft der Menschen über
den Bau dieser Thiere. Und sollte man auch nicht geneigt seyn, allen PferderaSen einen «emcinschaftlichcn
Ursprung aus einem Stamme einzuräumen, so wird man ihnen doch ein gemeinschaftliches
Naturgesetz ihrer Bildung zugestehen müssen, dem sie mehr oder weniger
entsprechen, nachdem es ihnen von den äufseren Bedingungen, unter welchen sie leben, vergönnt
ist. Alle Erfahrungen vereinigen sich zu folgendem Resultat: dafs ein Stamm von ara
bischen Pferden in Holstein „ach dort üblicher Art behandelt, auch ohne Vermisch™» mit
einheimischen Pferden, nach mehreren Generationen in gemeine holsteinische Pferde ausartenund
umgekehrt, ein Stamm holsteinischer Pferde in Arabien durch Auswahl, Pflege und
Wartung, sich zur Vollkommenheit an.biscl.er Pferde veredlen würde. Dafs sich aber nirgends
eine fren.de Ra?e unverändert fortzupflanzen fähig sey, wenn nicht gleiche Bedingungen
wredre, unter welchen sie sich zu ihrem eigentümlichen Charakter ausgebildet hat, stattfinden'
Man räumt daher insgemein den einheimischen Stuten einen Vorzug vor den fremden ein,
indem die Füllen der erstem vorzüglicher, als die der letztern ausfallen sollen. Buffon
sa"t dafs von einem spanischen Hengst und einer spanischen Stute sich Frankreich lange
nicht so gute Pferde zu versprechen habe, als von einem solchen Hengst und einer einheimischen
Stute.
Diese Beobachtung sollte das Kreuzen der Rafen rechtfertigen; allein dieser Schlufs ist
eben so falsch, als die Beobachtung an sich wahr seyn kann. Es ist anzunehmen, dafs Buffon
selbst die spanischen Stuten für besser hält, als die französischen, ohne welches das
Gesagte hier ohne Bedeutung wäre. So ist es allein in der Ursache, die den Unterschied
der Güte zw ¡sehen der spanischen und französischen Stute macht, zu suchen, warum die
Füllen der ersteren weniger vollkommen als die der letztern sind. Die spanische Stute erleidet
in Frankreich durch die Veränderung ihres Zustandes auch eine Veränderung ihrer Natur;
durchdrungen von dem Einflufs des Klimas und der Nahrung ist der Kampf doppelt nachtheilig
der Leibesfrucht. Der Wechsel der Weide von Berg und Thal, die blofse Veränderung
des Wassers ist oft in einer Entfernung von wenigen Stunden die Ursache von Krankheiten; bei
Füllen aber nicht selten die des Todes. Wenn aber auch die einheimische Stute, deren thierischer
Lebensprocefs gleichförmig vor sich ging, während die fremde in der für die Bildung
der Frucht wichtigsten Epoche erkrankte, augenblickliche Vorzüge hat: so ist es doch mehr
wie wahrscheinlich, dafs, wenn die spanische Stute die nöthige Stimmung der veränderten
Verhältnisse angenommen hat, viele ihrer Vorzüge wieder gewonnen werden. Das Zurückschlagen
der Aehnlichkeit auf die Grofsältern, das am meisten an fremden Ra<;en wahrgenommen
wird, scheint nur aus solchen Ursachen herzurühren. Wären aber auch in vielen Fällen
einheimische Stuten fremden vorzuziehen, so ist es darum doch nicht gleichviel, aus welcher
Ursache dieses geschieht. Hätte man behauptet, dafs man, um in Frankreich von spanischen
Pferden gleiche zu ziehen, auch des spanischen Klimas und Bodens bedürfte, so liefse
sich nichts dagegen einwenden. Ungereimt aber ist die Folgerung, dafs man durch das Kreuzen
der Ra(jen eine vollkommnere Frucht erzeuge. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung,
dafs der spanische Hengst in Frankreich keine so bedeutende Veränderung seines Zustandes erleidet,
da derselbe auf ähnliche Art im Stall sorgfältig ernährt, und allen nachteiligen äusseren
Einflüssen entzogen wird, während die Stute denselben auf der Weide Preis ge-
Unläugbar ist der Einflufs der Atmosphäre, mit welcher alle Thiere durch das Einathmen
in einem clemcntarischen Procefs leben, auf dcir Organismus; da das Leben selbst nur
das Resultat äufserer und innerer Bedingungen ist.
In der Atmosphäre wirken alle Klärte der Natur; die Einflüsse der Gestirne sind in
dieselbe aufgenommen, und werden durch dieselbe allen Thieren mitgetbeilt j sie ist das allgemeine
Band der Natur, und ohne eine Veränderung seines Zustandes zu bewirken, kann
kein lebendes Wesen die ihm angewiesene Stelle verlassen. Auch sind Wärme und Kälte nicht
bloise Qualitäts-Verhältnisse einer arithmetischen Gröfse; sondern sie sind von entge»en<.esetztem
Einflufs auf den Organismus. Das Klima der heifsen Zonen wirkt phlogisticirend, und
hat durch das Gallensystem den größten Einflufs auf das Blut und die Consistenz der Knochen,
durch welche sich die arabischen Pferde vor allen andern auszeichnen. Auch ist der
ganze Organismus vom Blute abhängig, aus dem sich alles bildet und ernährt. Die tliierische
Wärme des Bluts ist jeder Rare in gewissem Grade eigen, und nach dem Temperament, dem
Alter der Pferde verschieden. Die Pferde wie alle Thiere besitzen das Vermögen, diese Wärme
in sich selbst zu erzeugen und zu binden. Je edler die Rare ist, desto wärmer ist ihr Blut,
dessen Quantität auf 90 bis 120 Pfund angenommen wird. Edle Pferde erscheinen daher, durch
die mit dem "Wärmestoff verbundene Expansivkraft, noch blutreicher, und werden in England
Blutpferde (blood-horses) genannt, indem bei der geringsten Bewegung alle Adern sichtbar
aufschwellen.
Gilisson's Versuche beweisen, dafs sich das Volumen der Muskeln bei der Kontraktion
vermindert, diese aber steht im Verhältnis mit der Anzahl und Gröfse der Gefäfse; je stärker
diese Kraft eines Muskels ist, desto gröfser sind beide, und je allgemeiner daher die Anstrengung
der Muskeln des ganzen Körpers ist, desto mehr werden durch das Zusammenziehen
derselben die Gefäfse gedrückt; daher mit jeder Bewegung nicht nur eine vermehrte Wärme
Entbindung , sondern auch das Aufschwellen der gröfsern äufsem Blutgefäfse geschieht.
Es folgt daraus, dafs Pferde nicht lange eine allgemeine Anstrengung auszuhalten fällig sind,
da selbst die innern LebensVerrichtungen dadurch übereilt und überwältigt werden. Der
Schweifs und die Erschöpfung sind hinreichende Erklärungen davon. Was man daher öfters
mechanisch leichter nennt, wie z. B. den kurzen Galopp, fällt der organischen Natur sehr
Da aber die mit jeder Muskelbewegung verbundene Entbindung der Wärme mit dem
Temperament des Pferdes und der Temperatur der Atmosphäre, in welcher es sich bewe»t
im Verhältnis steht: so ist hieraus zu erklären, wie Pferde in den heifsen Ländern so "rofse
Strapazen, ohne Restauration ihrer Kräfte, aushalten können. Das Vermögen aller Thiere
der äufsem Kälte oder Wärme zu widerstehen, ist durch das Vermögen der innern Wärmeerzeugung
und Wärmeausleitung bedingt. Befinden sich daher Pferde in einem Klima, wo sie
durch die äufsere Temperatur einen gröfseren Verlust der Wärme erleiden, so ist die Aufnahme
des SaucrstolTgascs durch Einsaugung nicht hinreichend, den Abgang zu ersetzen, sondern sie
bedürfen durch vermehrte Nahrung einen Zuflufs an Verdauungssäften, um durch den Chylus und
die Lymphe im Blut ein Gleichgewicht der thierischen Wärmeerzeugung mit der Wärmekonsuintion
herzustellen. Mangel an Wärme ist auch als die Ursache anzusehen, warum Pferde, die von
edlen Raejen abstammen, in gemäfsigten Ländern sich langsamer entwickeln, ohne dafs darum
ihre Lebensdauer mit der ihres Wachsthunis im Verhältnifs steht, oder sie das Alter der arabischen
Pferde erreichen.
XO
mm