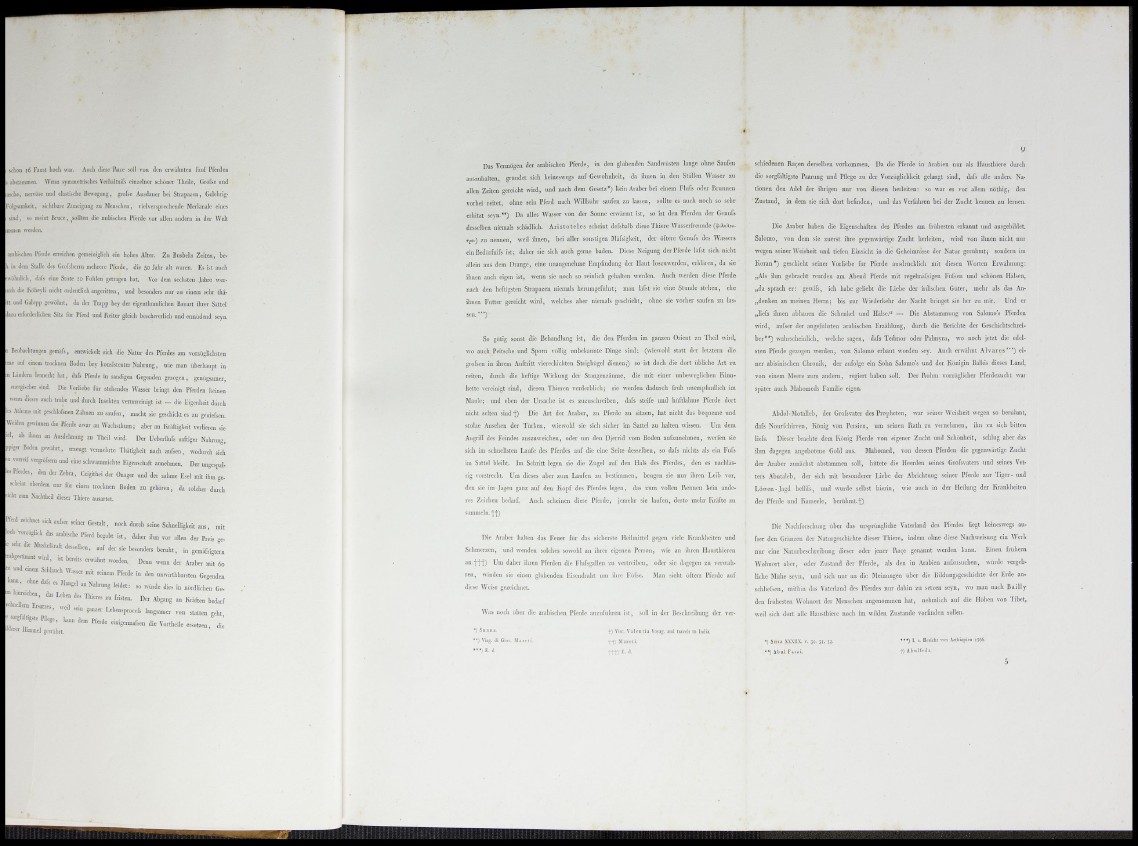
schon 16 Faust hoch war. Auch diese Race soll von den erwähnten fünf Pferden
> .iiistammen. Wenn symmetrisches Verliältnifs einzelner schöner Thcilc, Gröfse und
,1-i lie, ni'n.i-f und c L.i-li-i In- ilcncgiin» , gi,i|>e AiimI.uici bei Stiap.izen, Gelelui;;-
Folgsauikeit, sichtbare Zuneigung zu Menschen, vielversprechende Merkmale eines
sind, so meint Bruce, ^sollten die nukischen Pferde vor allen andern in der Well
iimnen werden.
arabischen Pferde erreichen gemeiniglich ein hohes Alter. Zu Busbeks Zeiten, bell
in dem Stalle des Grofshcrrn mehrere Pferde, die 50 Jahr alt waren. Es ist auch
ewöhnlich, dnfs eine Slute 20 Fohlen getragen hat. Vor dem sechsten Jahre wermch
die Köheyli nicht ordentlich angeritten, und besonders nur zu einem sehr thäitt
und Galopp gewöhnt, da der Trapp bey der eigenthümlichen Bauart ihrer Siiltcl
dazu erforderlichen Sitz für Pferd und Heiter gleich beschwerlich und ermüdend seyn
11 Beobachtungen gemäfs, entwickelt sich die Natur des Pferdes am vorzüglichsten
rme auf einem trocknen Boden bey konsistenter Nahrung, wie man überhaupt in
in Ländern bemerkt hat, dafs Pferde in sandigen Gegenden gezogen , genügsamer
energischer sind. Di.- Vorliebe für stehendes Wasser bringt den Pferden keinen
wenn dieses auch trübe und durch Insekten verunreinigt ist — die Eigenheit diirch
los Athcins mit geschlofsnen Zähnen zu saufen, macht sie geschickt es zu geniefsen.
Weiden gewinnen die Pferde zwar an Wachsthum; aber an Kräftigkeit verlieren sie
iel, als ihnen an Ausdehnung zu Theil wird. Der üeberüufs saftiger Nahrung,
ppiger Boden gewährt, erzeugt vermehrte Thätigkeit nach aufseu, wodurch sich
vorreif vergrößern und eine schwammichte Eigenschaft annehmen. Der ungespalles
Pferdes, den der Zebra, Czigithei der Onager und der zahme Esel mit ihm gescheint
überdem nur für eine» trocknen Boden zu gehören, da solcher durch
ciclit zum Nachtkcil dieser Tliiere ausartet.
Pfad « t b , , , « h aufser G„ „ | t i „o d , ^ ^ ^ „ „ ^ m _ ^
1.4 voraöglich da, „ b i A . Ifcd begabt ,s,. d.b.r ¡1» » „ ,H,„ fc, P r < ij
• Muskelkraft d„,e.b„, ,„f del- b« m d m b „ u , „ , ¡„ .m i r > i g l „ °„
«bsnbami , < W , ¡„ b ™ „ „ , v i t a t , „ r f m Dmn w m ^ ^ ^ ^ &
« »ad , , . m S l l , , j n d , , w mi( i Ä e m p f e J = m i ü i b m t e n G c E m dm
ta. .1». » „ Mangel . Nahrung leide.: „ d«, ¡„ „ M l k l x n Ge.
- h».«h„, da, Leben d„ T U « , „ D„ i l s m . „ K r ( r t m ^
schnellem Ersatzes, weil sein . , „ , „ i „1. r ,
, . e"' g a n z e r Lebcnsprocofs langsamer von statten geht,
sorgfältigste Pflege, kann dem Pfe.de einigenden die Vortheile ersetzen dil
er Himmel gewährt
Das Vermögen der arabischen Pferde, in den glühenden Sandwüsten lange ohne Saufen
auszuhaken, gründet sich keineswegs auf Gewohnheit, da ihnen in den Ställen Wasser zu
allen Zeiten gereicht wird, und nach dem Gesetz*) kein Araber bei einem Flufs oder Brunnen
vorbei reitet, ohne sein Pferd nach Willkühr saufen zu lassen, sollte es auch noch so sehr
erhitzt seyn.**) Da alles Wasser von der Sonne erwärmt ist, so ist den Pferden der Genufs
desselben niemals schädlich. Aristoteles scheint dcfshalb diese Thiere Wasscrfrcunde (<J>ao:*ou-
Tjjov) zu nennen, weil ihnen, bei aller sonstigen Mäfsiglseit, der öftere Genufs des Wassers
ein Bedürfnifs ist; daher sie sich auch gerne baden. Diese Neigung der Pferde läfst sich nicht
allein aus dem Drange, eine unangenehme Empfindung der Haut loszuwerden, erklären, da sie
ihnen auch eigen ist, wenn sie noch so reinlich gehalten werden. Auch werden diese Pferde
nach den heftigsten Strapazen niemals herumgeführt; man läfst sie eine Stunde stehen, che
ihnen Futter gereicht wird, welches aber niemals geschieht, ohne sie vorher saufen zu las-
So gütig sonst die Behandlung ist, die den Pferden im ganzen Orient zu Theil wird,
wo auch Peitsche und Sporn völlig unbekannte Dinge sind: (wiewohl statt der letztem die
grofsen in ihrem Auftritt viereckichten Steigbügel dienen;) so ist doch die dort übliche Art zu
reiten, durch die heftige Wirkung der Stangenzäume, die mit einer unbeweglichen Kinnkette
vereinigt sind, diesen Thieren verderblich; sie werden dadurch früh unempfindlich im
Maule; und eben der Ursache ist es zuzuschreiben, dafs steife und hüftlahme Pferde dort
nicht selten sind f ) Die Art der Araber, zu Pferde zu sitzen, hat nicht das bequeme und
stolze Ansehen der Türken, wiewohl sie sich sicher im Sattel zu halten wissen. Um dem
Angriff des Feindes auszuweichen, oder um den Djerrid vom Boden aufzunehmen, werfen sie
sich im schnellsten Laufe des Pferdes auf die eine Seite desselben, so dafs nichts als ein Fufs
im Sattel bleibt. Im Schritt legen sie die Zügel auf den Hals des Pferdes, den es nachlässig
vorstreckt. Um dieses aber zum Laufen zu bestimmen, beugen sie nur ihren Leib vor,
den sie im Jagen ganz auf den Kopf des Pferdes legen, das zum vollen Rennen kein anderes
Zeichen bedarf. Auch scheinen diese Pferde, jcmchr sie laufen, desto mehr Kräfte zu
sammeln. •(••}•)
Die Araber halten das Feuer für das sicherste Heilmittel gegen viele Krankheiten und
Schmerzen, und wenden solches sowohl an ihrer eigenen Person, wie an ihren Hausthiercn
a n t t t ) Um daher ihren Pferden die Flufsgallen zu vertreiben, oder sie dagegen zu verwahren,
winden sie einen glühenden Eisendraht um ihre Füfse. Man sieht öfters Pferde auf
diese Weise gezeichnet.
Was noch über die arabischen Pferde anzuführen i soll in der Beschreibung der i
schiedenen Ra<;en derselben vorkommen. Da die Pferde in Arabien nur als Ilausthicre durch
die sorgfältigste Paarung und Pflege zu der Vorzüglichkeit gelangt sind, dafs alle andere Nationen
den Adel der ihrigen nur von diesen herleiten: so war es vor allem nöthig, den
Zustand, in dem sie sich dort befinden, und das Verfahren bei der Zucht kennen zu lernen.
Die Araber haben die Eigenschaften des Pferdes am frühesten erkannt und ausgebildet.
Salomo, von dem sie zuerst ihre gegenwärtige Zucht herleiten, wird von ihnen nicht nur
wegen seiner Weisheit und tiefen Einsicht in die Geheimnisse der Natur gerühmt; sondern im
Koran*) geschieht seiner Vorliebe für Pferde ausdrücklich mit diesen Worten Erwähnung:
„Als ihm gebracht wurden am Abend Pferde mit regelmäßigen Füfsen und schönen Hälsen,
„da sprach er: gewifs, ich habe geliebt die Liebe der irdischen Güter, mehr als das Andenken
an meinen Herrn; bis zur Wiederkehr der Nacht bringet sie her zu mir. Und er
„liefs ihnen abhauen die Schenkel und Hälse." — Die Abstammung von Salomo's Pferden
wird, aufser der angeführten arabischen Erzählung, durch die Berichte der Geschichtschreiber**)
wahrscheinlich, welche sagen, dafs Tedmor oder Palmyra, wo noch jetzt die edelsten
Pfeide gezogen werden, von Salomo erbaut worden sey. Auch erwähnt A l v a r e s " " ) einer
abisinischen Chronik, der zufolge ein Sohn Salomo's und der Königin Balkis dieses Land,
von einem Meere zum andern, regiert haben soll. Der Ruhm vorzüglicher Pferdezucht war
später auch Mahomeds Familie eigen.
Abdol-Motalleb, der Grofsvater des Propheten, war seiner Weisheit wegen so berühmt,
dafs Nourfchirven, König von Pcrsien, um seinen Rath zu vernehmen, ihn zu sich bitten
liefs. Dieser brachte dem König Pferde von eigener Zucht und Schönheit, schlug aber das
ihm dagegen angebotene Gold aus. Mahomed, von dessen Pferden die gegenwärtige Zucht
der Araber zunächst abstammen soll, hütete die Hecrden seines Grofsvaters und seines Vetters
Abutaleb, der sich mit besonderer Liebe der Ablichtung seiner Pferde zur Tiger- und
Löwen-Jagd beflifs, und wurde selbst hierin, wie auch in der Heilung der Krankheiten
der Pferde und Kameele, berühmt, f )
Die Nachforschung über das ursprüngliche Vaterland des Pferdes liegt heil
fscr den Glänzen der Naturgeschichte dieser Thiere, indem ohne diese Nachweisung ein Werk
nur eine Naturbeschreibung dieser oder jener Rn^e genannt werden kann. Einen frühem
Wohnort aber, oder Zustand der Pferde, als den in Arabien aufzusuchen, würde vergebliche
Mühe seyn, und sich nur an die Meinungen über die Bildungsgcschichte der Erde anschlicfscn,
mithin das Vaterland des Pferdes nur dahin zu setzen seyn, wo man nach Bailly
den frühesten Wohnort der Menschen angenommen hat, nehmlich auf die Höhen von Tibet,
weil sich dort alle Hausthiere noch im wilden Zustande vorfinden sollen.
*) Sura XXXIIX. v. 30. 31. 32. •••) I. s. ßciicht von Aelhiopien 1566.
•«) Abul Faiai. t) Abulfeila.