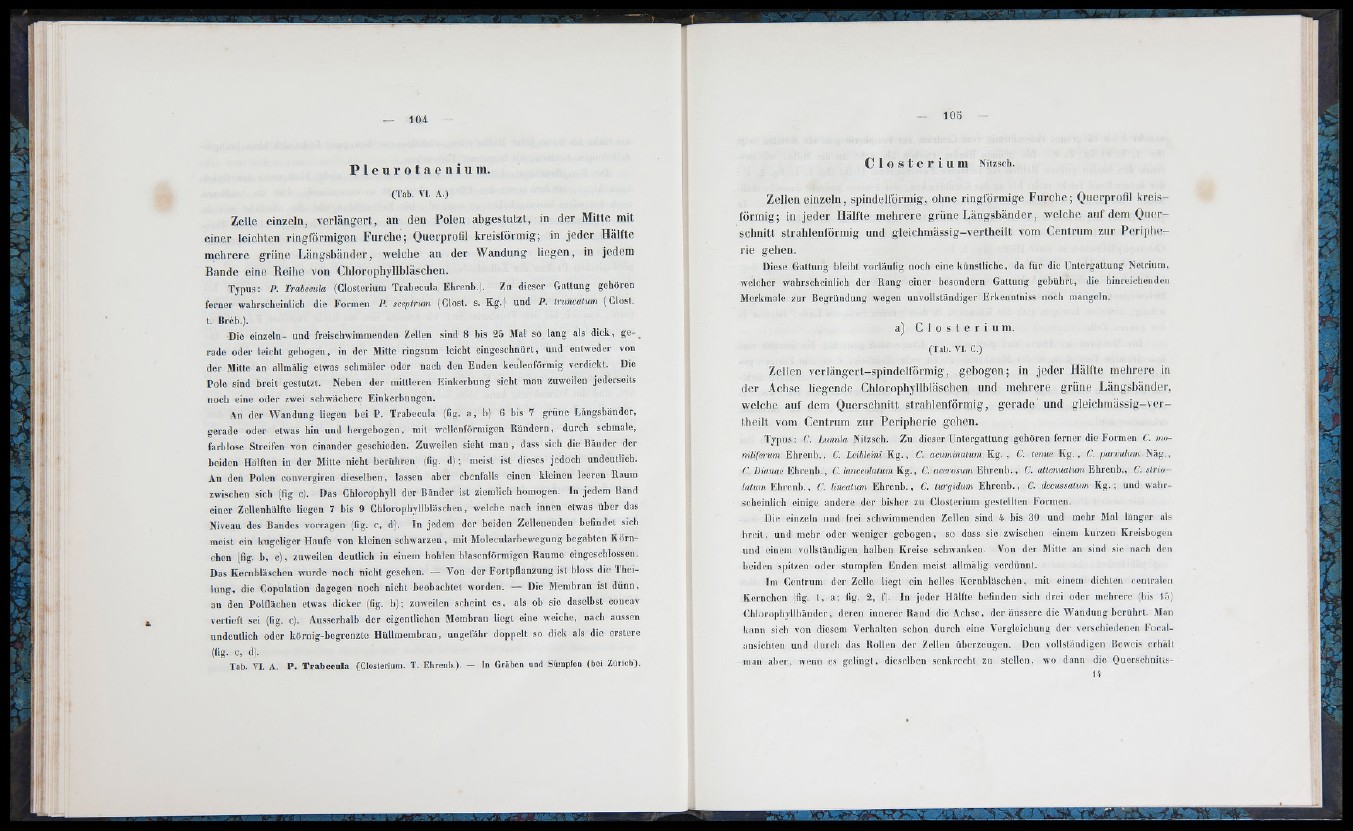
P l e u r o t a e n i u m .
(Tab. VI. .4 .)
Z e lle e in z e ln , v e r lä n g e r t, an d en P o len a b g e s tu tz t, in d er Mitte mit
e in e r le ich ten r in g fö rm ig en F u r c h e ; Querprofil k r e isfö rm ig ; in je d e r H ä lfte
m eh r e r e g rü n e L ä n g sb ä n d e r , w e lc h e an der Wan du n g li e g e n , in jed em
B an d e e in e R e ih e v o n Chlo rop hy llh lä sch en .
Typus: P. Trabecula (Closterium Trabecula Ehrenb.). Zu dieser Gattung gehören
ferner wahrscheinlich die Formen P. sceptrum (Clost. s. Kg.) und P. truncatum (Clost.
l. Breb.).
Die einzeln- und freischwimmenden Zellen sind 8 bis 25 Mal so lang als dick, ge-^
radc oder leicht gebogen, in der Mitte ringsum leicht eingeschnürt, und entweder von
der Mitte an allmälig etwas schmäler oder nach den Enden keulenförmig verdickt. Die
Pole sind breit gestutzt. Neben der mittleren Einkerbung sieht man zuweilen jederseits
noch eine oder zwei schwächere Einkerbungen.
An der Wandung liegen bei P. Trabecula (fig. a , b) 6 bis V grüne Längsbänder,
gerade oder etwas hin und hergebogen, mit wellenförmigen Rändern, durch schmale,
farblose Streifen von einander geschieden. Zuweilen sieht m a n , dass sich die Bänder der
beiden Hälften in der Mitte nicht berühren (flg. d ) ; meist ist dieses jedoch undeutlich.
An den Polen convergiren dieselben, lassen aber ebenfalis einen kleinen leeren Raum
zwischen sich (fig c). Das Chlorophyll der Bänder ist ziemlich homogen. In jedem Band
einer Zollenhälfte liegen 7 bis 9 Cblorophyllbläschen, welche nach innen etwas über das
Niveau des Bandes vorragen (fig. c, d). ln jedem der beiden Zelienenden befindet sich
meist ein kugeliger Haufe von kleinen schwarzen, mit Molecularhewcgung begabten Körnchen
(fig. b, c), zuweilen deutlich in einem hohlen blascnförmigcn Raume eingeschlossen.
Das Kernbläschen wurde noch nicht gesehen. — Von der Fortpflanzung ist bloss die Theilung,
die Copulation dagegen noch nicht beobachtet worden. — Die Membran ist dünn,
an den Polflächen etwas dicker (fig. b ) ; zuweilen scheint es, als ob sie daselbst concav
vertieft sei (lig. c). Ausserhalb der eigentlichen Membran liegt eine weiche, nach aussen
nndeutlich oder körnig-begrenzle Hüllmembran, ungefähr doppelt so dick als die erstere
(fig- c, d).
Tab. V I. A. P . T r a b e c u la (C lo s te r ium . T. E h r e n b .) . — In G r ä b e n und Sümpten ( b e i Zlirich).
C l o s t e r i u m Niizsch.
Z e llen e in z e ln , sp in d e lfö rm ig , oh ne ring fö rm ig e F u r c h e ; Querprofil kreisfö
rm ig ; in jed e r Hä lfte m eh r e r e g rü n e L ä n g sb ä n d e r , w e lc h e au f dem Q n e r -
s ch n itl slrah len fö rm ig und g le ic h n iä s s ig -v e r lh e ill vom Centrum zur P e r ip iie rie
g e llen .
Diese GaUung bleibt vorläufig noch eine künstliche, da für die Unlergattung Nclrium,
welcher wahrscheinlich der Rang einer besondern Gattung gebührt, die hinreichenden
Merkmale zur Begründung wegen unvollständiger Erkenntniss noch mangeln.
a) C l o s t e r i u m .
(T a b . V I. C .)
Ze ilen v e r lä n g e r t-sp in d e lfö rm ig , g e b o g e n ; in jed e r H ä lfte m eh r e r e in
d er A ch se lieg en d e Clilorophyllbläschen und m eh r e r e g rü n e Län g sb än d er,
w e lc h e au f dem Q u e r schn itt s tra h len fö rm ig , g e r a d e ' und g le ic h n iä s s ig - v e r -
Iheilt vom Centrum zur P e r ip iie r ie g e lien .
Ty p u s: C. Lunula Nilzscli. Zu dieser Untergaltung gehören ferner die Formen €. nm-
niliferum Eh rcn li., C. Lcibleini Kg ., C. acuminatum K g ., C. tenue K g ., C. parculum Näg.,
II. Dianae Ehrenb., C. lanceolatum Kg., C. acerosum E h re n b ., C. atlenuatum Ehrenb., C. striolalum
Elirenb., C. lincatum Eh ren b ., C. turrjidum E h re n b ., C. decussaltim Kg. ; und wahrscheinlich
einige andere der bisher zu Closterium gestolllon Formen.
Die einzeln und frei schwimmenden Zollen sind 4 bis 30 und mehr Mal länger als
b reit, und mehr oder weniger gebogen, so dass sie zwischen einem kurzen Kreisbogen
und einem vollständigen halben Kreise schwanken. Von der Mitte an sind sie nach den
beiden spitzen oder stumpfen Enden meist allmälig verdünnt.
Im Centrum der Zelle liegt ein helles Kernliläschen, mit einem dichten centralen
Kernchen (fig. 1, a; fig. 2, f). ln jeder Hälfte befinden sich drei oder mehrere bis 15)
Chloropliyllbänder, deren innerer Rand die Achse, der äussere die Wandung berührt. Man
kann sich von diesem Verhalten schon durch eine Vergleicliung der verschiedenen Focal-
ansiclUen und durch das Rollen der Zellen überzeugen. Den vollständigen Beweis erhält
man aher, wenn es gelingt, dicsellien senkrecht zu stellen, w-o dann die Quersclinilisl
i