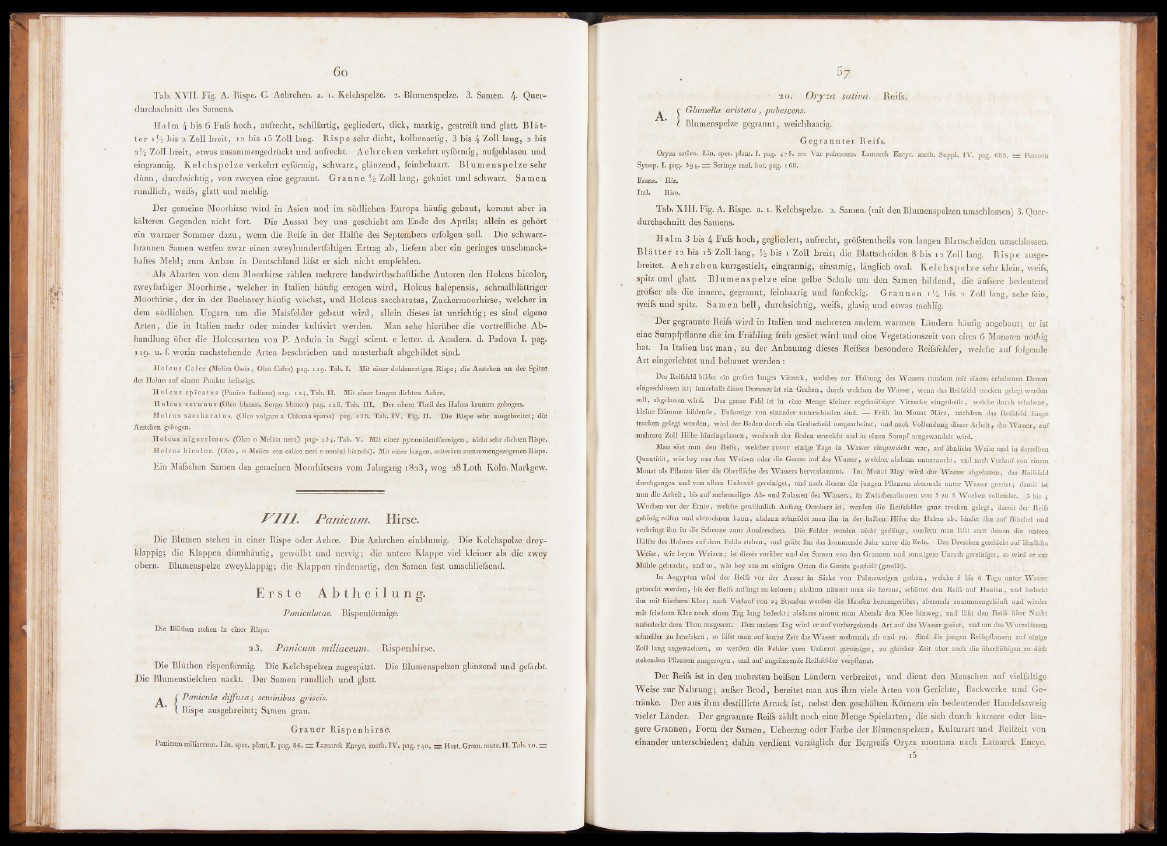
Halm 4 bis 6 Fufe hoch, aufrecht, schilfartig, gegliedert, dick, markig, gestreift und glatt. B lä tter
1V2 bis 2 Zoll breit, 12 bis i 5 Zoll lang. R isp e sehr dicht, kolbenartig, 3 bis 4 Zoll lang, 2 bis
2%. Zoll breit, etwas zusammengedrückt und aufrecht. A eh r ch en verkehrt eyförmig, aufgeblasen und
eingrannig. K e lc h s p e lz e verkehrt eyförmig, schwarz, glänzend, feinbehaart. B lum en sp e lz e sehr
dünn, durchsichtig, von zweyen eine gegrannt. G ran n e % Zoll lang, gekniet und schwarz. Samen
rundlich, weife, glatt und mehlig.
Der gemeine Moorhirse wird in Asien und im südlichen Europa häufig gebaut, kommt aber in
kälteren Gegenden nicht fort. Die Aussat bey uns geschieht am Ende des Aprils; allein es gehört
ein warmer Sommer dazu, wenn die Reife in der Hälfte des Septembers erfolgen soll. Die schwarz-
braunen Samen werfen zwar einen zweyhundertfältigen Ertrag ab, liefern aber ein geringes unschmack- ■
haftes Mehl; zum Anbau in Deutschland läfet er sich nicht empfehlen.
Als Abarten von dem Moorhirse zählen mehrere landwirtschaftliche Autoren den Holcus bicolor,
zweyfarbiger Moorhirse, welcher in Italien häufig erzögen wird, Holcus halepensis, schmalblättriger
Moorhirse, der in der Bucharey häufig wächst, und Holcus saccharatus, Zuckermoorhirse, welcher in
dem südlichen Ungarn um die Maisfelder gebaut wird, allein dieses ist unrichtig; es sind eigene
Arten, die in Italien mehr oder minder kultivirt werden. Man sehe hierüber die vortreffliche Abhandlung
über die Holcusarten von P. Arduin in Saggi scient. e letter. d. Academ. d. Padova I. pag.
119. u. f. worin nachstehende Arten beschrieben und musterhaft abgebildet sind.
H o l c u s C a fe r (Melica Ossia, Olco Cafra) pag. 1 19 . Tab. I . Mit einer doldenartigen Rispe; die Aestchen an der Spitze
des Halms auf einem Punkte befestigt.
H o l c u s s p i c a t u s (Panico Indiana) aag. 124. Tab. H. Mit einer langen dichten Aebre.
H o l c u s c e r n u u s (Olco blanco. Sorgo blanco) pag. 128. Tab. I I I . Der obere Theil des Halms krumm gebogen.
H o l c u s s a c c h a r a tu s . (Olco volgare a Chioma sparsa) pag. i 36. Tab. IV . Fig. I I. Die Rispe sehr' ausgebreitet; die
Aestchen gebogen.
H o l c u s n i g e r r im u s . (Olco o Melica nera) pag- 134. Tab. V . Mit einer pyramidenförmigen, nicht sehr dichten Rispe.
H o lc u s b i c o lo r . (Olco, o Melica con calice neri e semini bianchi). Mit einer langen, seitwärts zusammengezogenen Rispe.
Ein Maischen Samen des gemeinen Moovhirsens vom Jahrgang 1823, wog 28Loth Köln. Markgew.
P J I J . Panicum. Hirse.
Die Blumen stehen in einer Rispe oder Aehre. . Die Aehrchen einblumig. Die Kelchspelze drey-
klappig; die Klappen dünnhäutig, gewölbt und nervig; die untere Klappe viel kleiner als die zwey
obern. Blumenspelze zweyklappig; die Klappen rindenärtig, den Samen fest umschliefsend.
E r s t e A b t h e i l u n g .
Paniculatae. Rispenlörmige.
Die BlUthen stehen in einer Rispe.
23. Panicum miliaceum. Rispenhirse.
Die Blüthen rispenförmig. Die Kelchspelzen zugespitzt. Die Blumenspelzen glänzend und gefärbt.
Die Blumenstielchen nackt Der Samen rundlich und glatt.
f Pcmicula diffusa; seminibus griseis.
(Rispe ausgebreitet; Samen grau.
G ra u e r R isp en h irse .
Panicum miliaceum. Lin. spec. plant,I. pag. 86. = Lamarck Encyc. meth. IV . pag. 740. — Host. Gram. austr.II. Tab. 20. =
20. O ry za sativa. Reifs,
r Glumetta aristata y pubescens.
I Blumenspelze gegrannt, weichhaarig.
G e g ran n te r Reifs.
Oryza sativa. Lin. spec. plant. I. pag. 475. Var pubescens. Lamarck Encyc. meth. Suppl. IV . pag. 688. = Persoon
Synop. I. pag. 394. = : Seringe mel. bot. pag. 168.
F ran z .s Riz.
Ital. Riso.
Tab. XIII. Fig. A. Rispe, a. 1. Kelchspelze. 2. Samen, (mit den Blumenspelzen umschlossen) 3. Querdurchschnitt
des Samens.
Halm 3 bis 4 Fufe hoch, gegliedert, aufrecht, gröfetentheils von langen Blaltscheiden umschlossen.
B lä t te r 12 bis i 5 Zoll lang,- /^ bis 1 Zoll breit; die Blattscheiden 8 bis 12 Zoll lang. R isp e ausgebreitet.
. A eh r ch en kurzgestielt, eingrannig, einsamig, länglich oval. K e lch s p e lz e sehr klein, weife,
spitz und glatt. B lum en sp e lz e eine gelbe Schale um den Samen bildend, die äufeere bedeutend
gröfeer als die innere, gegrannt, feinhaarig und fünfeckig. Grannen 1% bis 2 Zolllang, sehr fein,
weife und spitz. Samen hell, durchsichtig, weife, glasig und etwas mehlig.
Der gegrannte Reife wird in Italien und mehreren andern warmen Ländern häufig angebaut; er ist
eine Sumpfpflanze die im Frühling früh gesäet wird und eine Vegetationszeit von circa 6 Monaten nöthig
hat. In Italien hat man, zu der Anbauung dieses Reifees besondere Reifefelder, welche auf folgende
Art eingerichtet und bebauet werden:
Das Reifsfeld bildet ein großes langes Viereck, welches zur Haltung des Wassers rundum mit einem erhabenen Damm
eingeschlossen ist; innerhalb dieses Dammes ist ein Graben, durch welchen das Wasser, wenn das Reißfeld trocken gelegt werdén
soll, abgelassen wird. Das ganze Feld ist in eine Menge kleiner regelmäßiger Vierecke eingetheilt, welche durch erhabene,
Meine Dämme bildende, Fußsteige von einander unterschieden sind. — Früh im Monat März, nachdem das Reißfeld längst
trocken gelegt worden, wird der Boden durch ein Grabscheid umgearbeitet, und nach Vollendung dieser A rbeit, das Wasser, auf
mehrere Zoll Höhe hineingelassen, wodurch der Boden erweicht und in einen Sumpf umgewandelt wird.
Man säet nun den R e iß , welcher zuvor einige Tage in Wasser eingeweicht wa r, auf ähnliche Weise und in derselben
Quantität, wie bey uns den Weizen oder die Gerste auf das Wasser, welcher alsdann untertaucht, und nach V erlauf von einem
Monat als Pflanze über die Oberfläche des Wassers hërvorkómmf. Im Monat M a y wird das ’Wasser abgelassen, das Reißfeld
durchgangen und von allem Unkraut gereiniget, und nach diesem die jungen Pflanzen abermals unter Wasser gesetzt; damit ist
nun die Arbeit, bis auf mehrmaliges Ab- und Zulassen des Wassers, iii Zwischenräumen von 5 zu 5 Wochen vollendet. 3 bis 4
Wochen vor der Ernte, welche gewöhnlich Anfang Octobers ist, werden die Reißfelder ganz trocken gelegt, damit der Reiß
gehörig reifen und abtrocknen kann, alsdann schneidet man ihn in der halben,Höhe des Halms ab, bindet ihn au f Büschel und
verbringt ihn in die Scheune zum Ausdreschen. Die Felder werden nicht gedüngt, sondern man läßt statt dessen die untere
Hälfte des Halmes auf dem Felde stehen, und gräbt ihn- das kommende Jahr unter die Erde. Das Dreschen geschieht auf ähnliche
W eise, wie beym W eizen; ist dieses vorüber und der Samen von den Grannen und sonstigem Unrath gereiniget, so wird er zur
Mühle gebracht, und so , wie bey uns an einigen Orten die Gerste geschält'(gerollt)..,
In Aegypten wird der Re iß vor der Aussat in Säcke von Palmzweigen gethan, welche 5 bis 6 Tage unter Wasser
getaucht werden, bis der Reiß anfängt zu keimen; alsdann nimmt man sie heraus, schüttet den Reiß au f Haufen, und bedeckt
ihn mit frischem Klee; nach Verlauf von 24 Stunden werden die Haufen herumgerübrt, abermaß zusammengehäuft und wieder
mit frischem Klee noch einen Tag lang bedeckt; alsdann nimmt man Abends den Klee hinweg, und läßt den Reiß über Nacht
unbedeckt dem Tbau ausgesezt. Den andern Tag wird er auf vorhergehende Art auf das W asser gesäet, und um das Wurzelfassen
schneller zu bewirken, so läßt man. au f kurze Zeit das Wasser mehrmals ab und zu. . Sind die jungen Reißpflanzen auf einige
Zoll lang angewachsen, so werden die Felder vom Unkraut gereiniget, zu gleicher Zeit aber auch die überflüßigen zu dick
stehenden Pflanzen ausgezogen, und auf angränzende Reifsfelder verpflanzt.
Der Reife ist in den mehrsten heifeen Ländern verbreitet, und dient den Menscben auf vielfältige
Weise zur Nahrung; aufeer Brod, bereitet man aus ihm viele Arten von Gerichte, Backwerke und Getränke.
Der aus ihm destillirte Arrack ist, nebst den geschälten Körnern ein bedeutender Handelszweig
vieler Länder. Der gegrannte Reife zählt noch eine Menge Spielarten, die sich durch kürzere oder längere
Grannen, Form der Samen, Ueberzug oder Farbe der Blumenspelzen, Kulturart und Reifzeit von
einander unterschieden; dahin verdient vorzüglich der Bergreife Oryza montana nach Lamarck Encyc.
i5