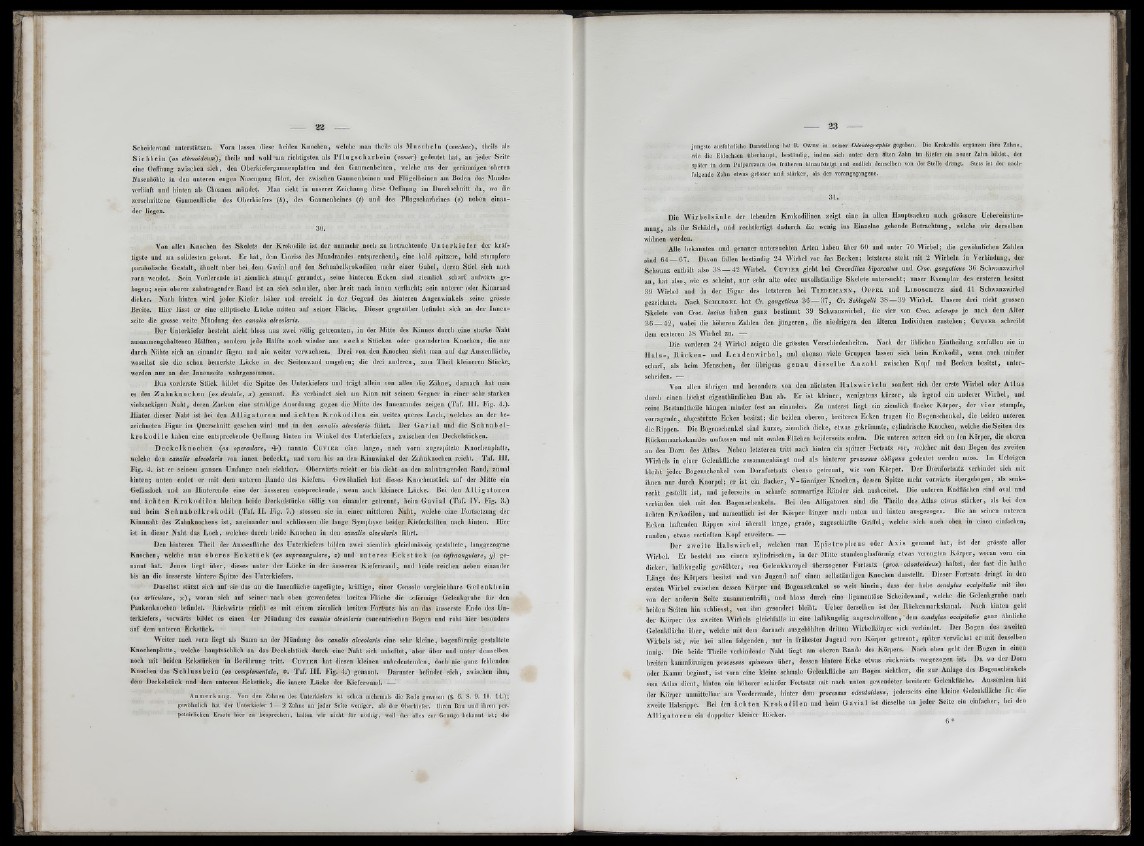
SHieiilcwanil nntcrsiiitzcn. Vorn lassen diese beiden Knoclicn, welelic man llicils als M i i s c l i c ln (conchac), tlieils als
S i c l i b e i i i (os eihmoideuni), tbcils und wolil am riclitigstcn als P f l i i g s c l i a r b e i n (no7«er) gedeutet lia t, an jede r Seite
eine OeiTiiung zwisdicn sicli, den Oberkicfcrgainnen|)latten nnd den Gainnciibcincii, welciie ans de r geräumigen oberen
Nascnliölile in den unteren engen Nasongang fiilirt, der zwischen Gaiiineiibcineii und Fliigelbeineii am Boden des Mundes
verläuft und liinten als Clioanen niiindct. Man siebt in iiiiscrcr Zcicliniiiig diese OcITiiung im Diirclisclniitt d a , wo die
zcrsclinittciic Gaiimcnfliiclie des Oberkiefers (5 ), des Ganmcnbeines (t) und des Pflugscliarbeincs (n) neben einande
r liegen.
30.
Von allen Knoclicn des Skelets der Krokodile ist der minmolir noch zu betrachtende U n t e r k i e f e r der k r ä l-
fifiste lind am solidesten gebaut. E r b a t , dem Umriss des Mundrandes entsprechend, eine bald spitzere, bald stumpfere
parabolische G e s ta lt, ähnelt abe r bei dem Gavial und den Schnaltelkrokodilen mclir einer Gabe l, deren S tie l sich nach
vom wendet. S e in Vorilerende ist ziemlicli stiiiiipf g e runde t, seine liintercn E ck en sind ziemlicli scharf aufwärts gebogen;
sein oberer zalintragender Rand ist an sich schmäler, aber breit nach innen verflucht; sein unterer oder Kiniirand
dicker. Nach hinten wird jede r K ie fe r höher nnd crreiclit in der Gegend des hinteren Augenwinkels seine grösste
Breite. Uic r lässt er eine elliptische Lücke mitten auf seiner Flüche. D ie s e r gegenüber befindet sich au der Innenseite
die grosse weite Mündung des canalis alveolaris.
D e r Unterkiefer besteht nicht bloss aus zwei völlig ge tren n ten , in der Mitte dos Kinne s durch eine starke Naht
ziisaimnengehaltencD H ä lften , sondern jede Hälfte noch wieder aus s e c h s Stücken oder gesonderten Knochen, die nur
durch Nähte sich an einander fügen und nie weiter verwachsen. D re i von den Knoclien sicht man auf de*- Aussenlläclic,
woselbst sie die schon bemerkte L ü ck e in der Seitcuwaiid umgeben; die drei and e ren , zum Theil kleineren Stücke,
werden nur an der Innenseite walirgenommcii.
Das vorderste Stü ck bildet die Spitz e des Unterkiefers und trä g t allein von allen die Z ä h n e , darnach ha t man
cs den Z a l i i i k n o c h c n (os dentale, x ) genannt. E s verbindet sich am Kinn mit seinem Gegner in einer sehr starken
viclzackigcu N a h t, deren Zacken eine stralilige Anordnung gegen die 3Iitte des Iniicnrandcs zeigen (T a f. I I I . F ig . 4 .).
H in te r dieser Naht ist bei deu A l l i g a t o r e n und ä c l i t e n K r o k o d i l e n ein weites ipieres L o c h , welches an der hczeicliiietcii
F ig u r im Querschnitt gesehen wird und iu den canalis alveolaris führt. D e r G a v i a l und die S c h i i a b c l -
k r o k o d i l c haben eine eutspreclicndc Oefi'miiig hinten im W in k e l des U n te rk ie fe rs, zwisclien den Dcckclstückeii.
D c c k e l k n o c h e n (os operculare, + ) nannte C ü t i e r eine lan g e , nach vorn ziigcspilztc Knoclienplafle,
welche den canalis alveolaris von innen b ede ckt, und vorn bis an den Kiimwiiikel der Zahnknoclicn reiclif. T a f. I l f .
F ig . 4 . is t e r seinem ganzen Umfange nach sichtbar. Ohcrwarts reicht e r bis dicht an den zahiifragenden Band, zumal
hinten; unten endet e r mit dem unteren Rande des Kiefers. Gewölinlich hat dieses Kuoclionstück auf der Mitte ein
Gefässlocli und am Hintcrcndo eine de r äusseren enlsprcclicnde, wenn auch kleinere L ü ck e . Bei den A l l i g a t o r e n
nnd ä c h t e n K r o k o d i l e n bleiben beide Deckelstiicke völlig vou einander g e trennt, beim G a v i a l (T a f . IV . F ig . 3.)
und beim S c l i u a b e l k r o k o d i l (T a f . I I . F ig . 7 .) stossen sie in einer mittleren Na Jit, welche eine F ortsetzung der
K innnaht des Zahnknochens i s t, aneinander und schlicssen die lange Symjihysc beider Kieferbälftcu nach liintcn. Uicr
is t in dieser Nalit das Lo c li, wclciics durch beide Knochen in den canalis alveolaris ntlirt.
Den liintercn Tlicil der Aussenfläche des Unterkiefers bilden zwei ziemlich gleichinässig ge sta lte te , laiiggezogcne
Knochen, welche man o b e r e s E c k s t ü c k (os snpraangtdare, z ) und u n t e r e s E c k s t i i c k (os infraangulare, y ) genannt
hat. Jen e s liegt ü b e r, dieses u nte r der L ü ck e in der änsscren Kie fe rwa iid, und beide reichen neben einander
his an die änsserste hintere Spitze des Unterkiefers.
Daselbst stützt sich auf sie das an die Innenfläche angclligte, krä ftig e , einer Console vergleichbare G c l c n k b e i n
(os articulare, x ) , woran sich anf seiner nach oben gewendeten breiten Flä che die oiföniiige Gclcnkgriibe liir den
Pankcnknochen befindet. Rückwärts re icht es mit einem ziemlich breiten Fortsa tz bis an das änsserste Ende des Unte
rk ie fe rs, vorwärts bildet cs einen der Mündung des canalis alveolaris conccntrisclien Bogen nnd rulit hier besondere
auf dem unteren Eckstück.
W e ite r nach vorn liegt als Sanm an der Mündung des canalis alveolaris eine selir k le in e , bogcnrörmig gestaltete
Knoclienplatte, welche lianptsäclilicli an das Deckelstück durch eine Nabt sich anhc ftc t, abe r über und unter demselben
noch mit beiden Eckstücken in Berülirung tr itt. C u v i e r h a t diesen kleinen uubcdciitcndcii, doch nie ganz felilcndea
Knoclien das S c h l u s s b e i n (oa complementóle, » . Taf. I I I . F ig . 4 .) genannt. Da runte r befindet sich , zwischen ihm,
dem Deckelstück und dem unterem Eck stü ck , die innere L ü ck e der Kicfeiwand. •—
A n m e r k u n g . Von den Zahnen des Unterkiefers is t seh en mehrmals die Rede gewesen (§. 6. S. 9. 10. 1 4 .);
gcwülinlich h a t der Unterkiefer 1 — 2 Zahne an je d e r Seite weniger, als d e r Oberkiefer. Ihren Bau luul ihren pcrpctuirlichen
Ersatz h ie r zu be sp re ch en , h alten wir nicht für n ü tliig , weil das alles zur Genüge bekaniU i s t; die
jüngste ausfaiirüclie Darstellung hat R. Owen in se in er Odontographie gegeben. Die Krokodile ergänzen ihre Zahne,
wie die Eidechsen ü b e rh a u p t, b e stän d ig , indem sich u n te r dem alten Zalin im Kiefer ein neu er Zahn b ild e t, der
später iu dem Pu lp arraum des früheren hinaufsLcigt und endlich denselben von d e r Stelle drangt. Stets ist d e r nachfolgende
Zahn etwas grüsser und s ta rk e r, als d e r vovangegangene.
D ie W i r b e l s ä u l e der lebenden Krokodilinen zeigt eine in allen Hauptsaclicn noch grössere Uehereiiistim-
iiiuiig, a ls ilir Sch äd e l, und rechtfertigt dadurch die wenig ins Einzelne gehende Bcti-aclituiig, welche wir derselben
widmen werden.
Alle bekannten und genauer nntcrsnchtcu Arten haben über 60 und unter 70 W irb e l; die gewöluilichcn Zahlen
sind 6 4 __ 6 7 . Davon fallen beständig 24 Wirbel vor das Becken; letzteres stcbt mit 2 W irbe ln in Verbindung, der
Scliwanz cntbält also 38 — 4 2 Wirbel. C u v i e r giebt bei Crocodilus biporcatus und Croc. gangeticus 36 Scliwanzwirbcl
a u , hat a lso , wie es scheint, nur sehr alte oder unvollständige S kc le te untcrsncht; unser Exemplar des e rsteren besitzt
39 W irbe l und iu der F ig n r des letzteren bei T i e d e m a n n , O p p e l und L ib o s c h it z sind 41 Scliwanzwirbcl
gezeichnet. Nach S c h l e o e l ha t Cr. gangeticus 36 — 3 7 , Cr. Schlegelii 38 — 39 W irbe l. Unsere drei nicht grossen
S kc le te vou Croc. lucius haben ganz bestimmt 39 Schwauzwirbcl, die vier von Croc. sclerops je nach dem Alte r
3 6 — 4 2 , wobei die höliercn Zahlen den jü n g e ren , die niedrigem den älteren Individuen zustehen; C u v i e r schreibt
dem ersteren 38 W irb e l zu. —
Die vorderen 2 4 W irb e l zeigen die grössten Vcrschicdenlieiten. Nach der üblichen Eintheilnng z erfallen sic in
H a l s - , R ü c k e n - und L e n d e n w i r b e l , und ebenso viele Gruppen lassen sich beim K ro k o d il, wenn auch minder
scharf, als beim Menschen, der übrigens g e n a u d i e s e l b e A n z a h l zwischen K opf nnd Becken b e s itz t, unterscheiden.
—
Von allen übrigen und besonders von den näclistcn H a l s w i r b e l n sondert sieb der erste W irbe l oder A t l a s
dnrcli einen liöcbst eigenÜiSmlicben Ban ab. E r ist kle in e r, wenigstens k ü rz e r, als irgend ein anderer W irb e l, und
seine Bcstandtheilc hängen minder fest an einander. Z n u n te rst liegt ein zicinlicb naelicr K ö riic r, der v i e r stiimprc,
verragcnde, abgestntzte Ecken besitzt; die beiden o be ren, breiteren Eekcn tragen die Begenscbcnkel, die beiden unteren
die I r i f l i e n . Die Bogenschcnkcl sind kurze, ziemlicli dicke, etwas gekrämintc, ejlindrisclie Kuocbcn, welebe die S e iten des
Rückcnmarkskaimlcs umfassen nud mit ovalen F läcbcn beiderseits enden. Die unteren setzen sieb an den Körper, die oberen
an den D o rn des Atlas. Neben letz te ren tr itt nacb bluten ein spitzer Fortsa tz vor, wclcbcr mit dem Bogen des zweiten
Wirb e ls iu einer GelenkDächc zasammenhängt nud als liintercr proccssas oiKjans gedeutet werden muss. Im Ucbidgcn
bleibt jed e r Begenscbcnkel vom Dornfortsalz ebenso ge tren n t, wie vom K ö rp e r. D e r Dornfortsatz verbindet sielt mit
ilmcn n u r dorcb K n o rp e l; e r is t ein fla che r, V -lö rm lg e r K n o ck en , dessen S p itz e nicbr vorwärts übcrgcbogcn, als scnk-
rcebt gestellt i s t, nnd jcdcrseits in scliarfc sanmartige R ände r sich ansbrcitct. D ie unteren Endiläcbcn sind oval nnd
verbinden sieb mit den Bogenscbeiikcln. Be i den Alligatoren sind die Tbcilo des A tlas etwas s tä rk e r , als bei den
ächten Krokodilen, nnd nnmcntlicb ist der K ö rp e r länger nach nnleii und liintcn aiisgczogen. Die an seinen nntcren
Ecken baftciidcn Rippen siud überall lan g e , g r a d e , zngcscbärfto G riü c l, welcbc sich nacb oben ln einen olnfaclicn,
ru n d en , etwas vertieften K opf erweitern. —
D e r z w e i t e H a l s w i r b e l , welchen man E p i s t r o p l i o n s oder A x i s genannt b a t, ist der grösste aller
Wirbe l. E r besteht aus einem z jllndrisc licn, in der Milte stiindenglnsförmig etwas verengten K ö rp e r, woran vorn ein
tliekcr, balbkngelig gewölbter, von Gelenkknorpei überzogener F o rtsa tz (proc. odontoidma) h a fte t, der fast die kalbe
L än g e des Körpers besitzt und von Jugend auf einen selbständigen Knecbcn darstellt. Die se r F ortsa tz dringt in den
e rsten W irb e l zwischen dessen Körpor und Bogcnscbeiikcl so weit h in e in , dass der hoho candylm o e d fita lü mit ihm
von de r anderen Seite zusammcntrilft, nnd bless dnteli eine liganientösc Scheidewand, welche die Gclenkgralie narb
lieldon Selten bin sclilicsst, von ihm gesondert bleibt. Uclicr derselben ist der Riickeniiiarkskanal. Nach hinten geht
der Körpe r des zweiten Wirb e ls gloichralls in eine lialbkngclig angcschwollcne, dem condylu, ocdfUaU, ganz ähiiliclie
Gclcnklläcbc ü b e r, welche mit dem darnach aiisgebölilten dritten Wlrbelkörper sich verbindet. D e r Bogen des zweiten
Wirbels i s t , wie bei allen folgenden, nur in frühester Jugend vom Körpe r ge tren n t, später verwächst er mit denselben
innig. Die beide Theile verbindcinle Nnbt Hegt am oberen Rande des Körpers. Nacb eben gebt de r Bogen in einen
breiten kammrönnigcn proccssns spraosao üb e r, dessen hintere E ck e etwas rückwärts vorgezogen ist. D a wo de r Dorn
oder Kamm beginnt, is t vorn eine kleine schmale Gclcnkiläcbo am Bogen s ich tb a r, die zur Anlage des Bogcnsclicnkels
vom Atlas d ient, liintcn ein liülicror scliictor F ortsa tz mit nach unten gewendeter breiterer Gelenklläclic. Ausserdciii bat
der Kö rp e r unmittelbar am Vordorramic, binter dem processns o d m io id m , jedcrscils eine kleine GclcnkOncbc fiir die
zweite Halsripiic. Bei den ä c h t e n K r o k o d i l e n nnd beim G a v i a l ist dieselbe an jed e r S e ite ein einfacher, bei den
A l l i g a t o r e n ein doppelter kleiner Höcker. ^