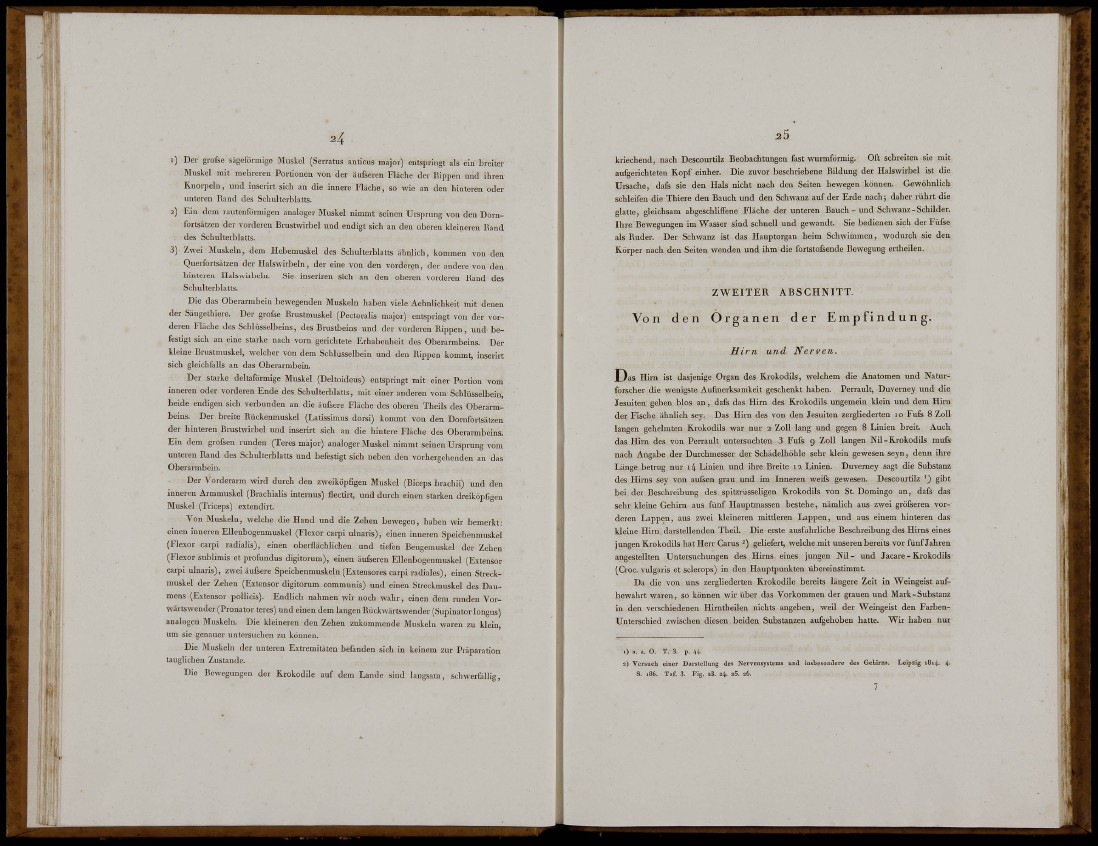
I^i l
i i i
É
iüliií
; j ; K
1) Der grofse sägelormige Muskel (Sen-atus anticus major) entspringt als ein breiter
Muskel mit mehreren Portionen yon der äufeeren Fläche der Hippen und ihren
Knorpeln, und inserirt sich an die innere Fläche, so wie an den hinteren oder
unteren Hand des Schulterblatts.
2) Ein dem rantenlormigen analoger Mnskel nimmt seinen Ursprung von den Dorn-
Ibrlsätzen der vorderen Brustwirbel und endigt sich an den obei en kleineren Rand
des Schulterblatts.
3) Zwei Muskeln, dem Hebemnskel des Schulterblatts ähnlich, kommen von den
Querfortsätzen der Halswirbeln, der eine von den vorderen, der andere von den
hinteren Halswirbeln. Sie inseriren sich an den oberen vorderen Kand des
Schulterblatts.
Die das Oberarmbein bewegenden Muskeln haben viele Aehnlichkeit mit denen
der Sängethiere. Der grofee Brustmuskel (Pectoralis major) entspringt von der vorderen
Flüche des Schlüsselbeins, des Brustbeins und der vorderen Rippen, und befestigt
sich an eine starke nach vorn gerichtete Erbabeuheit des Oberai-mbeins. Deikleine
Bruslmuskel, welcher von dem Schlüsselbein und den Rippen kommt, inserirt
sich gleichfalls an das Oberarmbein.
Der starke deltaförmige Muskel (Deltoideus) eutspringt mit einer Portion vom
inneren oder vorderen Ende des Schulterblatts, mit einer anderen vom Schlüsselbein,
beide endigen sich verbunden an die äufsere Fläche des oberen Theils des Oberarmbeins.
Der breite Rückenmuskel (Latissimus dorsi) kommt von den Dorufortsätzen
der hinteren Brustwirbel und inserirt sich an die hintere Fläche des Oberarmbeins.
Ein dem groisen runden (Teres major) analoger Muskel nimmt seinen Ursprung vom
unteren Rand des Schulterblatts und befestigt sich neben den vorhergehenden an das
Oberarmbein.
Der Vorderarm wird durch den zweiköpfigen Muskel (Biceps brachii) und den
inneren Armmuskel (Brachialis internus) flectirt, und durch einen starken dreiköpfigen
Muskel (Triceps) extendirt.
Von Muskeln, welche die Hand und die Zehen bewegen, haben wir bemerkt:
einen inneren Ellenbogenmuskel (Flexor carpi ulnaris), einen inneren Speichenmuskel
(Flexor carpi radialis), einen oberflächlichen und tiefen Beugemuskel der Zehen
(Flexor sublimis et profundus digitorum), emen äuiseren Ellenbogemnuskel (Extensor
carpi ulnaris), zwei äulsere Speichenmuskeln (Extensores carpi radiales), einen Streckmuskel
der Zehen (Extensor digitorum communis) und einen Streckmuskel des Daumens
(Extensor pollicis). Endlich nahmen wir noch wahr, einen dem runden Vorwärtswender
(Pronator teres) und einen dem langen Rückwärtswender (Supinator longus)
analogen Bluskeln. Die kleineren den Zehen zukommende Muskeln waren zu klein,
um sie genauer untersuchen zu können.
Die Muskeln der unteren Extremitäten befanden sich in keinem zur Präparation
tauglichen Zustande.
Die Bewegungen der Krokodile auf dem Lande sind langsam, schwerfällig,
kriechend, nach Descourtilz Beobachtungen fast wurmförmig. Oft schreiten sie mit
aufgerichteten Kopf einher. Die zuvor beschriebene Bildung der Halswirbel ist die
Ursache, dals sie den Hals nicht nach den Seiten bewegen können. Gewöhnlich
schleifen die Thiere den Bauch und den Schwanz auf der Erde nach; daher rührt die
glatte, gleichsam abgeschliffene Fläche der unteren Bauch - und Schwanz-Schilder.
Ihre Bewegungen im Wasser sind schnell und gewandt. Sie bedienen sich der Füise
als Ruder. Der Schwanz ist das Hauptorgan beim Schwimmen, wodurch sie den
Körper nach den Seiten wenden und ihm die fortstoßende Bewegung ertheilen.
Z W E I T E R A B S C H N I T T .
Von d e n O r g a n e n d e r E m p f i n d u n g .
Hirn und Nerven.
D a s Hirn ist dasjenige Organ des Krokodils, welchem die Anatomen und Naturforscher
die wenigste Aufmerksamkeit geschenkt haben. Perrault, Duverney und die
Jesuiten geben blos an, dais das Hirn des Krokodils ungemein klein und dem Hirn
der Fische ähnlich sey. Das Hirn des von den Jesuiten zergliederten 1 o Fufe 8 Zoll
langen gehelmten Krokodils war nur 2 Zoll lang und gegen 8 Linien breit. Auch
das Hirn des von Perrault untersuchten 3 Fufe 9 Zoll langen Nil-Krokodils mufs
nach Angabe der Durchmesser der Schädelhöhle sehr klein gewesen seyn, denn ihre
Länge betrug nur i 4 Linien und ihre Breite 12 Linien. Duverney sagt die Substanz
des Hirns sey von aufeen grau und im Inneren weife gewesen. Descourtilz gibt
bei der Beschreibung des spitzrusseligen Krokodils von S t Dommgo an, dais das
sehr kleine Gehirn aus fünf Hauptmassen bestehe, nämlich aus zwei gröfeeren vorderen
Lappen, aus zwei kleineren mittleren Lappen, und aus einem hinteren das
kleine Hirn, darstellenden Theil. Die erste ausfuhrliche Beschreibung des Hirns eines
jungen Krokodils hat Herr Carus 2) geliefert, welche mit unseren bereits vor fünf Jahren
angestellten Untersuchungen des Hirns eines jungen Ni l - und Jacaré - Krokodils
(Croc. vulgaris et sclerops) in den Hauptpunkten übereinstimmt
Da die von uns zergliederten Krokodile bereits längere Zeit in Weingeist aufbewahrt
waren, so können wir über das Vorkommen der grauen und Mark-Substanz
in den verschiedenen Hirntheilen nichts angeben, weil der Weingeist den Farben-
Unterschied zwischen diesen beiden Substanzen aufgehoben hatte. Wi r haben nur
« ) a. a. O. T. 3. p. 44-
3) Ve r such einer Dar s tel lung des Nervensystems und
S. 186. Ta f . 3. Fig, 93. 24. 25. 26.
! des Gehi rns . Le ipz ig 1814. 4.