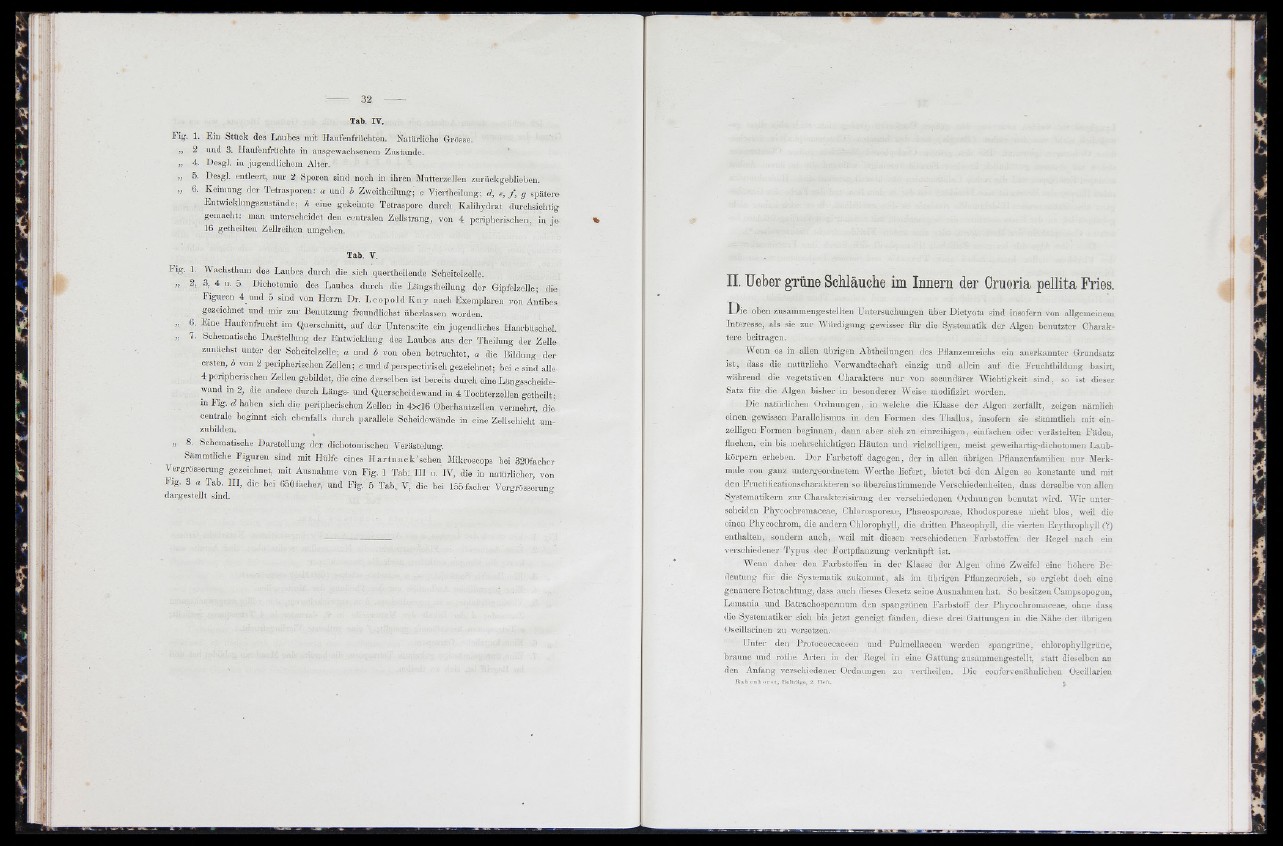
Tab. IV.
Fig, 1. Ein Stück des Laubes mit Haufenfrüchten. Natürliche Grösse.
„ 2 und 3. Haufenfrüclite in ausgewachsenem Zustande.
„ 4, Desgl. in jugendlichem Alter.
5. Desgl. entleert, n ur 2 Sporen sind noch in ihren Mutterzcllon zurückgeblieben.
„ 6. Keimung rter Tetrasporen: a und i Ziveitlioiluiig; o Vierthcikmg; d, e, f , g spätere
Kntwicklungszustäude; I eine gekeimte Tetraspore durch Kaliliydrat durchsichtig
gemilcht: man iinterselieidet deu centralen Zellstrang, von 4 peripherischen, in j e
16 getheilten Zellreihen umgeben.
Tab. V.
big. 1. dbaohstimm des Laubes durch die .sieh qiiertlieilende Scheitelzellc.
„ 2, 3, 4 n. 5. Dichotomie des Laubes durch die Längstheilung der Gipfelzelle; die
hignron 4 und 5 sind von Herrn Dr. L e o p o ld K n y nach Exemplaren von Antibes.
gezeichnet und mir zur Benutzung freimdlielist überlassen worden.
„ 6. Eine Hnufeiifruobt im Querschnitt, auf der Diitenseite ein jugendliches Haarbüschel.
„ 7. Schem.atische Darstellung der Entwicklung des Lanbes aus der Theilung der Zelle
zunächst unter der Scheitelzelle; a und b von oben betrachtet, a die Bildung der
ersten, b von 2 peripherischen Zellen; c und ¡7perspectiviscli gezeichnet; bei e sind alle
4 peripherischen Zellen gebildet, die eine derselben ist bereits durch eine Längsscheidewand
in 2, die andere durch Längs- und Qiterscheidewaud in 4 Tochterzellen getheilt;
m Flg. d haben sich die peripherischen Zellen in 4 x 1 6 Oberliautzellen vermehrt, die
oenti-ale beginnt sich ehenfalls durch parallele Soheidcwände in eine Zellscliieht’ um-
ziibilden.
„ 8. Schematische Darstelhmg der dichotomischen Verästelung.
Sämmtliehe F ig u ren sind mit Hülfe eines H a r t n a c k ’sohen Mikroscops bei 320fachcr
Vergrösserung gezeiclmet, mit Ausnahme von Fig. 1 Tab. I I I u. IV, die in natürlicher, von
I ig . 3 a Tab. I II , die bei 650facher, und Fig. 6 Tab. V, die bei l.o5facher Vergrösserung
dargestellt sind.
n. Ueber grüne Schläuche im Innern der Oruoria pellita Fries.
D i e oben znsammengestellteu Untersucbmigen über Dictyota sind insofern von allgemeinem
Interesse, als sie zur Würdigung gewisser für die Systematik der Algen benutzter Charaktere
beitragen.
Wenn es in allen übrigen Abtheilungen des Ftianzenreich.s ein anerkannter Grundsatz
ist, dass die natürliche Verwandtschaft einzig und allein axtf die Ernchtbildung basiit,
während die vegetativen Charaktere n ur von secundärer Wichtigkeit sind, so ist dieser
Satz für die Algen bisher in besonderer Weise modifizii-t worden.
Die natui'lichen Ordnungen, in Avelche die Klasse der Algen zerfällt, zeigen nämlich
einen gexvissen Parallelismus in den Formen des Thallus, insofern sie sämmtlicli mit einzelligen
Formen hegiimen, dann aber sich zu einreihigen, einfachen oder verästelten Fäden,
flachen, ein bis mehrschichtigen Häuten und vielzelligen, meist geAveihai-tig-dichotomen Laubkörpern
erheben. Der Farbstoff dagegen, der in allen übrigen Pflauzenfamilieu nur Merkmale
von ganz untergeordnetem Werthe liefert, bietet bei den Algen so konstante und mit
den Fructifieationscharakteren .so übereinstimmende Verschiedenheiten, dass derselbe von allen
iSystematikeru zur Charakterisirung der verschiedenen Ordnungen benutzt Avird. W ir imter-
scheiden Phycochromaceae, Chlorosporeae, Phaeosporeae, Rbodosporeae nicht blos, weil die
einen Phycocbi-om, die ändern Chlorophyll, die dritten Phaeophyll, die -vierten Erythrophyll (?)
enthalten, sondern auch, Aveil mit diesen verschiedenen Farbstoffen der Regel nach ein
A-erschiedener Typus der Fortpflanzung verknüpft ist.
W'enn daher den Farbstoffen in d e r Klasse der Algen ohne Zweifel eine höhere Bedeutung
für die Systematik zukommt, als im übrigen Pflanzenreich, so ergieht doch eine
genauere B etrachtung, dass auch dieses Gesetz seine A usnahmen hat. So besitzen Campsopogon,
Lemania. und Batrachospernmm den spangrünen Farbstoff der Phycochromaceae, ohne dass
die Systematiker sich bis je tz t geneigt fänden, diese drei Gattungen in die Nähe der übrigen
( )scillarmen zu versetzen.
Unter den Protocoecaceeu uud Palmellaceeu Averden spangrüne, chlorophyllgrüne,
braune und rothe Arten in der Regel in eine Gattung zusammengestellt, sütit dieselben au
den xA.nfang A-erschiedener Ordnungen zu vertheilen. Die confervenähnlichen Oscillarien
H.ibcnlK.rqt, Hoitrilfrc, 2. Ilofi. 5