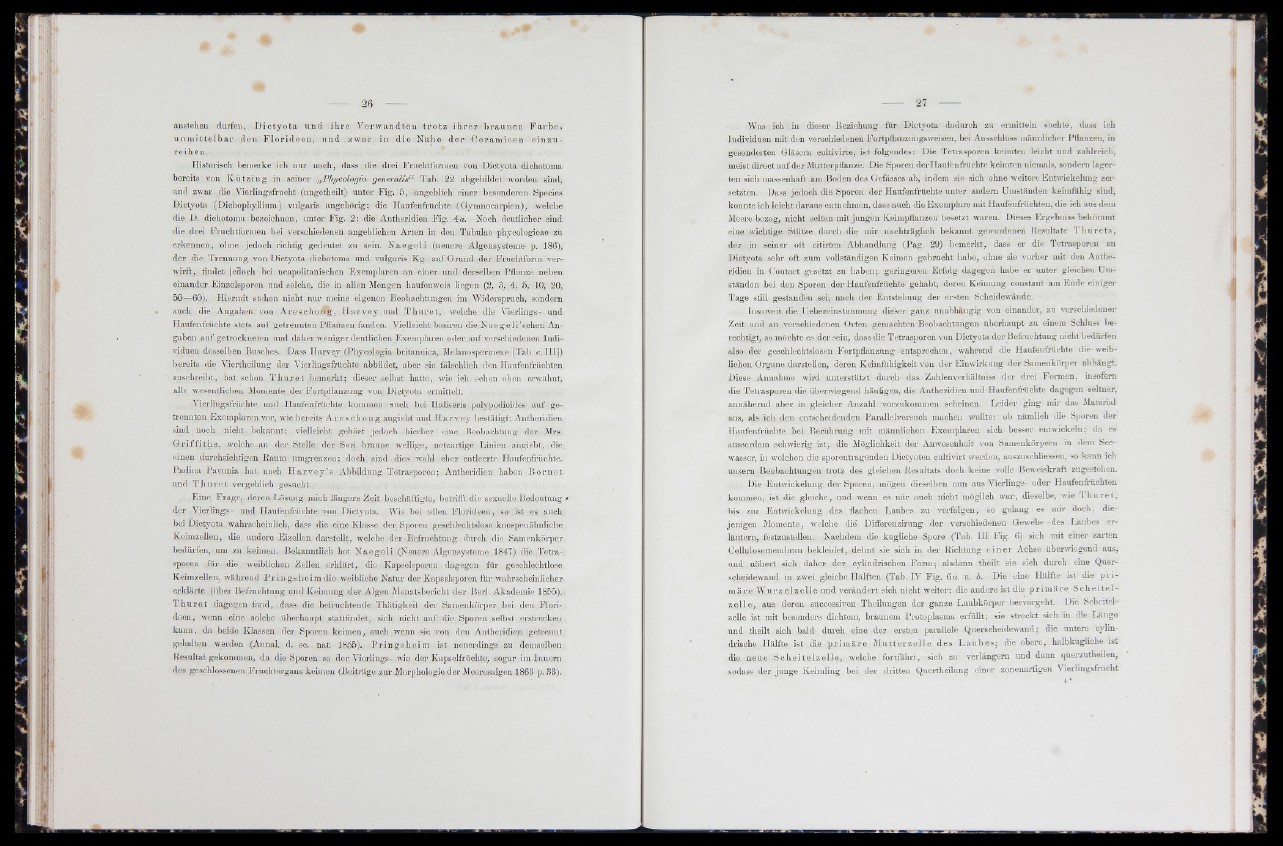
l! Ä
' r
■ f
• (
I
fl*
II
2 6
D i c ty o t a u n d i h r e V e rw a n d t e n t r o t z i h r e r b r a u n e n F a r b e ,
1 F l o r i d e e n , u n d z w a r in d i e N ä h e d e r C e r am i c e n e in z u -
anstehen dürfen,
u n m i t t e l b a r d
r e ih e n .
Historisch liemerke ich nur noch, dass die drei Fruchtformen von Dictyota dichotoma
bereits vun K ü t z in g in seiner „Phycologia gefieraUs“ Tab. 22 abgebildct worden sind,
und zwar die Vierliugsfrucht (uiigetheilt) unter Fig. 5 , angeblich einer besonderen Species
Dictyota (Dichophyllium) vulgaris angehörig: die Ilaufenfrüehte (Cymnocarpion), welche
die 1). dichotoma bezeichnen, unter Fig. 2: die Antheridien Fig. 4a . Noch deutlicher sind
die drei Fruchtformen bei verschiedenen angeblichen Arten in den Tabulac phvcologicae zu
e rkennen, olme jedoch richtig gedeutet zu sein. N a e g e l i (neuere Algensysteme p. 186),
d e r die Trennung von Dictyota dichotoma und vulgmäs Kg, auf Grund der Fruclitform v e rwirft,
findet jedoch bei neapolitanischen Exemplaren an einer und derselben Pflanze neben
einander Einzelsporen und solche, die iu allen Mengen haufenweis liegen (2, 3, 4, 5, 10, 20.
50—60). Hiermit stehen nicht nur meine eigenen Beobachtungen im Widerspruch, sondern
auch die Angaben von A r e s c h o n g , H a r v e y und T h u r e t , welche die Vierling.s- und
Haufenfrüchte stets anf getrennten Pflanzen fanden. Vielleicht basiren die N a e g e l i ’schen Angaben
auf geti-ücknetoii uud daher w eniger deutlichen Exemplaren oder auf verschiedenen Individuen
desselben Busches. Dass Ila rv ey (Phycologia britannica, Melanospermeae [Tab. c. III])
bereits die Viertheilung der Vierlingsfrüchte abbiidet, aber sie fälschlich den ITaufenfriichten
zuschreibt, hat schon T h u r e t bemerkt; dieser selbst h atte, wie ich schon oben erwähnt,
alle we.sentlichen, Momente der Fortpflanzung von Dictyota ermittelt.
Ä ierlingsfrüchte und Haufenfrüchte kommen auch bei Haliseris polvpodioides auf getrennten
Exemplaren vor, wie bereits A r e s c h o n g angiobt und H a r v e y bestätigf: Antheridien
sind noch nicht bekannt: vielleicht gehört jedoch hierher eine Beobachtung der Mrs.
G r i f f i t h s , welche an der Stelle der Sori braune wellige, netzartige Linien angicbt, die
einen dm-chsichtigen Baum umgrenzen; doch sind dies wohl eher entleerte Haufenfrüchtc.
Pad in a Pavonia hat nach J l a r v e y ’.s Abbildung Tetrasporen; Antheridien Iiabcn B o r n e t
und T h u r e t vergeblich gesucht.
Eine F rag e, deren Lösung mich längere Zeit beschäftigte, betrifft die sexuclk! Bedeutung
der Vierlings- imd Ilaufenfrüehte von Dictyota. Wie bei allen I lo rid e e n , so ist es auch
bei Dictyota wahrscheinlich, dass die eine Klasse der Sporen geschlechtslose knospcnähnliehe
Keimzellen, die andere Eizellen darstellt, welche der Befruchtung durch die Samenkörper
bedürfen, um zu keimen. Bekanntlich hat N a e g e l i (Neuere Algensysteme 1847) die Totrasporen
für die weiblichen Zellen e rk lä rt, die Kapselsporen dagegen für geschlechtlose
Keimzellen, wähi*end P r in - g s h e im die weibliche Natur der Kapselsporon für wahrscheinlicher
erklärte (über Befruchtung und Keimung der Algen IMonatshericht der Berl. Akademie 1855).
T h u r e t dagegen fand, dass die befruchtende Thätigkeit der Samenkörper bei den Florideen,
wenn eine solche übei-haupt stattflndet, sich nicht au f die Sporen selbst (u-strecken
k a n n , da beide Klassen der Sporen keimen, auch wenn sie von den Anthexddien getrennt
gehalten werden (Annal. d. sc. nar. 1855). P r in g s l i e im ist neuerdings zu demselben
Resultat gekom men, da die Sporen so der Vierlings- wie der Kapsolfrüchte, sogar im Innern
des geschlossenen Fruchtorgans keimen {Beiträge zur Morphologie der Mccresalgcn 1863 }>. 33).
2 7 --------
Was icii ¡11 dieser Beziehung für Dictyota dadurch zu ermitteln suchte, dass ich
Individuen mit den verschiedenen Fortpflanzungsweisen, bei Ausschluss männlicher Pflanzen, in
gesonderten Gläsern cultivirte, ist folgendes: Die Tetrasporen keimten leicht und zahlreich,
meist d irect auf der M utterpflanze. Die Sporen der Ilaufenfrüehte keimten niemals, sondern lagerten
sich massenhaft am Boden de.s Gefässes ab, indem sie sich ohne weitere Entwickelung zersetzten.
Dass jedoch die Sporen der Haufenfrüchte unter ändern Umständen keimfähig sind,
konnte ich leicht d araus entnehmen, dass auch die E xemplare mit H aufeiifrüchten, die ich aus dem
Meere bezog, nicht selten mit jungen Keimpflanzen besetzt waren. Dieses Ergebiiiss bekömmt
eine wichtige Stütze dureli die mir nacbträglicli bekannt gewordenen Resultate T h u r e t s ,
der in seiner oft citirten Abhandlimg (Pag. 29) bemerkt, dass er die Tetrasporen an
Dictyota sehr oft zum vollständigen Keimen gebracht habe, ohne sie vorher mit den Antheridien
in Contact gesetzt zu haben; geringeren Erfolg dagegen liabe er unter gleichen Umständen
bei den Sporen der Haufeiifnichte gehabt, dex'en Keimung constant am Ende einiger
Tage still gestanden sei, nach der Entstehung der ei-sten Scheidewände.
Insoweit die Uebercinstimmung dieser ganz unabhängig von einander, zu verschiedener
Zeit und an vei*schiedenen Orten gemachten Bcoliuchtungen überhaupt zu einem Schluss b erechtigt,
so möchte es der sein, dass tlie Tetrasporen von Dictyota der B efruchtung nicht bedürfen
also der geschlechtslosen Fortpflanzung entsprechen, während die Haufenfrüchte die weib-
licheix Organe darstelien, deren Keimfähigkeit von der Einivirkung der Saiiienkörper abliängt.
Diese Annahme wix*d unterstützt dui*cli das Zahlenvei-hältniss der di*ei Formen, bisofern
die Tetraspuren die ülxcrwiegend häufigen, die Antheridien und Haufenfrüclite dagegen seltner,
annähernd aber in gleicher Anzahl vox'zukommen scheinen. Leider ging mir das Material
aus, als ich den entscheidenden Parallelversuch machen wollte: ub nämlich die Sporen der
Haufenfrüclite bei Berühi-ung mit männlichen Exemplaren sich besser entwickeln; da es
ausserdem schwiei’ig ist, die Möglichkeit der Anwesenheit von Samenköx-pern in dem Seewasser,
in welchen die spürentragenden Dictyoten cultivirt wei-deii, auszuschliessen, so kann ich
uusern Beobachtungen trotz des gleichen Resultats doch keine volle Beweiskraft zugestehen.
Die Entwickelung der Sporen, mögen dieselben nun aus Vierlings- oder Haufenfrüchten
kommen, ist die gleiche, und wenn es mir auch nicht möglich war, dieselbe, wie T h u r e t ,
bis zur Entwickelung des flachen Laubes zu vex’folgen, so gelang es mir doch, diejenigen
Momente, welche die' Diffex-enzirimg der vei-schiedcneu Gew ebe-des Laubes ei*-
läuteru, festzustellon. Nachdem die kugliche Spore (Tab. 111 Fig. 6) sich mit einer zarten
Cellulosemenibran bekleidet, dehnt sie sich in der Richtung e i n e r Achse übexuviegend aus,
uud nähert sich daher der cylindrischen F o n n ; alsdann theilt sie sich durch eine Querscheidewand
in zwei gleiche Hälften (Tab. U ' Fig. 6a. u. b. Die eine Hälfte ist die p r i m
ä r e W u v z e l z e l l e und verändert sich nicht weiter; die andere ist die p r im ä r e S c h e i t e l -
z e l l o , aus deren successiven Theilungen der ganze Laubköx’per hervox-geht Die Scheitelzelle
ist mit besonders dichtem, braunem Protoplasma erfüllt; sie sti-eckt sich in die Länge
und theilt sich bald durch eine der ersten parallele Querscheidewand; die untere cylin-
dx'ische Hälfte ist die p r im ä r e M u t t e r z e l l e d e s L a u b e s ; die obere, halbkiigliche ist
die n e u e S c h e i t e l z e l l e , welche fortiahrt, sich zu verlängern und dann querzutlieilen,
sodass der ju n g e Keimling bei der dritten Quertheilung einer zonenartigen \ lerlingsfrucht