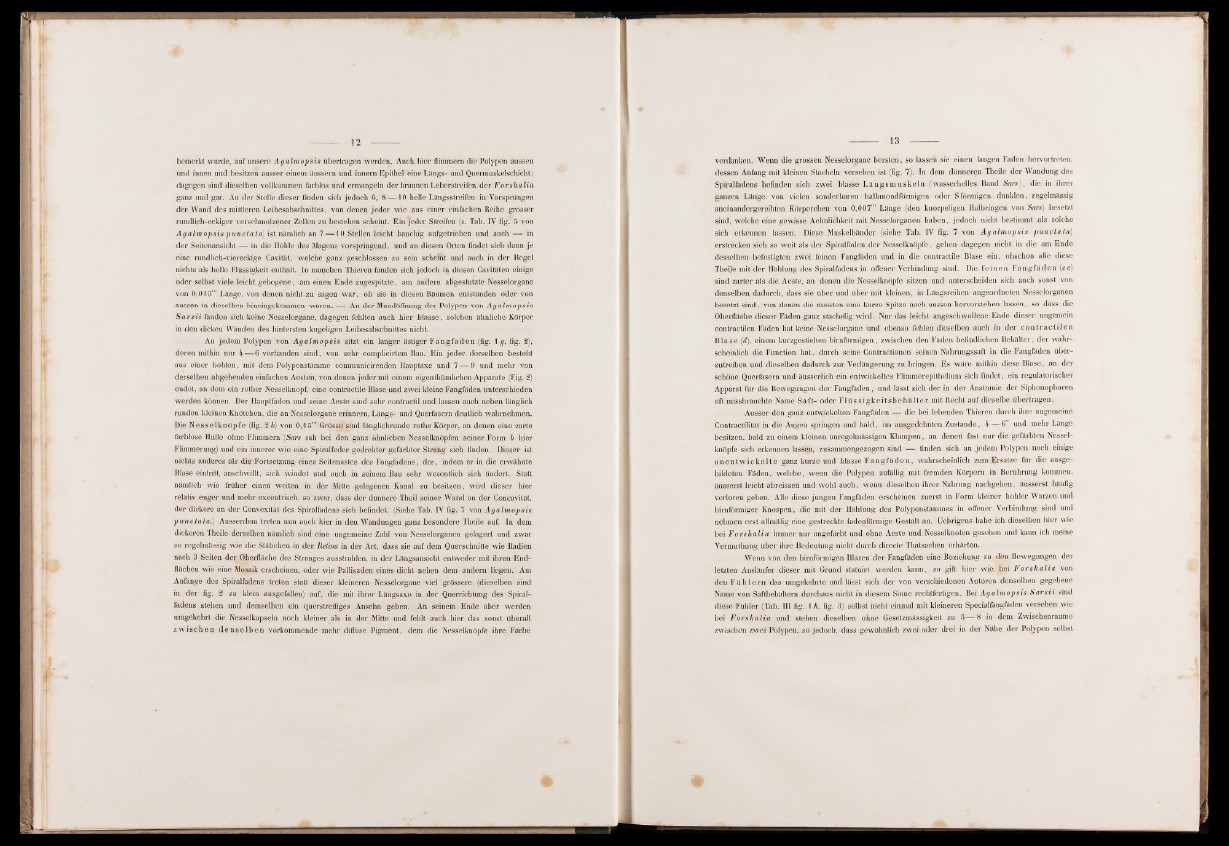
bemerkt wurde, auf unsere A g a lm o p sis übertragen werden. Auch hier flimmern die Polypen aussen
und innen und besitzen ausser einem äussern und innern Epithel "eine Längs- und Quermuskelschicht;
dagegen sind dieselben vollkommen farblos und ermangeln der braunen Leberstreifen, der F o r s k a lia
ganz und gar. An der Stelle dieser finden sich jedoch 6, 8 — 10 helle Längsstreifen in Vorsprüngen
der Wand des mittleren Leibesabschnittes, von denen jeder wie aus einer einfachen Reihe grosser
rundlich-eckiger verschmolzener Zellen zu bestehen scheint. Ein jeder Streifen (s. Tab. IV fig. 5 von
A g a lm o p s is p u n c ta ta ) ist nämlich an 7— 10 Stellen leicht bauchig aufgetrieben und auch — in
der Seitenansicht — in die Höhle des Magens vorspringend, und an diesen Orten findet sich dann je
eine rundlich-viereckige Cavität, welche ganz geschlossen zu sein scheint und auch in der Regel
nichts als helle Flüssigkeit enthält. In manchen Thieren fanden sich jedoch in diesen Cavitäten einige
oder selbst viele leicht gebogene, am einen Ende zugespitzte, am andern aBgestutzte Nesselorgane
von 0,015'" Länge, von denen nicht^u sagen war, ob sie in diesen Räumen entstanden oder von
aussen in dieselben hineingekommen waren. - |||A n der Mundöffnung der Polypen von A g almopsis
S a r s ii fanden sich keine Nesselorgane, dagegen fehlten auch hier blasse., solchen ähnliche Körper
in den dicken Wänden des hintersten kugeligen Leibesabschnittes nicht.
An jedem Polypen von A g a lm o p s is sitzt ein langer ästiger F a n g f a d e n (fig. 1 g, fig. 2),
deren mithin nur 4—6 vorhanden sind, von «ehr complicirtem Bau. Ein jeder derselben besteht
aus einer hohlen, mit dem Polypenstamme communicirenden Hauptaxe und 7 — 9 und mehr von
derselben abgehenden einfachen Aesten, von denen jeder mit einem eigentümlichen Apparate (Fig. 2)
endet, an dem ein rother Nesselknopf, eine contractile Blase und zwei kleine Fangfäden unterschieden
werden können. Der Hauptfaden und seine Aeste sind sehr contractil und lassen auch neben länglich
runden kleinen Knötchen, die an Nesselorgane erinnern, Längs- und Querfasern deutlich wahrnehmen.
Die N e s s e lk n ö p fe (fig. 2 b) von 0,15'" Grösse 'sind länglichrunde rothe Körper, an denen eine zarte
farblose Hülle ohne Flimmern (Sars sah bei den ganz ähnlichen Nesselknöpfen seiner Form b hier
Flimmerung) und ein innerer wie eine Spiralfeder gedrehter gefärbter Strang sich finden. Dieser ist
nichts anderes als die Fortsetzung eines Seitenastes des Fangfadens, der, indem er in die erwähnte
Blase eintritt, anschwillt, sich windet und auch in seinem Bau sehr wesentlich sich ändert. Statt
nämlich wie früher einen weiten in der Mitte gelegenen Kanal zu besitzen, wird dieser hier
relativ enger und mehr excentrisch, so zwar, dass der dünnere Theil seiner Wand an der Concavität,
der dickere an der Convexität des Spiralfadens sich befindet. (Siehe Tab. IV fig. 7 von A g a lm o p s is
p u n c ta ta .) Ausserdem treten nun auch hier in den Wandungen ganz besondere Theile auf. In dem
dickeren Theile derselben nämlich sind eine ungemeine Zahl von Nesselorganen gelagert und zwar
so regelmässig wie die Stäbchen in der'Retina in der Art, dass sie auf dem Querschnitte wie Radien
nach 3 Seiten der Oberfläche des Stranges ausstrahlen, in der Längsansicht entweder mit ihren Endflächen
wie eine Mosaik erscheinen, oder wie Pallisaden eines dicht neben dem andern liegen. Am
Anfänge des Spiralfadens treten statt dieser kleineren Nesselorgane viel grössere (dieselben sind
in, der fig. 2 zu klein ausgefallen) auf, die mit ihrer Längsaxe in der Querrichtung des Spiralfadens
stehen und demselben ein querstreifiges Ansehn geben. An seinem Ende aber werden
umgekehrt die Nesselkapseln noch kleiner als in der Mitte und fehlt auch hier das sonst überall
zw is c h e n d e n s e lb e n vorkommende mehr diffuse Pigment, dem die Nesselknöpfe ihre Farbe
verdanken. Wenn die grossen Nesselorgane bersten, so lassen sie einen langen Faden hervortreten,
dessen Anfang mit kleinen Stacheln versehen ist (fig. 7). In dem dünneren Theile der Wandung des
Spiralfadens befinden sich zwei blasse L ä n g sm u s k e ln (wasserhelles Band Sars), die in ihrer
ganzen Länge von vielen sonderbaren halbmondförmigen oder Sförmigen dunklen, regelmässig
aneinandergereihten Körperchen von- 0,007'" Länge (den knorpeligen Halbringen von Sars) besetzt
sind, welche eine gewisse Aehnli(Thkeit mit Nesselorganen haben, jedoch nicht bestimmt als solche
sich erkennen lassen. Diese Muskelbänder (siehe Tab. IV fig. 7 von A g a lm o p s is p u n c ta ta )
erstrecken sich so weit als der Spiralfaden der Nesselknöpfe, gehen dagegen nicht in die am Ende
desselben befestigten zwei feinen Fangfäden und in die contractile Blase ein, obschon alle diese
Theile mit der Höhlung des Spiralfadens in offener Verbindung sind. Die fe in e n F a n g fä d e n (cc)
sind zarter als die Aeste, an denen die Nesselknöpfe sitzen und unterscheiden sich auch sonst von
denselben.dadurch, dass sie über und Uber mit kleinen, in Längsreihen angeordneten Nesselorgähen
besetzt sind, von denen die meisten eine kurze Spitze nach aussen hervorstehen lassen, so dass die
Oberfläche dieser Fäden ganz stachelig wird. Nur das leicht angeschwollene Ende dieser ungemein
contractilen Fäden hat keine Nesselorgane und ebenso fehlen dieselben auch in der c o n tr a c ti le n
B la s e (d); einem kurzgestielten bimförmigen, zwischen den Fäden befindlichen Behälter, der wahrscheinlich
die Function h at, durch seine Contractionen seinen Nahrungssaft in die Fangfäden überzutreiben
und dieselben dadurch zur Verlängerung zu bringen. Es wäre mithin diese Blase, an der
schöne Querfasern und äusserlich ein entwickeltes Flimmerepithelium sich findet, ein regulalorischer
Apparat für die Bewegungen der Fangfäden, und lässt sich der in der Anatomie der Siphonophoren
oft missbrauchte Name S aft- oder F lü s s ig k e it s b e h ä l te r mit Recht auf dieselbe übertragen.
Ausser den ganz entwickelten Fangfäden — die bei lebenden Thieren durch ihre ungemeine
Contractilität in die Augen springen und bald, im ausgedehnten Zustande, 4 — 6" und mehr Länge
besitzen, bald zu einem kleinen unregelmässigen Klumpen , an deneff fast nur die gefärbten Nesselknöpfe
sich erkennen lassen, zusammengezogen sind — finden sich an jedem Polypen noch einige
u n e n tw ic k e l te ganz kurze und blasse F a n g f ä d e n , wahrscheinlich zum Ersätze für die ausgebildeten
Fäden, welche, wenn die Polypen zufällig mit fremden Körpern in Berührung kommen,
äusserst leicht abreissen und wohl auch, wenn dieselben ihrer Nahrung nachgehen, äusserst häufig
verloren gehen. Alle diese jungen Fangfäden erscheinen zuerst in Form kleiner hohler Warzen und
bimförmiger Knospen, die mit der Höhlung des Polypenstammes in-offener Verbindung sind und
nehmen erst allmälig eine gestreckte fadenförmige Gestalt an. Uebrigens habe ich dieselben hier wie
bei F o r s k a lia immer nur .ungefärbt und ohne Aeste und Nesselknoten gesehen und kann ich meine
Vermulhung über ihre Bedeutung nicht durch directe Thatsachen erhärten.
Wenn von den bimförmigen Blasen der Fangfäden eine Beziehung zu den Bewegungen der
letzten Ausläufer dieser mit Grund statuirt werden kann, so gilt hier wie bei F o r s k a lia von
den F ü h l e rn 'd a s umgekehrte und lässt sich der von verschiedenen Autoren denselben gegebene
Name von Saftbehältern durchaus nicht in diesem Sinne rechtfertigen. Bei A g a lm o p s is S a r s ii sind
diese Fühler (Tab. III fig. 1 h, fig. 3) selbst nicht einmal mit kleineren Specialfangfäden versehen wie
bei F o r s k a lia und stehen dieselben ohne Gesetzmässigkeit zu 5 — 8 in dem Zwischenräume
zwischen zwei Polypen, so jedoch, dass gewöhnlich zwei oder drei in der Nähe der Polypen selbst