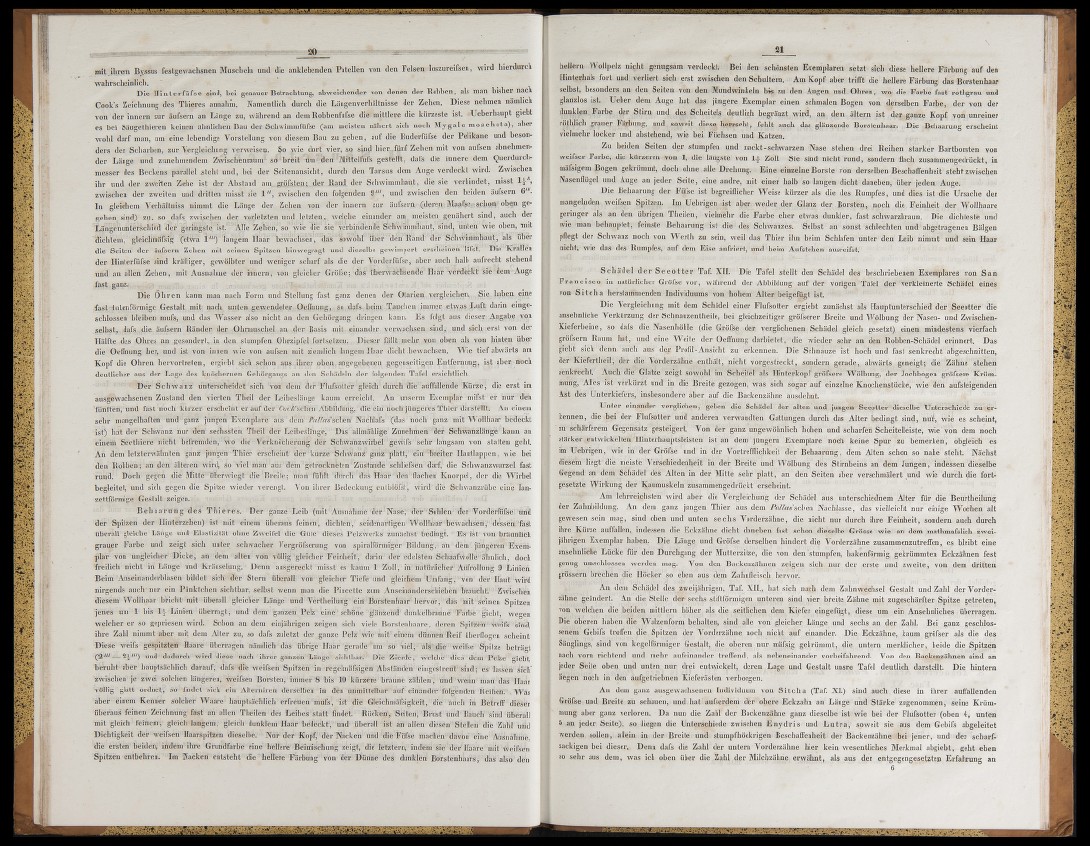
t V N
5 :4
IM • »I |x V 'ff:
*rff
-• ’*!
■• Tr'«iJ]
\ < ^
1‘* i:
“fft'
ß
b :|
> ,;X .
K. •>
. > s
"15
J
1 ^ ' . ’
1 \
ffi:
i
t> i'
ßE
,w.
'■‘d i
I
i
lA- <-
mit ihrem Byssiis feslgewachsnen Musohelu mul die anklehcnden Patellen von den Felsen loszureifsen, wird hierdurch
wahrscheinlich.
Die l l i i i l e r f ü f s e sind, bei genauer Betrachtung, abweichender von denen der Robben, als man bisher nach
Cook’s Zeichnung des Thicres nimahm. Namentlich durch die Liingciiverhällnisse der Zehen. Diese nehmen nämlich
von der innern zur äufsern an Fänge zu, rvährend au dem Robbenfufsc die mitllcre die kürzeste ist. Ueberhaupt gieht
es hei Säugcthicren keinen ähnliclu'ii Bau der Schwimmfüfse (am meisten nälicrt sich noch M y g a le m o s c h a ta ) , aber
wohl darf man, um eine lebendige Vorstellung von diesem Bau zu gehen, auf die Ruderlülse der Pelikane und besonders
der Scharben, zur A’ergleichung verweisen. So wie dort vier, so sind hier fünf Zehen mit von aulsen abnehmender
Länge lind zunehmendem Zwischenraum so breit um den Mittelfiifs gestellt, dafs die innere dem Qiierdiirch-
messer des Beckens parallel steht und, bei der Seitenansicht, diircli den Tarsus dem Auge verdeckt wird. Zwischen
ihr und der zweiten Zehe i.st der .Abstand am gröfsten; der Rand der Scliwimiiiliaut, die sie verbindet, misst Ij- ,
zwisclien der zweiten und dritten misst sie 1 " , zwischen den folgenden 9 '" , mul zwisclieii den beiden äulsern 6 .
ln gleichem Verhälliiiss nimmt die Länge der Zehen von der iimcrn zur äulsern (deren Maalse schon oben gegeben
sind) zu, so dafs zwischen der vorletzten und letzten, welche einander am iiicisten genähert sind, auch der
Längeiiunter.schied dor geringste ist. Alle Zehen, so wie die sic verbindende Scluvimmhaiit, sind, unten wie oben, mit
dichtem, gleichmäfsig (etwa 1"') langem Haar bewachsen, das sowohl über den Rand der Schwimmhaut, als über
die Seilen der äufsern Zehen mit seinen Spitzen hinwegragt und dieselbe, gewlinpert erscheinen lälst. Die Krallen
der Hintei'füfse sind kräftiger, gewölbter und weniger scharf als die der A orderlüfse, aber auch hall) aufrecht stehend
und an ollen Zehen, mit Ausnahme der innern, loii glelchei' Gröfse; das übenvachsende Haar verdeckt sie dem Auge
fast ganz.
Die Ö h r e n kann man nach Form und Stellung fast ganz denen der Otarieii vergleichen. Sie liaben eine
fa.st luleiiföi'mige Geslalt mit nach unten gewendeter Oclfnimg, so dafs beim Tauchen immer etwas Luft darin eingeschlossen
bleiben mnfs, und das AA’asser also nicht an den Geliörgaiig dringen kann. Es folgt ans dieser Angabe von
selbst, dafs die änfsern Ränder der Ohrmuschel an der Basis mit einander verwachsen sind, und sich erst von der
Hälfte des Ohres an gesondert, in den stumpfen Ohrzipfel rorlselzeii. Dieser fällt mehr von oben als von hinten über
die Oeifnung her, und ist von innen wie von aufsen mit ziemlich langem Haar dicht .bewachsen. AA ie tief abwärts am
Kopf die Ohren hervortreten, crgiebt sich schon aus ihrer oben angegebenen gegenseitigen Eulferming, ist aber noch
deutlicher aus der Lage des knöchernen Gchörgaugs an den Stliädehi der folgenden Tafel ersiclillich.
Der S c liw a n z unterscheidet sich von dem der Lhifsotler gleich durch die auffallende Kürze, die erst im
ausgewachsenen Zustand den vierten Theil der Leibeslärige kaum erreicht. An iinserm Exemplar mifst er nur den
fünften, und fast noch kürzer erscheint er auf der Cock’scheu Ahbildiiug, die ein noch jüngeres Thier darslellt. Au einem
sehr mangelhaften und ganz jungen Exempl.irc aus dem P/iIfus’sc\ieii Nachlafs (das nocli ganz mit AA ollhaar bedeckt
ist) hat der Schwanz nur den scchsslcn Tlieil der Leilieslänge, Das alhnäblige Zunehmen der Schwanzlänge kann an
einem Seethiere nicht befremden, wo die Verknöcherung der Schwanzwirbel gewifs sehr langsam von statten geht.
An dem letzlerwälinlen ganz jungen Tliler erscheint der kurze Schwanz ganz platt, ein breiter Haiitlappcn, v le bei
den Robben; an den älteren wird, so viel man aus dem getrockneten Zustande schliefscii darf, die Schwanzwurzel fast
rund. Doch gegen die Bliltc üherwiegt die Breite: man fühlt durrh das H.aar den llachen Knorpel, der die AA'irhcl
begleitet, und sich gegen die Spilze wieder verengt. Aon itirer Bedeckung enlblüfst, wird die Seliwanzrübe eine lanzettförmige
Geslalt zeigen.
B e h a a r u n g d e s T h ie r e s . Der ganze Leib (mit An.snahmc der Nase, der Sohlen der Vorderfüfse und
der S])ilzen der Hinterzeheii) ist mit einem überaus feinen, dichten, seidenartigen A'V'oHliaar bcwaehsen, dessen fast
überall gleiche Länge niid Elastizität ohne Zweifel die Güte dieses Pelzwei-ks zunächst bedingt. Es ist von bräunlich
grauer Farbe und zeigt sich unter schwacher A’ergröfserung von spiralförmiger Bildung, au dem jüngeren Exemplar
von ungleicher Dicke, an dem alten von völlig gleicher Feinheit, darin der edelsten Schaafvvolle ähnlich, doch
freilich nicht in Länge und Kräuselung. Denn aiisgereckt misst es kaum 1 Zoll, in natürlicher Anfrollimg 9 Linien.
Beim Anseinanderblascn bildet sich der Stern nherall von gleicher Tiefe imd gleichem Umfang, von der Haut wird
iilrgeiuls auch mir ein Pünktchen sichlhar, seihst wenn man die Piiicellc zum Auseiiiaiiderschlehcn braucht. Zwischen
diesem AVoliiiaar bricht mit überall gleicher Länge und A''crthelliing ein Borstenhaar hervor, das mit seinen Spitzen
jenes um 1 bis l.V Linien überragt, und dem ganzen Pelz eine schöne glänzend dimkelhraime h’arhe gieht, wegen
welcher er so gepriesen wird. Schon an dem eiujälirigen zeigen sich viele Borstenliaarc, dei'en Siiilzen weifs sind,
ihre Zahl nimmt aber mit dem Aller zu, so dafs zuletzt der ganze Pelz wie mit einem dünnen Reif übeiHogen scheint.
Diese weifs gespitzten Haare iil)crragen iiändich das übrige Haar gei'ade um so viel, als die weifse Siiilze belrä<'t
(2 '" — 2 J'" ) und dadurch wird diese nach ihrer ganzen Länge sichtbar. Die Zierde, welclie dies dem Pelze giebl,
beruht aber liauptsächllch darauf, dafs die weifsen Spitzen in rcgehnäfsigen Abständen eiiigcslrent sind; es lassen sich'
zwischen je zwei solchen längeren, weifsen Borsten, immer 8 bis 10 kürzere braune zählen, nnd wenn man das Haar
völlig glatt ordnet, so lindct sieh ein Allerniren derselben In den immittelbar auf einander folgenden Reihen. AVas
aber einem Kenner solcher AVaare hauptsächlich errreuen mufs, ist die Gleichmäfsigkelt, die auch in BclielT dieser
überaus feinen Zelclmung fast an allen Theilen des Leibes statt findet. Rücken, Seilen, Brust und Bauch sind überall
mit gleich feinem, gleich langem, gleich dunklem Haar bedeckt, und überall ist an allen diesen Stellen die Zahl und
Dichtigkeit der weifsen Haarspilzen dieselbe. Nur der Kopf, der Nacken und die Füfse machen davon eine Ausnahme,
die ersten beiden, indem ihre Grundfarbe eine hellere Beimischung zeigt, die letzlerri, indem sie der Haare mit weifsen
Spitzen entbehren. Im Nacken entsteht die hellere Färbung von der Dünne des dunklen Borstenhaars, das also den
hellem AVollpelz nicht genugsam verdeckt. Bei den schönsten Exemplaren setzt sich diese hellere Färbung auf den
Ilinterhals fort und verliert sich erst zwischen den Schultern. Am Kopf aber trifft die hellere Färbung das Borstenhaar
selbst, besonders an den Seiten von den Mundwinkeln bis zu den Augen und Ohren, wo die Farbe fast rothgrau und
glanzlos ist. Ueber dem Auge hat das jüngere Exemplar einen schmalen Bogen von derselben Farbe, der von der
dunklen Farbe der Stirn und des Scheitels deutlich bcgi'änzt wird, an dem ältern ist der ganze Kopf von unreiner
röthlich grauer Färbirag, und soweit diese herrscht, fehlt auch das glänzende Borstenhaar. Die Behaarung erscheint
vielmehr locker und abstehend, wie hei Füchsen und Katzen.
von
in
Zn beiden Seiten der stumpfen und nackt-schwarzen Nase stehen drei Reihen starker Bartborsten
weifser Farbe, die kürzeren von 1, die längste von I 4 Zoll. Sie sind nicht rnnd, sondern flach zusammengedrückt, i
mälsigem Bogen gekrümmt, doch ohne alle Drehung. Eine einzelne Borste von derselben Beschaffenheit steht zwischen
Nasenflügel nnd Auge an jeder Seile, eine andre, mit einer halb so langen dicht daneben, über jedem Auge.
Die Behaanmg der Fül'sc Ist begreiflicher AVeise kürzer als die des Rumpfes, und dies ist die Ursache der
mangelnden weifsen Spllzen. Im Uebrigeii ist aber weder der Glanz der Borsten, noch die Feinheit der AVollhaare
geringer als an den übrigen Theilen, vielmehr die Farbe eher etwas dunkler, fast schwarzbraun. Die dichteste und
wie man behmiplet, teinste Behaarung ist die des Schwanzes. Selbst an sonst schlechten und abgetragenen Bälgen
pflegt der Schwanz noch von AA'erlh zu sein, weil das Thier ihn beim Schlafen unter den Leib nimmt und sein Haar
nicht, wie das des Rumpfes, auf dem Eise anfriert, und beim Aiifstehen ausreifst.
S c h ä d e l d e r S e e o t t e r Taf. XII. Die Tafel stellt den Schädel des beschriebenen Exempl ares von S a n
F r a n c is c o in natürlicher Gröfse vor, wahrend der Ahbildung auf der vorigen Tafel der verkleinerte Schädel eines
von S i t c h a lierstainnienden Individuums von hohem Alter beigefügt ist.
Die Vergleichung mit dem Schädel einer Flufsotter ergiebt zunächst als Haiiptunterschied der Seeotter die
ansehnliche Verkürzung der Schnaiizentheile, bei gleichzeitiger gröfserer Breite und Wölbung der Nasen- und Zwischen-
Kieferbeine, so dafs die Nasenhöhle (die Gröfse der vergiiclienen Schädel gleich gesetzt) einen mindestens vierfach
grÖlsern Raum hat, und eine AVeile der OeAnung darbielct, die wieder sehr an den Robhen-Schädel erinnert. Das
gieht sich denn auch aus dor Profd-Ansicht zu erkennen. Die Schnauze ist Jioch und fast senkrecht abgeschnitten,
der Kieferlheil, der die Aovderzalme enthält, nicht vorgestreckt, sondern gerade, abwärts geneigt; die Zähne stehen
senkrecht. Auch die Glalze zeigt sowohl im Scheitel als Ilintcrkopf gröfsere AVÖlbung, der Jochbogen gröfsere Krüin-
miing, Alles ist verkürzt und in die Breite gezogen, was sich sogar auf einzelne Knochenstücke, wie den aufsleigenden
Ast des Unterkiefers, iushesondere aber auf die Backenzähne ausdehnt.
Unter einander verglichen, geben die Schädel der alten und jungen Seeotter dieselbe Unterschiede zu erkennen,
die bei dev Flufsotter und anderen verwandten Gattungen durch das Alter bedingt sind, nur, wie es scheint,
zu schärferem Gegensatz gesteigert. Von der ganz ungewöhnlich hohen und scharfen Scheitelleiste, wie von dem noch
stärker entwickelten Hlnterhauptsleisten ist an dem jüngern Exemplare noch keine Spur zu bemerken, obgleich es
im Uebrigen, wie in der Gröfse und in der V^ortrefflichkeit der Behaarung, dem Alten schon so nahe steht. Nächst
diesem liegt die meiste Verschiedenheit in der Breite und AVölbung des Stirnbeins an dem Jungen, indessen dieselbe
Gegend an dem Schädel des Allen in der Mitte sehr platt, an den Seiten aber verschmälert und wie durch die fortgesetzte
Wirkung der Kaumuskeln zusammengedrückt erscheint.
Am lehrreichsten wird aber die Vergleichung der Schädel aus iinterscliiednem Alter für die Beurtheilung
der Zahnhildurig. An dem ganz jungen Thier aus dem Pa/las sehen Nachlasse, das vielleicht nur einige Wochen alt
gewesen sein mag, sind oben und unten s e c h s Ayrderzahnc, die nicht nur durch ihre Feinheit, sondern auch durch
ihre Kürze aidlallen, indessen die Eckzälinc dicht daneben fast schon dieselbe Grösse wie an dem muthmafslich zweijährigen
Exemplar haben. Die Länge und Grölse derselben hindert die \ orderzähne zusammenzutreifen, es bleibt eine
ansehnliche Lücke für den Durchgang der Multerzitze, die von den stumpfen, hakenförmig gekrümmten Eckzälmen fest
genug umschlossen werden mag. Ayn den Backenzähnen zeigen sicli nur der erste und zweite, von dem dritten
grÖssern brechen die Höcker so eben aus dem Zalmfleisch hervor.
Au dem Schädel des zvveijähiigcn, Taf. XII., hat sich nach dem Zahnwechsel Gestalt und Zaiil der Vorder-
zälme geändert. An die Stelle der sechs stiftfönnigen unteren sind vier breite Zähne mit zugeschärfter Spitze getreten,
von welchen die beiden inllllern hölicr als die seilllcheii dem Kiefer eingefügt, diese um ein Ansehnliches überragen.
Die oberen haben die AAffalzenform behalten, sind alle von gleicher Länge und sechs an der Zaid. Bei ganz geschlossenem
Gehifs treA’en die Spitzen der A'ordcrzähne noch nicht auf einander. Die Eckzähne, kaum grofser als die des
Säuglings, sind von kegelförmiger Geslalt, die olicrca nur inäfsig gekrümmt, die untern merklicher, beide die Spllzen
nach vorn richlciul und mehr aufeinander trelfend, als nebeneinander vorheifahrend. Von den Backenzähnen sind an
jeder Seite oben und unten nur drei entwickelt, deren Lage und Gestalt unsre Tafel deutlich darstellt. Die hintern
liegen nocli in den aufgetriebnen Kieferästen verborgen.
An dem ganz ausgewachsenen Individuum von S i t c h a (Taf. XI.) sind auch diese in ihrer auffallenden
Gröfse und Breite zu schauen, uiuMiat aufscrdem der obere Eckzahn an Länge und Starke zugenommen, seine Krüra-
nuiiig aber ganz verloren. Da nun die Zahl der Backenzähne ganz dieselbe ist wie bei der Flufsotter (oben 4, unten
5 an jeder Seite), so liegen die Unterschiede zwischen E n y d r is und L u t r a , soweit sie aus dem Gehifs abgeleitet
werden sollen, allein in der Breite und slumpfhÖckrigen Beschaffenheit der Backenzähne bei jener, und der scharfzackigen
bei dieser. Demi dafs die Zahl der untern Vorderzälme hier kein wesentliches Merkmal abgiebt, geht eben
so selir aus dem, was ich oben über die Zahl der Milchzähne erwähnt, als aus der entgegengesetzten Erfahrung an
6
t
A'-:
f f ) "
I i)
i ?