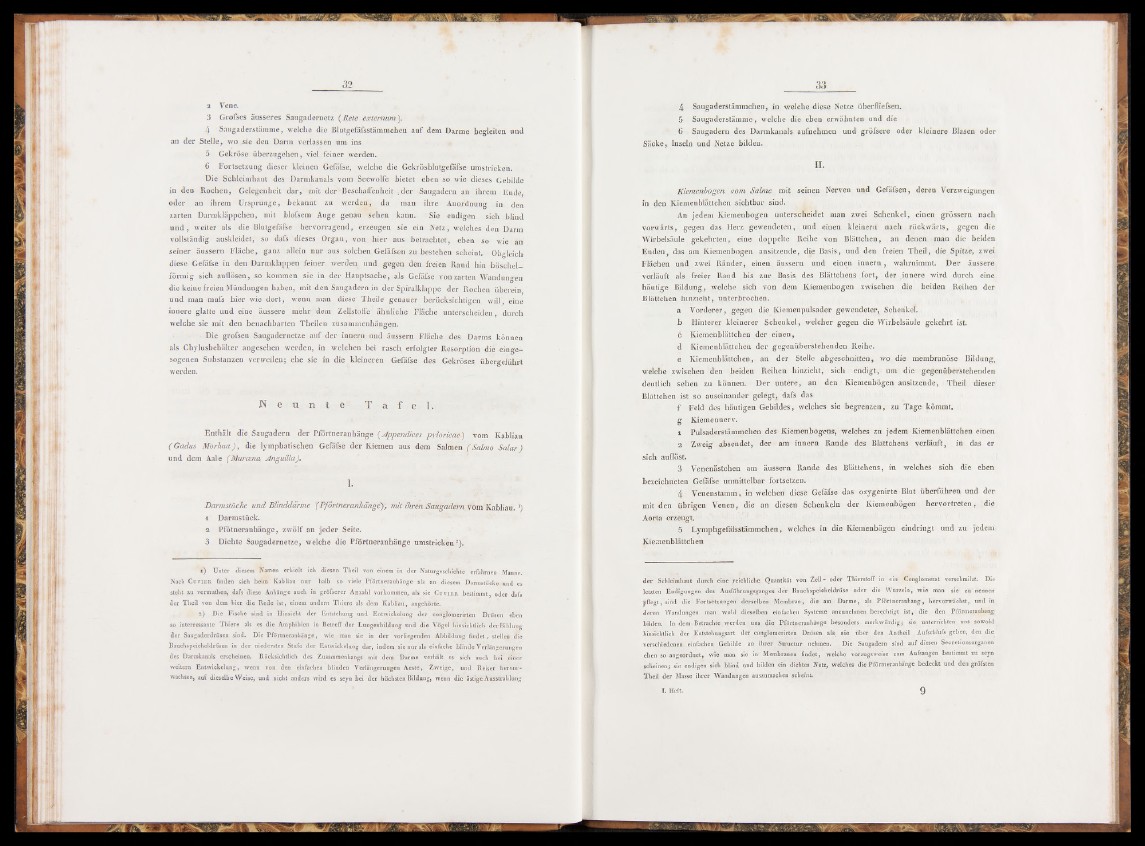
3 Gröfses äusseres Saugadernetz ( Rete externum). •
4 Saugaderstämme, welche die Blutgefäfsstämmchen auf dem Darme begleiten und
an der Stelle, wo sie den Darm verlassen um ins
5 Gekröse überzugehen, viel feiner werden.
6 Fortsetzung dieser kleinen Gefäfse, welche die Gekrösblutgefäfse umstricken.
Die Schleimhaut des Darmkanals vom Seewolfe bietet eben so wie dieses Gebilde
in den. Rochen, Gelegenheit dar, mit der Beschaffenheit ider Saugadern an ihrem Ende
oder an ihrem Ursprünge, bekannt zu werden, da man ihre Anordnung in den
zarten Darmkläppchen, mit blofsem Auge genau sehen kann. Sie endigen sich blind
und, weiter als die Blutgefäfse hervorragend, erzeugen sie ein Netz, welches den Darm
vollständig auskleidet, so dafs dieses Organ, von hier aus betrachtet, eben so wie an
seiner äussern Fläche, ganz allein nur aus solchen Gefäfsen zu bestehen scheint. Obgleich
diese Gefäfse in den Darmklappen feiner, werden und gegen den freien Rand hin büschelförmig
sich auflösen, so kommen sie in der Hauptsache, als Gefäfse von zarten Wandungen
die keine freien Mündungen haben, mit den Saugadern in der Spiralklappe der Rochen überein
und man mufs hier wie dort, wenn man diese' Theile' genauer berücksichtigen will eine
innere glatte und eine äussere mehr dem Zellstoffe ähnliche Fläche unterscheiden durch
welche sie mit den benachbarten Theilen Zusammenhängen.
Die grofsen Saugadernetze auf der innern und äussern Fläche des Darms können
als Chylusbehälter angesehen werden, in welchen bei rasch erfolgter Resorption die ein ^e-
sogenen Substanzen verweilen; ehe sie in die kleineren Gefäfse des Gekröses übergeführt
werden.
N e u n t e T a f e l .
Enthält die Saugadern der Piörtneranhänge (Jppendices p r l o n c ü e vom Kabliau
(Gädus Morhua), die lymphatischen Gefäfse der Kiemen aus dem Salinen (Salmo SalarJ
und dem Aale (Murcena Anguiüa).
1.
Darmstücke und Blinddärme XPförtneranhänge'), mit ihren Saugadern vom Kabliau. *)
1 Darmstück.
2 Pfötneranhänge, zwölf an jeder Seite.
3 Dichte Saugadernetze, welche die Pförtneranhänge umstricken2).
0 Unter diesem Namen erhielt ich diesen Theil von einem in der Naturgeschichte erfahrnen Manne.
Nach Co v ier finden sich beim Kabliau nur halb so viele Pförtneranhänge als an diesem Darmslücke und es
steht zu vermuthen, dafs'diese Anhänge auch in gröfserer Anzahl Vorkommen, als sie C u v ie r bestimmt oder dafs
der Theil von dem hier di>e Rede ist, einen1 andern Thiere als dem Kabliau, ar'gehe
2) Die Fische :>ind in Hinsicht der Entstehung und Entwickelung der conglomerirten Drüsen eher
so interressante Thiere als es die Amphibi«;n in Betreff der Lungenbildung und die Vögel hinsichtlich der Bildung
der Saugaderdrüsen sind. Die Pförtneranhä nge, wie man sie in der vorliege nden Abbildung findet, stellen di<
Bauchspeicheldrüsen in der niedersten Stufe der Entwickelung dar, indem.:sie nui■ als 'einfache blinde Verlängeranger
des Darmkanals erscheinen. Rücksichtlich des Zusammenhangs mit dem Darme verhält es sich auch bei einer
weitern Entwickelung, wenn von den einfachen blinden Verlängerungen A es te, Zw e ig e , und Reiser hervorwachsen,
auf dieselbe Weise, und nicht anders wird es seyn bei der höchsten Bildung, wenn die ästige Ausstrahlung
4 Saugaderstämmchen, in welche diese Netze überfliefsen.
5 Saugaderstämme, welche die eben erwähnten und die
6 Saugadern des Darmkanals aufnehmen und gröfsere oder kleinere Blasen oder
Säcke, Inseln und Netze bilden.
H.
Kiemenbogen vom Salme mit seinen Nerven und Gefäfsen, deren Verzweigungen
in den Kiemenblättchen sichtbar sind.
An jedem Kiemenbogen unterscheidet man zwei Schenkel, einen grossem nach
vorwärts, gegen das llerz gewendeten, und einen kleinern nach rückwärts, gegen die
Wirbelsäule gekehrten, eine doppelte Reihe von Blättchen, an denen man die beiden
Enden, das am Kiemenbogen ansitzende, die Basis, und den freien Theil, die Spitze, zwei
Flächen und zwei Ränder, einen äussern und einen innern, wahrnimmt. Der äussere
verläuft als freier Rand bis zur Basis des Blättchens fort, der innere wird durch eine
häutige Bildung, welche sich von dem Kiemenbogen zwischen die beiden Reihen der
Blättchen hinzieht, unterbrochen.
a Vorderer, gegen die Kiemenpulsader gewendeter, Schenkel.
b Hinterer kleinerer Schenkel, welcher gegen die Wirbelsäule gekehrt ist.
c Kiemenblättchen der einen,
d Kiemenblättchen der gegenüberstehenden Reihe.
e Kiemenblättchen, an der Stelle abgeschnitten, wo die membranöse Bildung,
welche zwischen den beiden Reihen hinzieht, sich endigt, um die gegenüberstehenden
deutlich sehen zu können. Der untere, an den Kiemenbögen ansitzende, Theil dieser
Blättchen ist so auseinander gelegt, dafs das
f Feld des häutigen Gebildes, welches sie begrenzen, zu Tage kömmt.
g Kiemen nerv.
1 Pulsaderstämmchen des Kiemenbogens, welches zu jedem Kiemenblättchen einen
2 Zweig absendet, der am innern Rande des Blättchens verläuft, in das er
sich auflöst.
3 Venenästchen am äussern Rande des Blättchens, in welches sich die eben
bezeichneten Gefäfse unmittelbar fortsetzen.
4 Venenstamm, in welchen diese Gefäfse das oxygenirte Blut überführen und der
mit den übrigen Venen, die an diesen Schenkeln der Kiemenbögen hervortreten, die
Aorta erzeugt.
5 Lymphgefalsstämmchen, welches in die Kiemenbögen eindringt und zu jedem
Kiemenblättchen
der Schleimhaut durch eine reichliche Quantität von Z e ll- oder Thierstoff in ein Conglomérat verschmilzt. Die
letzten Endigungen des Ausführungsganges der Bauchspeicheldrüse oder die Wurzeln, w ie man sie zu nennen
pflegt, sind die Fortsetzungen derselben Membran, die am Darme, als Pförtneranhang, hervorwäehst, und in
deren Wandungen man wohl dieselben einfachen Systeme anzunehmen berechtigt ist, die den Pförlneranhang
bilden. In demvBetrachte werden uns die Pförtneranhänge besonders merkwürdig; sie unterrichten uns sowohl
hinsichtlich der Entstehungsart der conglomerirten Drüsen als sie über den Antheil .Aufschlufs geben, den die
verschiedenen einfachen Gebilde an ihrer Siructur nehmen. Die Saugadern sind auf diesen Secretionsorganen
eben so angeordnet, w ie man sie in Membranen findet, welche vorzugsweise zum Aufsaugen bestimmt zu seyn
scheinen; sie endigen sich blind Und bilden ein dichtes Netz, welches die Pförtneranhänge bedeckt und den gröfsten
Theil der Masse ihrer Wandungen auszumachen scheint.