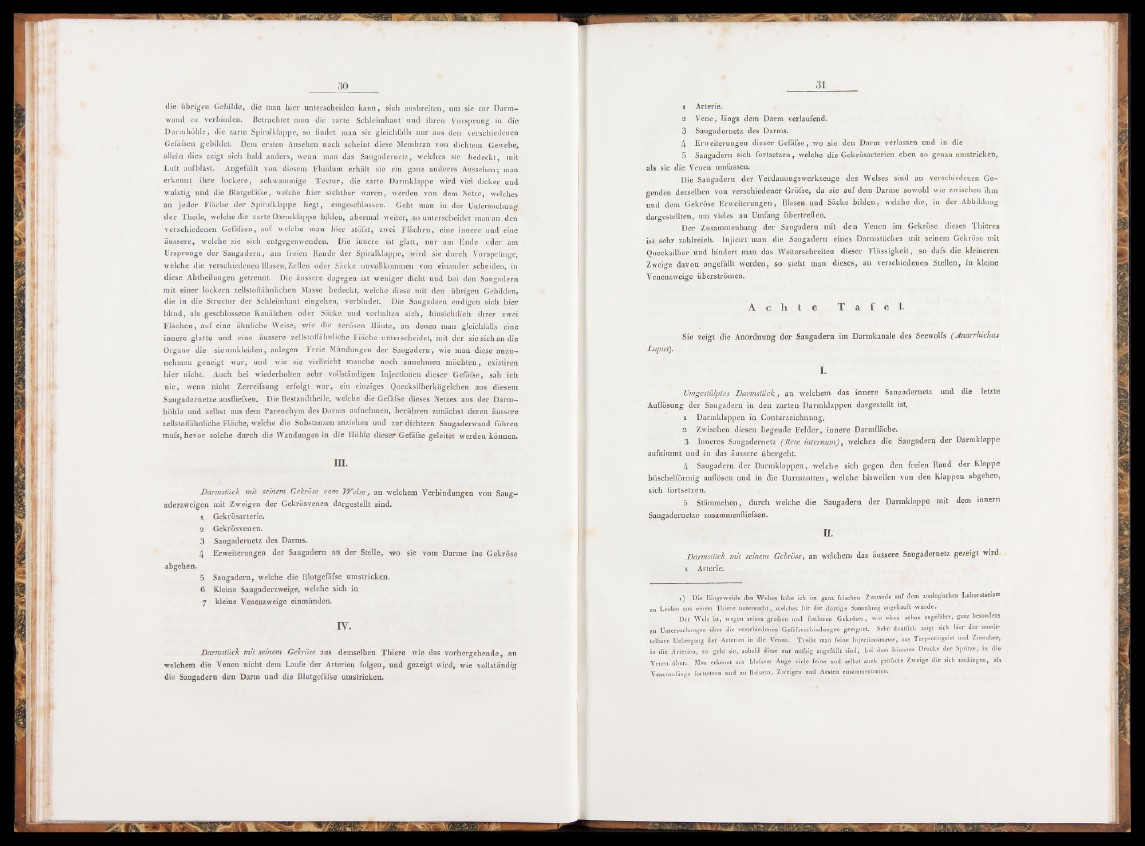
die übrigen Gebilde, die man hier unterscheiden kann, sich ausbreiten, um sie zur Darmwand
zu verbinden. Betrachtet man die zarte Schleimhaut und ihren Vorsprung in die
Darmhöhle, die zarte Spiralklappe, so fiudet man sie gleichfalls nur aus den verschiedenen
Gefäfsen gebildet. Dem ersten Ansehen nach scheint diese Membran von dichtem Gewebe,
allein dies zeigt sich bald anders, wenn man das Saugadernetz, welches sie bedeckt, mit
Luft aufbläst. Angefüllt von diesem Fluidum erhält sie ein ganz anderes Aussehen; man
erkennt ihre lockere, schwammige Textur, die zarte Darmklappe wird viel dicker und
wulstig nnd die Blutgefäfse, welche hier sichtbar waren, werden von dem Netze, welches
an jeder Fläche der Spiralklappe liegt, eingeschlosseu. Geht man in der Untersuchüno*
der Theile, welche die zarte Darmklappe bilden, abermal weiter, so unterscheidet man an den
verschiedenen Gefäfsen, auf welche man hier stöfst, zwei Flächen, eine innere und eine
äussere, welche sie sich entgegenwenden. Die innere ist glatt, nur am Ende oder am
Ursprünge der Saugadern, am freien Rande der Spiralklappe, wird sie durch Vorsprünge,
welche die verschiedenen Blasen, Zellen oder Säcke unvollkommen von einander scheiden, in
diese Abtheilungen getrennt. Die äussere dagegen ist weniger dicht und bei den Saugadern
mit einer lockern zellstoflähnlicheu Masse bedeckt, welche diese mit den übrigen Gebilden,
die in die Structur der Schleimhaut eingehen, verbindet. Die Saugadern endigen sich hier
blind, als geschlossene Kanälchen oder Säcke und verhalten sich, hinsichtlich ihrer zwei
Flächen, auf eine ähnliche Weise, wie die serösen Häute, an denen man gleichfalls eine
innere glatte und eine äussere zellstoflähnliche Fläche unterscheidet, mit der sie sich au die
Organe die sie umkleiden, anlegen Freie Mündungen der -Saugadern, wie man diese anzunehmen
geneigt war, und wie sie vielleicht manche noch annehmen möchten, existiren
hier nicht. Auch bei wiederholten sehr vollständigen Injectionen dieser Gefafse, sah ich
nie, wenn nicht Zerreifsung erfolgt war, ein einziges Quecksilberkügelchen aus diesem
Saugadernetze ausfliefsen. Die Bestand theile, welche die Gefäfse dieses Netzes aus der Darra-
höhle und .selbst aus dem Parenchym des Darms aufnehmen, berühren zunächst deren äussere
zellstoffahnliche Fläche, welche die Substanzen anziehen und zur dichtem Saugaderwand führen
mufs, bevor solche durch die Wandungen in die Höhle dieser Gefafse geleitet werden können.
m.
Darmstück mit seinem Gekröse vom Welse, an welchem Verbindungen von Saugaderzweigen
mit Zweigen der Gekrösvenen dargestellt sind.
1 Gekrösarterie.
2 Gekrösvenen.
3 Saugadernetz des Darms.
4 Erweiterungen der Saugadern an der Stelle, wo sie vom Darme ins Gekröse
abgehen.
5 Saugadern, welche die Blutgefäfse umstricken.
6 Kleine Saugaderzweige, welche sich in
7 kleine Venenzweige einmünden.
IV.
Darmstück mit seinem Gekröse aus demselben Thiere wie das vorhergehende, an
welchem die Venen nicht dem Laufe der Arterien folgen, und gezeigt wird, wie vollständig
die Saugadern den Darm und die Blutgefäfse umstricken.
1 Arterie.
2 Vene, längs dem Darm verlaufend.
3 Saugadernetz des Darms.
4 Erweiterungen dieser Gefafse, wo sie den Darm verlassen und in die
5 Saugadern sich fortsetzen, welche die Gekrösarterien eben so genau umstricken,
als sie die Venen umfassen.
Die Saugadern der Verdauungswerkzeuge des Welses sind an verschiedenen Gegenden
derselben von verschiedener Gröfse, da sie auf dem Darme sowohl wie zwischen ihm
und dem Gekröse Erweiterungen, Blasen und Säcke bilden, welche die, in der Abbildung
dargcstellten, um vieles an Umfang übertreffen.
Der Zusammenhang der Saugadern mit den Venen im Gekröse dieses Thieres
ist sehr zahlreich. Injicirt man die Saugadern eines Darmstückes mit seinem Gekröse mit
Quecksilber und hindert man das Weiterschreiten dieser Flüssigkeit, so dafs die kleineren
Zweige davon angefüllt werden, so sieht man dieses, an verschiedenen Stellen, in kleine
Venenzweige überströmen.
A c h t e T a f e l .
Sie zeigt die Anordnung der Saugadern im Darmkanale des Seewolfs (jinarrhichas
Lupus).
I.
Umgestülptes Darmstück, an welchem das innere Saugadernetz und die letzte
Auflösung der Saugadern in den zarten Darmklappen dargestellt ist.
1 Darmklappen in Conturzeichnnng.
2 Zwischen diesen liegende Felder, innere Darmfläche.
3 Inneres Saugadernetz (Rete in te rn u n iwelches die Saugadern der Darmklappe
aufnimmt und in das äussere übergeht.
4 Saugadern der Darmklappen, welche sich gegen den freien Rand der Klappe
büschelförmig auflösen und in die Darmzotten, welche bisweilen von den Klappen abgehen,
sich fortsetzen.
5 Stämmchen, durch welche die Saugadern der Darmklappe mit dem innern
Saugadernetze zusammendiefsen.
II.
Darmslück mit seinem Gekröse, an welchem das äussere Saugadernetz gezeigt wird.
l Arterie.
*) Die Eingeweide des Welses habe ich im ganz frischen Zustande auf dem zoologischen Laboratorium
zu Leiden aus einem Thiere untersucht, welches für die dortige Sammlung angekauft wurde.
Der Wels ist, wegen sein'es grofsen und fettlosen Gekröses, wie oben schon angeführt, ganz besonders
zu Untersuchungen .über die verschiedenen Gefäfsverbindungen geeignet. Sehr deutli'eh zeigt sich hier der unmittelbare
Uebergang der Arterien in die Venen. Treibt man feine Injectiousmasse, aus Terpentingeist und Zinnober,
in die Arterien, so geht sie, sobald diese nur mäfsig angefüllt sind, bei dem leisesten Drucke der Spritze, in die
Venen über. Man erkennt mit blofsem Auge viele feine und selbst auch gröfsere Zweige die sich limbicgen, als
Venenanfänge fortsetzen und zu Reisern, Zweigen und Aesten zusammenlreten.