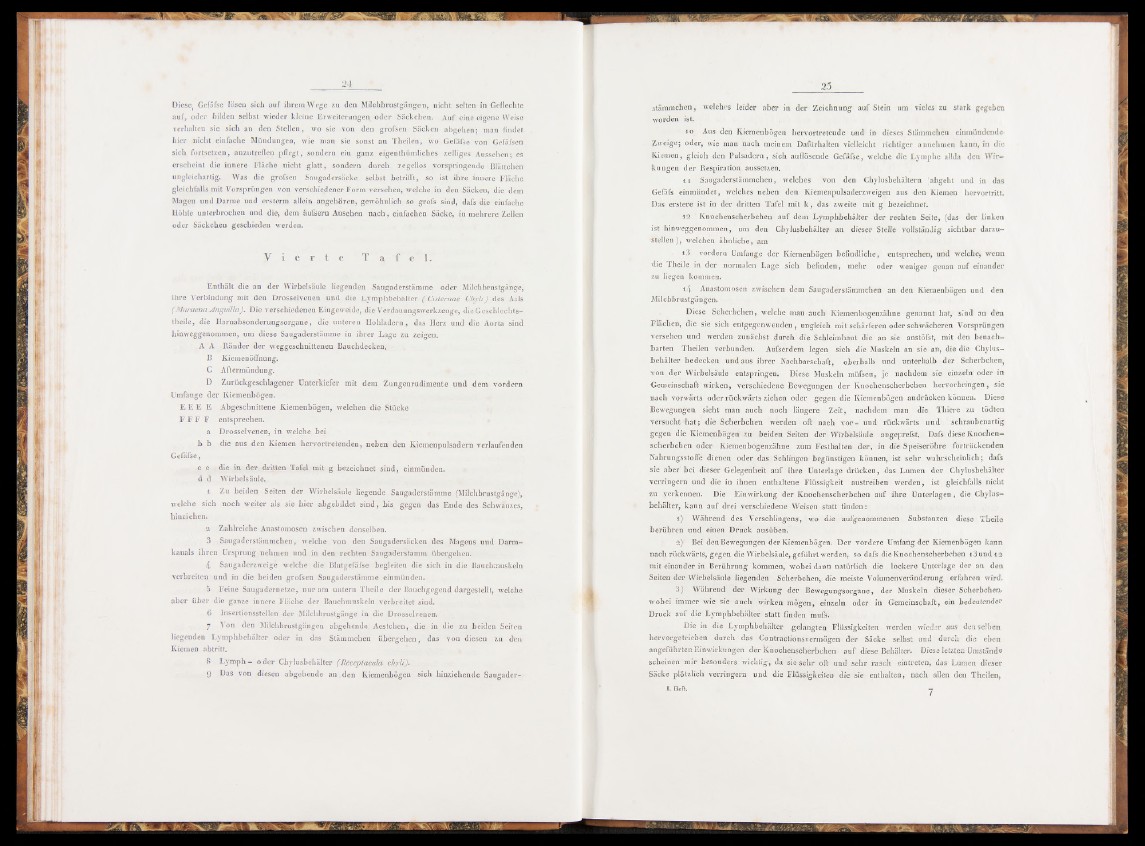
Diesek Gefäfse lösen sich auf ihrem Wege zu den Milchhrustgängen, nicht selten in Geflechte
auf, oder bilden selbst wieder kleine Erweiterungen oder Säckchen. Auf eine eigene Weise
verhalten sie sich an den Stellen, wo sie von den grofsen Säcken abgehen: man findet
hier nicht einfache Mündungen, wie man sie sonst an Theilen, wo Gefäfse von Gefäfsen
sich fortsetzen, anzutreffen pflegt, sondern ein ganz eigentümliches zelliges Aussehen* es
erscheint die innere Fläche nicht glatt, sondern durch regellos vorspringende Blättchen
ungleichartig. Was die grofsen Saugadersäcke selbst betrifft, so ist ihre innere Fläche
gleichfalls mit Vorsprüngen von verschiedener Form versehen, welche in den Säcken, die dem
Magen und Darme und ersterm allein angehören, gewöhnlich so grofs sind, dafs die einfache
Höhle unterbrochen und die, dem äufsern Ansehen nach, einfachen Säcke, in mehrere Zellen
oder Säckchen geschieden werden.
y i
Enthält die an der Wirbelsäule liegenden Saugaderstämme oder Milchbrustgänge,
ihre Verbindung mit den Drosselvenen und die Lymphbehälter ( Cisternae Chyli) des Aals
(Murciena Anguilla). Die verschiedenen Eingeweide, die Verdauungswerkzeuge, die Geschlechtste
ile , die Harnabsonderungsorgane, die unteren Hohladern, das Herz und die Aorta sind
hinweggenommen, um diese Saugaderslämme in ihrer Lage zu zeigen.
A A Ränder der weggeschnittenen Bauchdecken.
B Kiemenöffhüng.
C Aftermündung.
D Zurückgeschlagener Unterkiefer mit dem Zungenrudimente und dem vordern
Umfange der Kiemenbögen.
E E E E Abgeschnittene Kiemenbögen, welchen die Stücke
F F F F entsprechen.
a Drosselvenen, in welche bei
b b die aus den Kiemen hervortretenden, neben den Kiemenpulsadern verlaufenden
Gefäfse,
c c die in der dritten Tafel mit g bezeichnet sind, einmünden.
d d Wirbelsäule.
1 Zu beiden Seiten der Wirbelsäule liegende Saugaderstämme (Milchbrustgänge),
welche sich noch weiter als sie hier abgebildet sind, bis gegen das Ende des Schwanzes,
hinziehen.
2 Zahlreiche Anastomosen zwischen denselben.
3 Saugaderstämmchen, welche von den Saugadersäcken des Magens und Darmkanals
ihren Ursprung nehmen und in den rechten Saugaderstamm übergehen.
4 Saugaderzweige welche die Blutgefäfse begleiten die sich in die Bauchmuskeln
verbreiten und in die beiden grofsen Saugaderstämme einmünden.
5 Feine Saugadernetze, nur am untern Theile der Bauchgegend dargestellt, welche
aber über die ganze innere Fläche der Bauchmuskeln verbreitet sind.
6 Insertionsstellen der Milchbrustgänge in die Drosselvenen.
7 Von den Milchbrustgängen abgehende Acstchen, die in die zu beiden Seiten
liegenden Lymphbehälter oder in das Stämmclien übergehen, das von diesen zu d'en
Kiemen abtritt.
8 Lymph- oder Chylusbehälter (Receptacula chyli).
9 Das von diesen abgehende an den Kiemenbögen sich hinziehende Saugaderr
n t t r m
stämmchen, welches leider aber in der Zeichnung auf Stein um vieles zu stark gegeben
worden ist.
io Aus den Kiemenbögen hervortretende und in dieses Stämmchen einmündende-
Zweige; oder, wie man nach meinem Dafürhalten vielleicht richtiger annehmen kann, in die
Kiemen, gleich den Pulsadern, sich auflösende Gefäfse, welche die Lymphe allda den Wirkungen
der Respiration aussetzen.
n Saugaderstämmchen, welches von den Cbylusbehältern | abgeht und in das
Gefäfs einmündet, welches neben den Kiemenpulsaderzweigen aus den Kiemen hervortritt.
Das erstere ist in der dritten Tafel mit k , das zweite mit g bezeichnet.
12 ' Knochenscherbchen auf dem Lymphbehälter der rechten Seite, (das der linken
ist hinweggenommen, um den Chylusbehälter an dieser Stelle vollständig sichtbar darzustellen
}, welchen ähnliche, am
13 vordern Umfange der Kiemenbögen befindliche, entsprechen, und welche, wenn
die Theile in der normalen Lage sieh befinden, mehr oder weniger genau auf einander
zu liegen kommen,-
14 Anastomosen zwischen dem Saugaderstämmchen an den Kiemenbögen und den
Milchbrustgängen.
Diese Scherbchen, welche man auch Kiemenbogenzähne genannt hat, sind an den
Flächen, die sie sich entgegenwenden, ungleich mit schärferen oder schwächeren Vorsprüngen
versehen und werden zunächst durch die Schleimhaut die an sie anstöfst, mit den benachbarten
Theilen verbunden. Aüfserdem legen sich die Muskeln an sie an, die die Chylusbehälter
bedecken und aus ihrer Nachbarschaft, oberhalb und unterhalb der Scherbchen,
von der Wirbelsäule entspringen. Diese Muskeln müfsen, je nachdem sie einzeln oder in
Gemeinschaft wirken, verschiedene Bewegungen der Knochenscherbchen hervorbringen, sie
nach vorwärts oder rückwärts ziehen oder gegen die Kiemenbögen andrücken können. Diese
Bewegungen sieht man auch noch längere Zeit, nachdem man die Thiere z.u tödten
versucht hat; die Scherbchen werden oft nach vor-r und rückwärts und schraubenartig
gegen die Kiemenbögen zu beiden Seiten der Wirbelsäule angeprefst. Dafs diese Knochen—
scherbchen oder Kiemenbögenzähne zum Festhalten der, in die Speiseröhre fortrückenden
Nahrungsstoffe dienen oder das Schlingen begünstigen können, ist sehr wahrscheinlich; dafs
Sre aber bei dieser Gelegenheit auf ihre Unterlage drücken, das Lumen der Chylusbehälter
verringern und die in ihnen enthaltene Flüssigkeit austreiben werden, ist gleichfalls nicht
zu verkennen. Die Einwirkung der Knochenscherbchen auf ihre Unterlagen, die Chylusbehälter,
kann auf drei verschiedeue Weisen statt finden:
1) Während des Verschlingens, wo die aufgenommenen Substanzen diese Theile
berühren und einen Druck ausüben.
2) ^ Bei den Bewegungen der Kiemenbögen. Der vordere Umfang der Kiemenbögen kann
nach rückwärts, gegen die Wirbelsäule, geführt werden, so dafs die Knochenscherbchen i 3 und 13
mit einander in Berührung kommen, wobei dann natürlich die lockere Unterlage der an den
Seiten der Wirbelsäule liegenden Scherbchen, die meiste Volumenveränderung erfahren wird.
3 ) Während der Wirkung der Bewegungsorgane, der Muskeln dieser Scherbchen,
wobei immer wie sie auch wirken mögen, einzeln oder in Gemeinschaft, ein bedeutender
Druck auf die Lymphbehälter statt finden mufs.
Die in die Lymphbehälter gelangten Flüssigkeiten werden wieder aus denselben
hervorgetrieben durch das Co ntractio ns vermögen der Säcke selbst und durch die eben
angeführten Einwirkungen der Knochenscherbchen auf diese Behälter. Diese letzten Umstände
scheinen mir besonders wichtig, da sie sehr oft und sehr rasch eintreteD, das Lumen dieser
Säcke plötzlich verringern und die Flüssigkeiten die sie enthalten, nach allen den Theilen,
7 I. Heft.