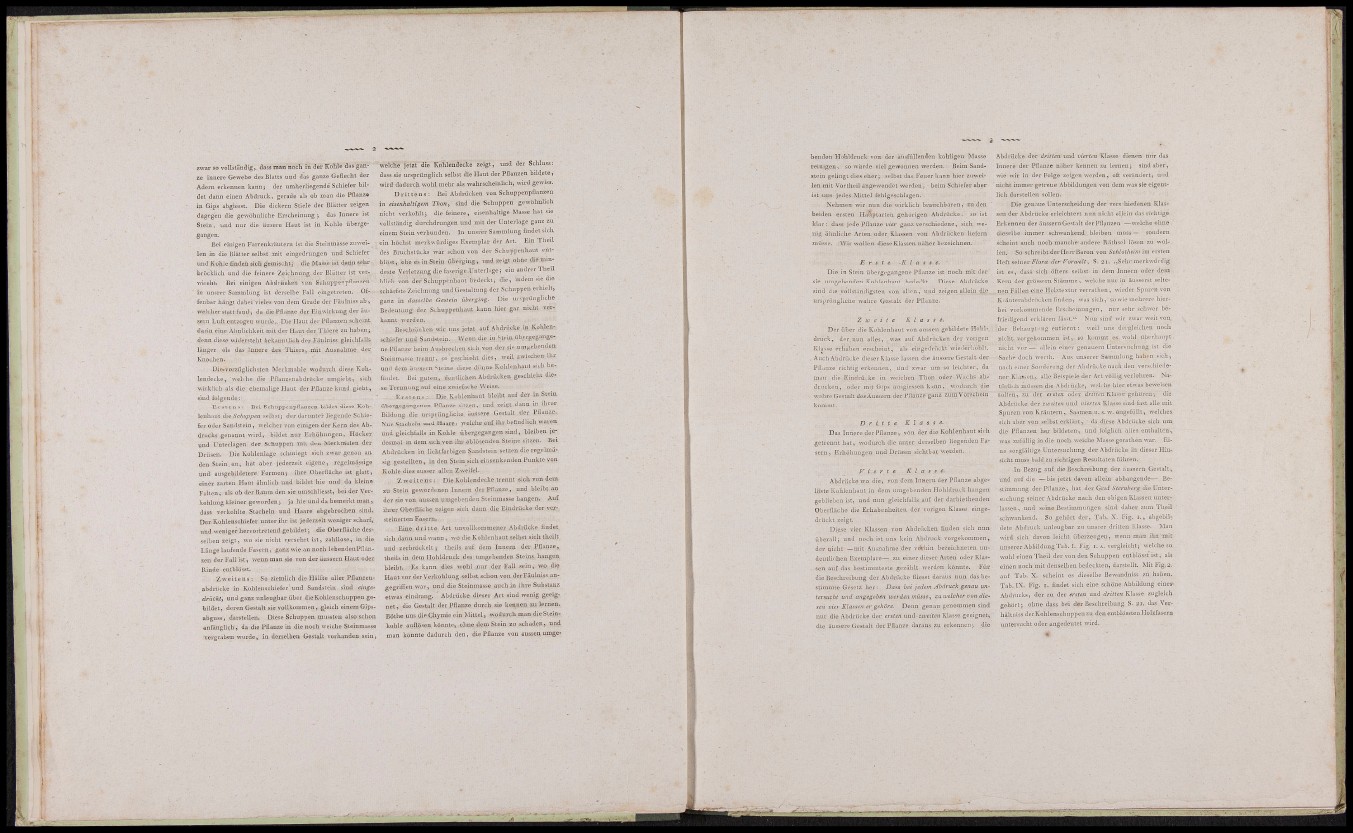
zwar so vollslandig, dass man noch in der Kohle das ganze
innere Gewebe des Blatts und das ganze Geflecht der
Adern erkennen kann 5 der umherliegende Schiefer bildet
dann einen Abdruck, gerade als ob man die Pflanz®
in Gips abgiesst. Die dickem Stiele der Blätter zeigen
dagegen die gewöhnliche Erscheinung j das Innere ist
Stein, und nur die äusere Haut ist in Kohle übergegangen.
Bei einigen FarrenkräuLern ist die Steinmasse zuweilen
in die Blätter selbst mit eingedrungen und Schiefer
und Kohle finden sich gemischt) die JMasse ist dann sehr
bröcklich und die feinere Zeichnung der Blätter ist verwischt.
Bei einigen Abdrücken von Schuppenpflanzen
in unsrer Sammlung ist derselbe Fall eingetreten. Offenbar
hängt dabei vieles von dem Grade der Fäiilniss ab,
weither statt fand, da die Pflanze der Einwirkung der äusein
Luft entzogen wurde... Die Haut der Pflanzen scheint
darin eine Ähnlichkeit mit der fhiut der Thiere zu haben 5
denn diese widersteht bekannilich der Fänlniss gleiLhfalls
länger als das Innere des Thiers, mit Ausnahme der
Knochcn.
Die»-vorzüglichsten Merkmahle wodurch diese Kohlendecke,
'wel-he die Pflanzenabdrücke umgiebt, sich
•wirklich als die ehemalige IJ^jut der Pflanze kund giebt,
sind folgende:
E r s t e n - s : Bei Schuppenpfl.anzen bildet diese Koh- "
leuhaut die Schuppen selbst; der durunter liegende Schiefer
oder Sandstein, welcher von einigen der Kern des Abdrucks
genannt wird., bildet nur Erhöhungen, Höcker
und Unterlagen der Schuppen mli den Merkmalen der
Drüsen. Die Kohlenlage schmiegt sich zwar genau au
den Stein.an, hat aber jederzeit eigene, regelmässige
und ausgebildetere Formen-, ihre Oberfläche ist glatt,
einer zarten Hain ähnlich und bildet hie und da kleine
Fallen, als ob der Raum den sie umschhesst, bei der Verkohlung
kleiner geworden 3 ja hie imd da bemerkt man,
dass verkühlte Stacheln und Haare abgebrochen sind.
Der Kohlenschiefer unter ihr ist jederzeit weniger scharf,
und weniger hervortretend gebildet^ die Oberfläche desselben
zeigt, wo sie nicht versehrt ist, zahllose, in die
Länge laufende Fasern, ganz wie an noch lebenden Pflanzen
der Fall ist, wenn man sie von der äussern Haut oder
Rinde entblösst.
Z w e i t e n s : So ziemlich die Hälfte aller Pflanzenabdrücke
in Kohlenschiei'er und Sandstein sind eingedrückt^
und ganz unleugbar über die Kohlenschuppen gebildet,
deren Gestalt sie vol lkommen, gleich einem Gipsabguss,
darstellen. Diese Schuppen mussten also schon
anfänglich, da die Pflanze in die noch weiche Steinmasse
vergraben wurde, in derselben Gestalt vorhanden sein,
welche jetzt die Kohlendecke zeigt, und der Schluss:
dass sie ursprünglich selbst die Haut der Pflanzen bildete»
wird dadurch wohl mehr als wahrscheinlich, wird gewiss.
D r i t t e n s : Bei Abdrücken von Schuppenpflanzen
in eisenhaltigem Thon^ sind die Schuppen gewöhnlich
nicht verkohltj die feinere, eisenhaltige Masse hat sie
vollständig durchdrungen und mit der Unterlage ganz zu
einem Stein verbunden. In unsrer Sammlung findet sich
ein höchst merkwürdiges Exemplar der Art. Ein Tlieil
des Bruchstücks war schon von der Schuppenhnut entblöst,
ehe es in Stein überging, und zeigt ohne die mindeste
Verletzung die faserige Unterlage ; ein andrer Tbeil
blieb von der Schupprnhaut bedeckt, die, indem sie die
schärfste Zeichnimg imdGestaltung der Schuppen erhielt,
ganz in dasselbe Gestein überging. Die ur-^prüngliche
Bedeutung der Schuppenhaut kann liier gar nicht verkannt
werden.
Beschränlcen wir nns jetzt auf Abdriicke in Kohlenschiefer
und Sandstein. Wenn die in Stein Übrrgegongene
Pflanze beim Ausbrechen sich von der sie umgebenden
Steinmasse trennt, so geschieht dies, weil zwischen ihr
und dem äussern «Steine diese dünne Kohlenhaut sich befindet.
Bei guten, deutlichen Abdrücken geschieht die-
-se Trennung auf eine zwiefache Weise.
E r s t e n s : Die Kohlenhaut bleibt auf der in Stein
übergegangenen Pflanze sitzen, und zeigt dann in flirer
Bildung die ursprüngliche äussere Gestalt der Pflanze.
Nur SiaclioJii uua Haare, weiche auf ihr befindlich waren
und gleichfalls in Kohle übergegangen sind, bleiben jedesmal
m dem sich von iln- ablösenden Steine sitzen. Bei
Abdrücken In hcbtfarbigen Sandstein setzen die regelmäsig
gestellten, in den Stein sich einsenkenden Punkte von
Kohle dies ausser allen Zweifel.
Z w e i t e n s : Die Kohlcndecke trennt sich von dem
zu Stein gewordenen Innern der Pflanze, und bleibt an
der sie von aussen umgebenden Steinmasse hangen. Auf
ihrer Oberfläche zeigen sich dann die Eindrücke der verstein.
erten Fasern.
Eine dritte Art unvollkommener Abdrücke findet
sich dann und wann, wo die Kohlenhaut selbst sich theilt
und zerbröckelt 5 theils auf dem Innern der Pflanze,,
theils in dem Hohldruck des umgebenden Steins hangen
bleibt. Es kann dies wohl nur der Fall sein, wo die
Haut vor der Verkohlung selbst schon von derFüulniss angegriffen
war, und die Steinmasse auch in ihre Substanz
etwas eindrang. Abdrücke dieser Art sind wenig geeignet,
die Gestalt der Pflanze durch sie kennen zu lernen.
Böthe uns die Chymi e ein Mittel, wodurch man dieSteinkohle
auflösen könnte, ohne dem Stein zu schaden, und
man könnte dadurch den, die Pflanze von aussen umgebenden
Hohldruck von der ausfüllenden kohligen Masse
reinigen, so würde viel gewonnen werden. Beim Sandstein
gelingt dies eher; selbst das Feuer kann hier zuweilen
mit Vortheil angewendet werden, beim Schiefer aber
ist uns jedes Mittel fehlgeschlagen.
Nehmen wir nun die wirklich brauchbaren, zu den
beiden ersten Hduptarten gehörigen Abdrücke, so ist
klar: dass jede Pflanze fier ganz verschiedene, sich wenig
ähnliche Arten oder Klassen von Abdrücken hefern
müsse. Wir wollen diese Klassen näher bezeichnen.
E r s t e -Klasse.'
Die in Stein übergegangene Pflanze ist noch mit der
sie umgebenden Kohlenhaut bedecîit. Diei:e Abdiücke
sind die vollständigsten von allen, und zeigen allein die
ursprüngliche wahre Qesialt der Pflanze.
Z w e i t e Klasse.
Der über die Kohienhaut von aussen gebildete Ilohldruck,
der nun alles, .was auf Abdrücken der vorigen
Kla=;se erhaben erscheint, als eingedrückt wiederhohll.
. AuchAbdrücke dieserKIasse lassen die äussere Gestalt der
Pflanze richtig erkennen, und zwar um so leichler, da
man die Eindrücke in weichen Thon oder \"\'achs abdrucken,
oder mit Gips ausgiessen kann, wodurch die
wahre Gestalt desÄussern der l'fianze ganz zum Vorschein
kommt.
D r i t t e Klasse.
Das Innere der Pf lanze, von der die Kohlenhaut sich
getrennt hat, wodiu-ch die unter derselben hegenden Fasern,
Erhöhtmgen und Drüsen Sichtbarwerden.
F i e r t é Klasse.
Abdrücke wo die, von dem Innern der Pflanze abgelöste
Kohlenhaut in dem umgebenden Hohldruck hangen
gebheben ist, und nun gleichfalls auf der darbiethenden
Oberfläche die Erhabenheiten der vorigen Klasse eingedrückt
zeigt.
Diese vier Klassen von Abdrücken finden sich nun
überallj und noch ist uns kein Abdruck vorgekommen,
der nicht —mit Ausnahme "der vorhin bezeichneten undeutlichen
Exemplare— zu einer dieser Arten oder Klassen
auf das bestimmteste gezählt werden könnte. Für
die Beschreibung der Abdrücke fliesst daraus nun das bestimmte
Gesetz her: Dass hei jedem Abdruck genau untersucht
und angegeben werden müssezu welcher von diesen
vier Klassen er gehöre. Denn genau genommen sind
nur die Abdrücke der ersten und zweiten Klasse geeignet,
die äussere Gestalt der Pflanze daraus zu erkennen^ die
Abdrücke der dritten und vierten Klasse dienen nur das
Innere der Pflanze näher kennen zu lernenj sind aber,
wie wir in der Folge zeigen werden, oft verändert, und
" nicht immer getreue Ablnldungen von dem was sie eigentlich
darstellen sollen.
Die genaue Ünlerscheidung der verschiedenen Klassen
der Abdrücke erleichtert nun nicht allein das richtige
Erkennen der äussern Gestalt derPfl^inzen —v/elche ohne
dieselbe immer schwankend bleiben muss — sondern
scheint auch noch manche andere Räthsel lösen zu wollen.
So schreibt der Herr Baron von Schlotheim im ersten
Heft seiner Mora der Vorwüt, S. 2x. „Sehr merkwürdig
ist e.s, dass sich öfters selbst in dem Innern oder dem
Kern der grössern Stämme, welche nur in äusserst seltenen
Fällen-eine Hulztextur verrathen, wieder Spuren von
Kl äuterabdrücken flnden, was s i c h s o wie mehrere hierbei
vorkommende Erscheinungen, nur sehr schwer befriedigend
erklären lässt." Nun sind wir zwar weit von
der Behauptung entfernt: weil uns dergleichen noch
nicht vorgekommen ist, so kommt es wohl überhaupt,
n i c h t ' v r , r— allein einer genauem Unter'^uchung ist die
Sache doch werlh. Aus unserer Sammlung haben sich,
nach einer Sotiderimg der Abdrücke nach den verschiedener
Klassen, alle Beispiele der Art völlig verlohren. Natürlich
müssen die Abdrücke, weh he hier etwas beweisen
sollen, zu der ersten oder cZriVre/z Kiasse gehören ; die
Abdrücke der zweiten und vierten Klasse sind fast alle mit
Spuren von Kräutern, Saamen u. s. w. angefüllt, welches
sich aber von selbst erklärt, da diese Abdrücke sich um
die Pflanzen hox bildeten, und folghch alles enthalten,
was zufällig in die noch weiche Masse gerathen war. Eine
sorgfältige Untersuchung der Abdrücke in dieser Hinsicht
muss bald zu richtigen Resultaten führen.
In Bezug auf die Beschreibung der äussern Gestalt,
rnicl auf die —bis jetzt davon allein abhängende— Bestimmung
der Pl lanze, hat der Graf Stcrnhcrg die Untersuchung
seiner Abdrücke nach den obigen Klassen unterlassen,
und seine Bestimmungen sind daher zum Theil
schwankend. So gehört der, Tab. X. Fig. i,, abgebiU
"dete Abdruck tmleugbar zu unsrer dritten Klasse. Man
wird sich davon leicht überzeugen, wenn man ihn mit
unserer Abbi ldungTab. l. Fig. i. A. vergleicht^ welche so
wohl einen Theil der von den Schuppen entblösst ist, als
einen noch mit denselben bedeckten, darstellt. Mit Fig. 2.
auf Tab. X. scheint es dieselbe Bevvandniss zu haben.
Tab. IX. Fig. I. findet sich eine schöne Abbildung eines
Abdrucks, der zu der ersten und dritten Y^Xasse zugleich
gehört; ohne dass bei der Beschreibung S. 21. das Verhältüiss
der Kohlenschuppen zu den entblössten Holzfasern
untersucht oder angedeutet wird.