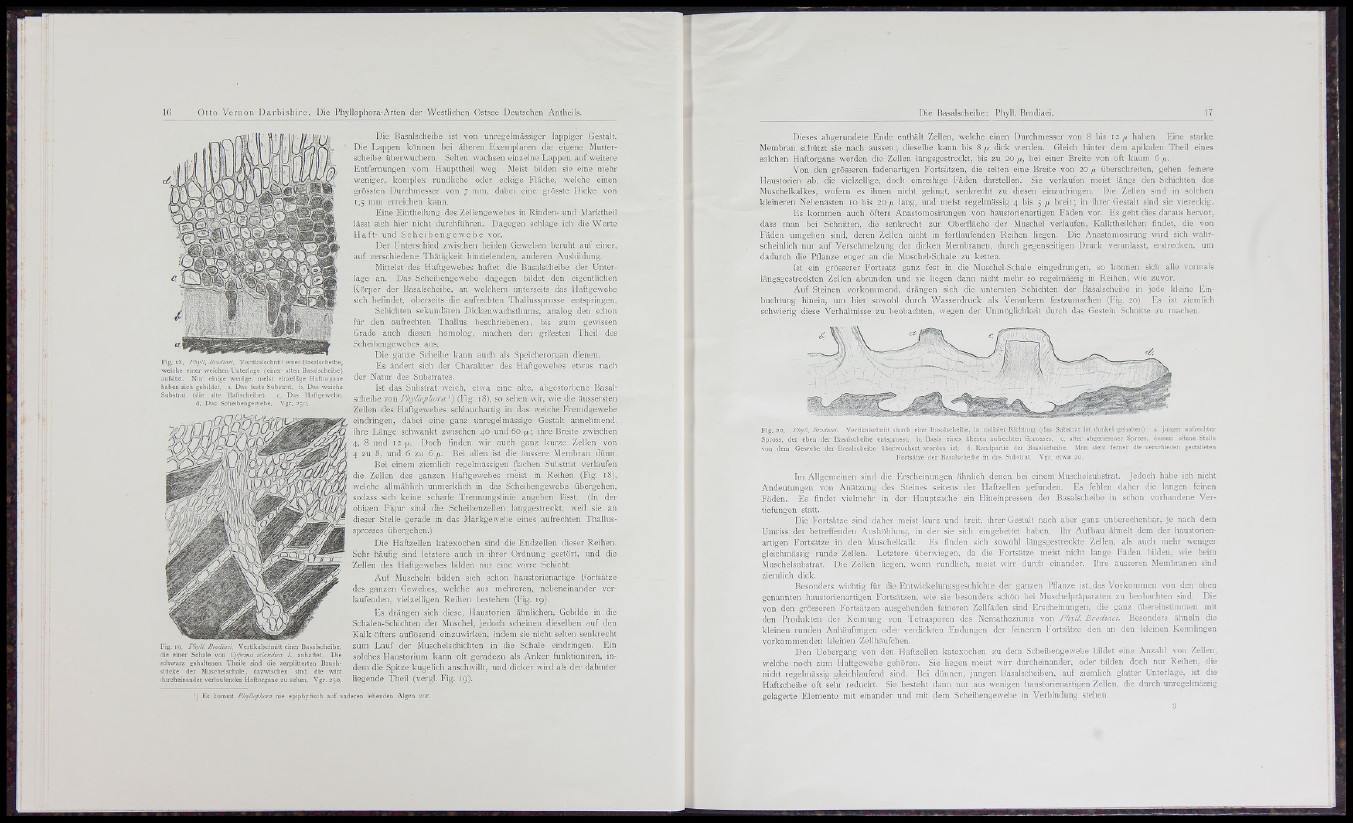
Fig. i8. Phyll. Brodiaei. Veililcalsclinüt einer Basaischeibe,
welche einer weichen 'Unterlage (einer alten Basalscheibe)
aufsitzt. Nur einige wenige, meist einzellige Haftorgane
haben sich gebildet, a. Das feste Siibslrat. b. Das weiche
Substrat (die alte Haftscheibe). c. Das liaftgewebe.
d. Das Scheibengewebe. Vgr. 230.
Phyll. Brodiaei. Vertikalsclinitt einer Basalscheibe,
die einer Schale von Cyprina islandka L. anhaitet. Die
schwarz gehaltenen Theile sind die zerplitterten Bruchstücke
der Muschelschale, dazwischen sind die wirr
diu-cheinander verlaufenden Haflorgane zu sehen. Vgr. 250,
Die Basalscheibe ist von unregehnässiger lappiger Gestalt.
Die Lappen können bei älteren Exemplaren die eigene Mutterscheibe
überwuchern. Selten wachsen einzelne Lappen auf weitere
Entfernungen vom Haupttheil weg. Meist bilden sie eine mehr
weniger, komplex rundliche oder eckige Fläche, welche einen
grössten Durchmesser von 7 nun, dabei eine grösste Dicke von
1,5 mm erreichen kann.
Eine Eintheihmg des Zellengewebes in Rinden- und Marktheil
lässt sich hier nicht durchführen. Dagegen schlage ich die Worte
H a ft- und S c h e ib e n g e w e b e vor.
Der Unterschied zwischen beiden Geweben beruht auf einer,
auf verschiedene Thätigkeit hinzielenden, anderen Ausbildung.
Mittelst des Haftgewebes haftet die Basalscheibe der Unterlage
an. Das Scheibengewebe dagegen bildet den eigentlichen
Körper der Basaischeibe, an welchem unterseits das liaftgewebe
sich befindet, oberseits die aufrechten Thallussprosse entspringen.
Schichten sekundären Dickenwachsthums, analog den schon
für den aufrechten Thailus beschriebenen, bis zum gewissen
Grade auch diesen homolog, machen den grössten Theil des
Scheibengewebes aus.
Die ganze Scheibe kann auch als Speicherorgan dienen.
Es ändert sich der Charakter des Haftgewebes etwas nach
der Natur des Substrates.
ist das Substrat weich, etwa eine alte, abgestorbene Basaischeibe
von Phyllophora *) (Eig. 18), so sehen wir, wie die äussersten
Zeilen des Haftgewebes schlauchartig in das weiche Eremdgewebe
eindringen, dabei eine ganz unregelmässige Gestalt annehmend.
Ihre Länge schwankt zwischen 40 und 60 p \ ihre Breite zwischen
4, 8 und 12 p . Doch finden wir auch ganz kurze Zellen von
4 zu 8, und 6 zu 6 /i. Bei allen ist die äussere Membran dünn.
Bei einem ziemlich regelmässigen flachen Sulistrat verlaufen
die Zellen des ganzen Haftgewebes meist in Reihen (Fig. 18),
welche allmählich unmerklich in das Scheibengewebe übergehen,
sodass sich keine scharfe Trennungslinie angeben lässt. (In der
obigen Figur sind die Scheibenzellen langgestreckt, weil sie an
dieser Stelle gerade in das xMarkgewebe eines aufrechten Thallussprosses
übergehen.)
Die Haftzellen katexochen sind die Endzeilen dieser Reihen.
Sehr häufig sind letztere auch in ihrer Ordnung gestört, und die
Zellen des Haftgewebes bilden nur eine wirre Schicht.
Auf Muscheln bilden sich schon haustorienartige Fortsätze
des ganzen Gewebes, welche aus mehreren, nebeneinander verlaufenden,
vielzelligen Reihen bestehen (Fig. 19).
Es drängen sich diese, Haustorien ähnlichen, Gebilde in die
Schalen-Schichten der Muschel, jedoch scheinen dieselben auf den
Kalk öfters auflösend einzuwirken, indem sie nicht selten senkrecht
zum Lauf der xMuschelschichten in die Schale eindringen. Ein
solches Haustorium kann oft geradezu als Anker funklioniren, indem
die Spitze kugelich anschwillt, und dicker wird als der dahinter
liegende Theil (vergl. Fig. 19).
') Es kommt Phyllophora nie epiphytisch tiiif anderen lebenden Algen
Dieses abgerundete Ende enthält Zeilen, welche einen Durchmesser von 8 bis i2 / i haben. Eine starke
Membran schützt sie nach aussen; dieselbe kann bis 8 p dick werden. Gleich liinter dem apikalen Theii eines
solchen Haftorgans werden die Zellen längsgestreckt, bis zu 20 p, bei einer Breite von oft kaum 6 p.
Von den grösseren fadenartigen Fortsätzen, die selten eine I5reite von 20 p überschreiten, gehen feinere
Haustorien al), die vielzellige, doch einreihige Fäden darstellen. Sie verlaufen meist längs den Schichten des
Muschelkalkes, wofern es ihnen nicht gelingt, senkrecht zu diesen einzudringen. Die Zellen sind in solchen
kleineren Nel)enästen 10 bis 20 p lang, und meist regelmässig 4 bis 5 /t breit; in ihrer Gestalt sind sie viereckig.
Es kommen auch öfters Anastomosirungen von haustorienartigen Fäden vor. Es geht dies daraus hervor,
dass man bei Schnitten, die senkrecht zur Oberfläche der xMuschel verlaufen, Kalktheilchen findet, die von
P'äden umgeben sind, deren Zellen nicht in fortlaufenden Reihen liegen. Die Anastomosirung wird sich wahrscheinlich
nur auf Verschmelzung der dicken Membranen, durch gegenseitigen Druck veranlasst, erstrecken, um
dadurch die Pflanze enger an die Muschel-Schale zu ketten.
Ist ein grösserer Fortsatz ganz fest in die Muschel-Schale eingedrungen, so können sich alle vormals
längsgestreckten Zellen abrunden und sie liegen dann nicht mehr so regelmässig in Reihen, wie zuvor.
Auf Steinen vorkommend, drängen sich die untersten Schichten der Basaischeibe in jede kleine Einbuchtung
hinein, um hier sowohl durch Wasserdruck als Verankern festzumachen (Fig. 20). Es ist ziemlich
schwierig diese Verhältnisse zu beobachten, wegen der Unmöglichkeit durch das Gestein Schnitte zu machen.
Fig. 20. Phyll. Brodiaei. Vertikalsclinitt durch eine Basaischeibe, in radialer Richtung (das Substrat ist dunkel gehalten;, a. junger aufrechter
Spross, der eben der Basaischeibe eiitsprosst, b, Basis eines älteren aufrechten Sprosses, c. alter abgerissener Spross, dessen offene Stelle
von dem Gewebe der Basaischeibe überwuchert worden ist. d, Randpartie der Basaischeibe. Man sieht ferner die verschieden gestalteten
Fortsätze der Basaischeibe in das Substrat. Vgr. etwa 20.
Im Allgemeinen sind die Erscheinungen ähnlich denen bei einem Muschelsubstrat, jedoch habe ich nicht
Andeutungen von Anätzung des Steines seitens der Haftzellen gefunden. Es fehlen daher die langen feinen
Fäden. Es findet vielmehr in der Hauptsache ein liineinpressen der Basaischeibe in schon vorhandene Vertiefungen
statt.
Die Fortsätze sind daher meist kurz und breit, ihrer Gestalt nach aber ganz unberechenbar, je nach dem
Umriss der betreffenden Aushöhlung, in der sie sich eingebettet haben. Ihr Aufbau ähnelt dem der haustorienartigen
Fortsätze in den Muschelkalk. Es finden sich sowohl längsgestreckte Zellen, als auch mehr weniger
gleichmässig runde Zellen. Letztere überwiegen, da die Fortsätze meist niclit lange Fäden bilden, wie beim
Muschelsubstrat, Die Zellen liegen, wenn rundlich, meist wirr durch einander. Ihre äusseren Membranen sind
ziemlich dick.
Besonders wichtig für die Entwickelungsgeschichte der ganzen Pflanze ist.,das Vorkommen von den oben
genannten haustorienartigen Fortsätzen, wie sie besonders schön bei Muschelpräparaten zu beobachten sind. Die
von den grösseren Fortsätzen ausgehenden feineren Zellfäden sind Erscheinungen, die ganz übereinstimmen mit
den Produkten der Keimung von Tetrasporen des Nematheziums von Phyll. Brodiaei. Besonders ähneln die
kleinen runden Anhäufungen oder verdickten Endungen der feineren Fortsätze den an den kleinen Keimlingen
vorkommenden kleinen Zellhäufchen.
Den Uebergang von den Haftzellen katexochen zu dem Scheibengewebe bildet eine Anzahl von Zellen,
welche noch zum Haftgewebe gehören. Sie liegen meist wirr durcheinander, oder bilden doch nur Reihen, die
nicht regelmässig gleichlaufend sind. Bei dünnen, jungen Basalscheiben, auf ziemlich glatter Unterlage, ist die
Haftscheibe oft sehr reducirt. Sie besteht dann nur aus wenigen haustorienartigen Zellen, die durch unregelmässig
gelagerte Elemente mit einander und mit dem Scheibengewebe in Verbindung stehen.