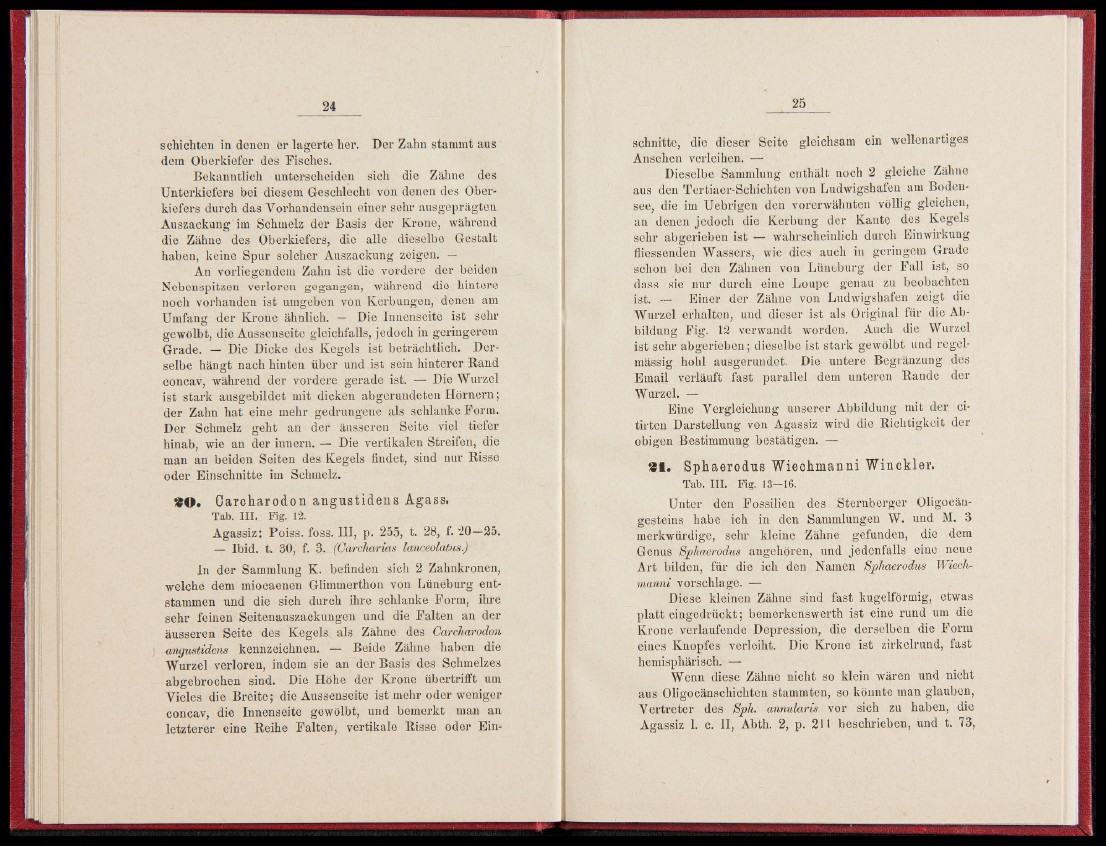
schichten in denen er lagerte her. Der Zahn stammt aus
dem Oberkiefer des Fisches.
Bekanntlich unterscheiden sich die Zähne des
Unterkiefers bei diesem Geschlecht von denen des Oberkiefers
durch das Vorhandensein einer sehr ausgeprägten
Auszackung im Schmelz der Basis der Krone, während
die Zähne des Oberkiefers, die alle dieselbe Gestalt
haben, keine Spur solcher Auszackung zeigen. —
An vorliegendem Zahn ist die vordere der beiden
Nebenspitzen verloren gegangen, während die hintere
noch vorhanden ist umgeben von Kerbungen, denen am
Umfang der Krone ähnlich. — Die Innenseite ist sehr
gewölbt, die Aussenseite gleichfalls, jedoch in geringerem
Grade. — Die Dicke des Kegels ist beträchtlich. Derselbe
hängt nach hinten über und ist sein hinterer Rand
concav, während der vordere gerade ist. — Die Wurzel
ist stark ausgebildet mit dicken abgerundeten Hörnern;
der Zahn hat eine mehr gedrungene als schlanke Form.
Der Schmelz geht an der äusseren Seite viel tiefer
hinab, wie an der innern. — Die vertikalen Streifen, die
man an beiden Seiten des Kegels findet, sind nur Risse
oder Einschnitte im Schmelz.
9 0 . Oarcharodon angustidens Agass.
Tab. i m Fig. 12.
Agassiz: Poiss. foss. III, p. 255, t. 28, f. “20—25.
— Ibid. t. 30, f. 3. (Garcharias lanceolatus.)
In der Sammlung K. befinden sich 2 Zahnkronen,
welche dem miocaenen Glimmerthon von Lüneburg entstammen
und die sich durch ihre schlanke Form, ihre
sehr feinen Seitenauszackungen und die Falten an der
äusseren Seite des Kegels, als Zähne des Oarcharodon
angustidens kennzeichnen. — Beide Zähne haben die
Wurzel verloren, indem sie an der Basis des Schmelzes
abgebrochen sind. Die Höhe der Krone übertrifft um
Vieles die Breite ; die Aussenseite ist mehr oder weniger
concav, die Innenseite gewölbt, und bemerkt man an
letzterer eine Reihe Falten, vertikale Risse oder Einschnitte,
die dieser Seite gleichsam ein wellenartiges
Ansehen verleihen. —
Dieselbe Sammlung enthält noch 2 gleiche Zähne
aus den Tertiaer-Schichten von Ludwigshafen am Bodensee,
die im Uebrigen den vorerwähnten völlig gleichen,
an denen jedoch die Kerbung der Kante des Kegels
sehr abgerieben ist — wahrscheinlich durch Einwirkung
fliessenden Wassers, wie dies auch in geringem Grade
schon bei den Zähnen von Lüneburg der Fall ist, so
dass sie nur durch eine Loupe genau zu beobachten
ist. — Einer der Zähne von Ludwigshafen zeigt die
Wurzel erhalten, und dieser ist als Original für die Abbildung
Fig. 12 verwandt worden. Auch die Wurzel
ist sehr abgerieben; dieselbe ist stark gewölbt und regelmässig
hohl ausgerundet. Die untere Begränzung des
Email verläuft fast parallel dem unteren Rande der
Wurzel. —
Eine Vergleichung unserer Abbildung mit der ci-
tirten Darstellung von Agassiz wird die Richtigkeit der
obigen Bestimmung bestätigen. —
31. Sphaerodus Wiechmanni Winckler.
Tab. III. Fig. 13—16.
Unter den Fossilien des Sternberger Oligocän-
gesteins habe ich in den Sammlungen W. und M. 3
merkwürdige, sehr kleine Zähne gefunden, die dem
Genus Sphaerodus angehören, und jedenfalls eine neue
Art bilden, für die ich den Namen Sphaerodus Wiechmanni
vorschlage. —
Diese kleinen Zähne sind fast kugelförmig, etwas
platt eingedrückt; bemerkenswerth ist eine rund um die
Krone verlaufende Depression, die derselben die Form
eines Knopfes verleiht. Die Krone ist zirkelrund, fast
hemisphärisch. —
Wenn diese Zähne nicht so klein wären und nicht
aus Oligocänschieilten stammten, so könnte man glauben,
Vertreter des Sph. annularis vor sich zu haben, die
Agassiz 1. c. II, Abth. 2, p. 211 beschrieben, und t. 73,