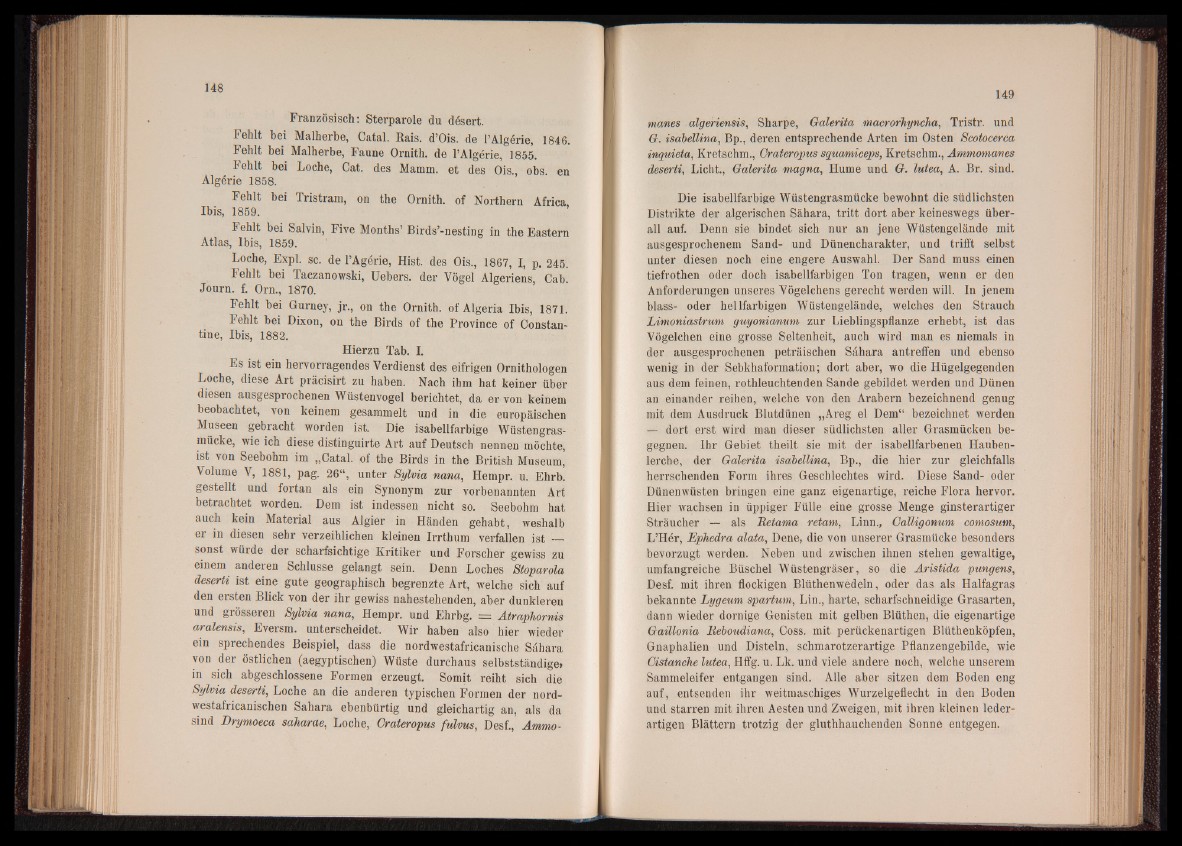
Französisch: Sterparole du désert.
Fehlt bei Malherbe, Catal. Rais. d’Ois. de l’Algérie, 1846.
Fehlt bei Malherbe, Faune Ornith. de l’Algérie, 1855.
Fehlt bei Loche, Cat. des Mamm. et des Ois., obs. en
Algérie 1858.
Fehlt bei Tristram, on the Ornith. of Northern Africa
Ibis, 1859.
Fehlt bei Salvin, Five Months’ Birds’-nesting in the Eastern
Atlas, Ibis, 1859.
Loche, Expl. sc. de PAgérie, Hist, des Ois., 1867, I, p. 245.
Fehlt bei Taczanowski, Uebers. der Vögel Algeriens, Cab.
Journ. f. Orn., 1870.
Fehlt bei Gurney, jr., on the Ornith. of Algeria Ibis, 1871.
Fehlt bei Dixon, on the Birds of the Province of Constan-
tine, Ibis, 1882.
Hierzu Tab. I.
Es ist ein hervorragendes Verdienst des eifrigen Ornithologen
Loche, diese Art präcisirt zu haben. Nach ihm hat keiner über
diesen ausgesprochenen Wüstenvogel berichtet, da er von keinem
beobachtet, von keinem gesammelt und in die europäischen
Museen gebracht worden ist. Die isabellfarbige Wüstengrasmücke,
wie ich diese distinguirte Art auf Deutsch nennen möchte,
ist von Seebohm im „Catal. of the Birds in the British Museum,
Volume V, 1881, pag. 26“, unter Sylvia nana, Hempr. u. Ehrb.
gestellt und fortan als ein Synonym zur vorbenannten Art
betrachtet worden. Dem ist indessen nicht so. Seebohm hat
auch kein Material aus Algier in Händen gehabt, weshalb
er in diesen sehr verzeihlichen kleinen Irrthum verfallen ist —
sonst würde der scharfsichtige Kritiker und Forscher gewiss zu
einem anderen Schlüsse gelangt sein. Denn Loches Stoparola
deserti ist eine gute geographisch begrenzte Art, welche sich auf
den ersten Blick von der ihr gewiss nahestehenden, aber dunkleren
und grösseren Sylvia no,na, Hempr. und Ehrbg. Atraphornis
aralensis, Eversm. unterscheidet. Wir haben also hier wieder
ein sprechendes Beispiel, dass die nordwestafricanische Sahara
von der östlichen (aegyptischen) Wüste durchaus selbstständige»
in sich abgeschlossene Formen erzeugt. Somit reiht sich die
Sylvia deserti, Loche an die anderen typischen Formen der nord-
westafricanischen Sahara ebenbürtig und gleichartig an, als da
sind Brymoeca saharae, Loche, Crateropus fulvus, Desf., Ammomanes
algeriensis, Sharpe, Galerita macrorhyncha, Tristr. und
G. isabellina, Bp., deren entsprechende Arten im Osten Scotocerca
inquieta, Kretschm., Crateropus squamiceps, Kretschm., Ammomanes
deserti, Licht., Galerita magna, Hume und G. lutea, A. Br. sind.
Die isabellfarbige Wüstengrasmücke bewohnt die südlichsten
Distrikte der algerischen Sähara, tritt dort aber keineswegs überall
auf. Denn sie bindet sich nur an jene Wüstengelände mit
ausgesprochenem Sand- und Dünencharakter, und trifft selbst
unter diesen noch eine engere Auswahl. Der Sand muss einen
tiefrothen oder doch isabellfarbigen Ton tragen, wenn er den
Anforderungen unseres Vögelchens gerecht werden will. In jenem
blass- oder hellfarbigen Wüstengelände, welches den Strauch
Limoniastrum guyonianum zur Lieblingspflanze erhebt, ist das
Vögelchen eine grosse Seltenheit, auch wird man es niemals in
der ausgesprochenen peträischen Sähara antreffen und ebenso
wenig in der Sebkhaformation; dort aber, wo die Hügelgegenden
aus dem feinen, rothleuchtenden Sande gebildet werden und Dünen
an einander reihen, welche von den Arabern bezeichnend genug
mit dem Ausdruck Blutdünen „Areg el Dem“ bezeichnet werden
— dort erst wird man dieser südlichsten aller Grasmücken begegnen.
Ihr Gebiet theilt sie mit der isabellfarbenen Haubenlerche,
der Galerita isabellina, Bp., die hier zur gleichfalls
herrschenden Form ihres Geschlechtes wird. Diese Sand- oder
Dünenwüsten bringen eine ganz eigenartige, reiche Flora hervor.
Hier wachsen in üppiger Fülle eine grosse Menge ginsterartiger
Sträucher — als Betama retam, Linn., Cattigonum comosum,
L’Her, Ephedra alata, Dene, die von unserer Grasmücke besonders
bevorzugt werden. Neben und zwischen ihnen stehen gewaltige,
umfangreiche Büschel Wüstengräser, so die Aristida pungens,
Desf. mit ihren flockigen Blüthenwedeln, oder das als Haifagras
bekannte Lygeum spartum, Lin., harte, scharfschneidige Grasarten,
dann wieder dornige Genisten mit gelben Blüthen, die eigenartige
Gaillonia Beboudiana, Coss. mit perückenartigen Blüthenköpfen,
Gnaphalien und Disteln, schmarotzerartige Pflanzengebilde, wie
Cistanche lutea, Hffg. u. Lk. und viele andere noch, welche unserem
Sammeleifer entgangen sind. Alle aber sitzen dem Boden eng
auf, entsenden ihr weitmaschiges Wurzelgeflecht in den Boden
und starren mit ihren Aesten und Zweigen, mit ihren kleinen lederartigen
Blättern trotzig der gluthhauchenden Sonne entgegen.