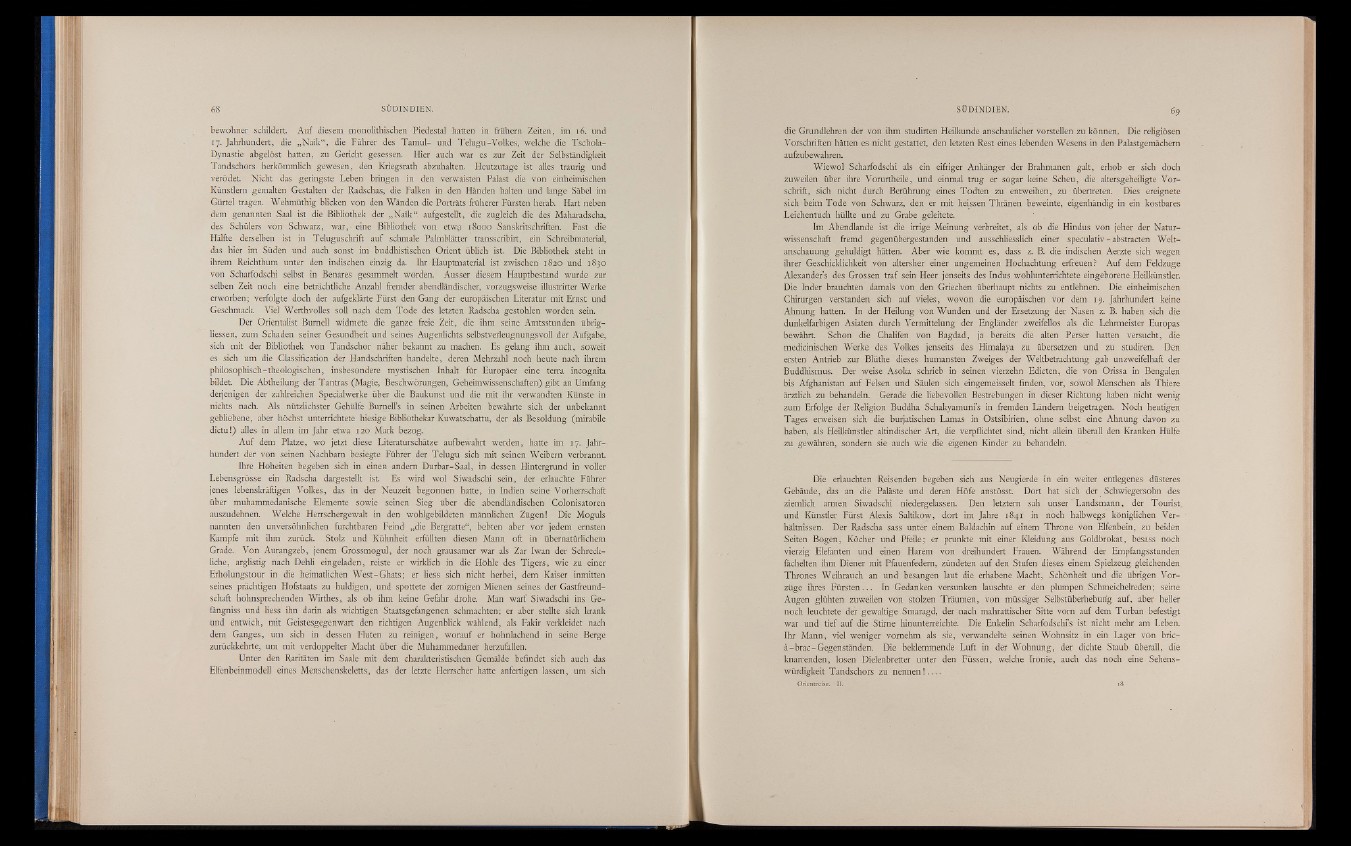
bewohner schildert. Auf diesem monolithischen Piedestal hatten in frühem Zeiten, im 1 6. und
17. Jahrhundert, die „Na'ik“ , die Führer des Tamul- und Telugu-Volkes, welche die Tschola-
Dynastie abgelöst hatten, zu Gericht gesessen. Hier auch war es zur Zeit der Selbständigkeit
Tandschors herkömmlich gewesen, den Kriegsrath abzuhalten. Heutzutage ist alles traurig und
verödet. Nicht das geringste Leben bringen in den verwaisten Palast die von einheimischen
Künstlern gemalten Gestalten der Radschas, die Falken in den Händen halten und lange Säbel im
Gürtel tragen. Wehmüthig blicken von den Wänden die Porträts früherer Fürsten herab. Hart neben
dem genannten Saal ist die Bibliothek der „Na'ik“. aufgestellt, die zugleich die des Maharadscha,
des Schülers von Schwarz, war,- eine Bibliothek von etwa 18000 Sanskritschriften. Fast die
Hälfte derselben ist in Teluguschrift auf schmale Palmblätter transscribirt, ein Schreibmaterial,
das hier im Süden und auch sonst im buddhistischen Orient üblich ist. Die Bibliothek steht in
ihrem Reichthum unter den indischen einzig da. Ihr Hauptmaterial ist zwischen 1820 und 1830
von Scharfodschi selbst in Benares gesammelt worden. Ausser diesem Hauptbestand wurde zur
selben Zeit noch eine beträchtliche Anzahl fremder abendländischer, vorzugsweise illustrirter Werke
erworben; verfolgte doch der aufgeklärte Fürst den Gang der europäischen Literatur mit Ernst und
Geschmack. Viel Werthvolles soll nach dem Tode des letzten Radscha gestohlen worden sein.
Der Orientalist Burnell widmete die ganze freie Zeit, die ihm seine Amtsstunden übrig-
liessen, zum Schaden seiner Gesundheit und seines Augenlichts selbstverleugnungsvoll der Aufgabe,
sich mit der Bibliothek von Tandschor näher bekannt zu machen. Es gelang ihm auch, soweit
es sich um die Classification der Handschriften handelte, deren Mehrzahl noch heute nach ihrem
philosophisch-theologischen, insbesondere mystischen Inhalt für Europäer eine terra incognita
bildet Die Abtheilung der Tantras (Magie, Beschwörungen, Geheimwissenschaften) gibt an Umfang
derjenigen der zahlreichen Specialwerke über die Baukunst und die mit ihr verwandten Künste in
nichts nach. Als nützlichster Gehülfe Bumell’s in seinen Arbeiten bewährte sich der unbekannt
gebliebene, aber höchst unterrichtete hiesige Bibliothekar Kuwatschattu, der als Besoldung (mirabile
dictu!) alles in allem im Jahr etwa 120 Mark bezog.
Auf dem Platze, wo jetzt diese Literaturschätze aufbewahrt werden, hatte im f l j Jahr-,
hundert der von seinen Nachbarn besiegte Führer der Telugu sich mit seinen Weibern verbrannt.
Ihre Hoheiten begeben sich in einen ändern Durbar-Saal, in dessen Hintergrund in voller
Lebensgrösse ein Radscha dargestellt ist Es wird wol Siwadschi sein, der erlauchte Führer
jenes lebenskräftigen Volkes, das in der Neuzeit begonnen hatte, in Indien seine Vorherrschaft
über muhammedanische Elemente sowie seinen Sieg über die abendländischen Colonisatoren
auszudehnen. Welche Herrschergewalt in den wohlgebildeten männlichen Zügen! Die Moguls
nannten den unversöhnlichen furchtbaren Feind „die Bergratte“ , bebten aber vor jedem ernsten
Kampfe mit ihm zurück. Stolz und Kühnheit erfüllten diesen Mann oft in übernatürlichem
Grade.. Von Aurangzeb, jenem Grossmogul, der noch grausamer war als Zar Iwan der Schreckliche,
arglistig nach Dehli eingeladen, reiste er wirklich in die Höhle des Tigers, wie zu einer
Erholungstour in die heimatlichen West-Ghats; er liess sich nicht herbei, dem Kaiser inmitten
seines prächtigen Hofstaats zu huldigen, und spottete der zornigen Mienen seines der Gastfreundschaft
hohnsprechenden Wirthes, als ob ihm keine Gefahr drohe. Man warf Siwadschi ins Ge-
fängniss und liess ihn darin als wichtigen Staatsgefangenen schmachten; er aber stellte sich krank
und entwich, mit Geistesgegenwart den richtigen Augenblick wählend, als Fakir verkleidet nach
dem Ganges, um sich in dessen Fluten zu reinigen, worauf er hohnlachend in seine Berge
zurückkehrte, um mit verdoppelter Macht über die Muhammedaneir herzufallen.
Unter den Raritäten im Saale mit dem charakteristischen Gemälde befindet sich auch das
Elfenbeinmodell eines Menschenskeletts, das der letzte Herrscher hatte anfertigen lassen, um sich
die Grundlehren der von ihm studirten Heilkunde anschaulicher vorstellen zu können. Die religiösen
Vorschriften hätten es nicht gestattet, den letzten Rest eines lebenden Wesens in den Palastgemächern
aufzubewahren.
Wiewol Scharfodschi als ein eifriger Anhänger der Brahmanen galt, erhob er sich doch
zuweilen über ihre Vorurtheile, und einmal trug er sogar keine Scheu, die altersgeheiligte Vorschrift,
sich nicht durch Berührung eines Todten zu entweihen, zu übertreten. Dies ereignete
sich beim Tode von Schwarz, den er mit heissen Thränen beweinte, eigenhändig in ein kostbares
Leichentuch hüllte und zu Grabe geleitete.
Im Abendlande ist die irrige Meinung verbreitet, als ob die Hindus von jeher der Naturwissenschaft
fremd gegenübergestanden und ausschliesslich einer speculativ - abstracten Weltanschauung
gehuldigt hätten. Aber wie kommt es, dass z. B. die indischen Aerzte sich wegen
ihrer Geschicklichkeit von altersher einer ungemeinen Hochachtung erfreuen? Auf dem Feldzuge
Alexander’s des Grossen traf sein Heer jenseits des Indus wohlunterrichtete eingeborene Heilkünstler.
Die Inder brauchten damals von den Griechen überhaupt nichts zu entlehnen. Die einheimischen
Chirurgen verstanden sich auf vieles, wovon die europâischèn vor dem 19. Jahrhundert keine
Ahnung hatten. In der Heilung von Wunden und der Ersetzung der Nasen z. B. haben sich die
dunkelfarbigen Asiaten durch Vermittelung der Engländer zweifellos als die Lehrmeister Europas
bewährt Schon die Chalifen von Bagdad, ja bereits die alten Perser hatten versucht, die
medicinischen Werke des Volkes jenseits dés Himalaya zu übersetzen und zu studiren. Den
ersten Antrieb zur Blüthe dieses humansten Zweiges der Weltbetrachtung gab unzweifelhaft der
Buddhismus. Der weise Asoka schrieb in seinen vierzehn Edicten, die von Orissa in Bengalen
bis Afghanistan auf Felsen und Säulen sich eingemeisselt finden, vor, söwol Menschen als Thiere
ärztlich zu behandeln. Gerade die liebevollen Bestrebungen in dieser Richtung haben nicht wenig
zum Erfolge der Religion Buddha Schakyamuni’s in fremden Ländern beigetragen. Noch heutigen
Tages erweisen sich die burjatischen Lamas in Ostsibirien, ohne « selbst eine Ahnung davon zu
haben, als Heilkünstler altindischer Art, die verpflichtet sind, nicht allein überall den Kranken Hülfe
zu gewähren, sondern sie auch wie die eigenen Kinder zu behandeln.
Die erlauchten Reisenden begeben sich aus Neugierde in ein weiter entlegenes düsteres
Gebäude, das an die Paläste und deren Höfe anstösst Dort hat sich der Schwiegersohn des
ziemlich armen Siwadschi niedergelassen. Den letztem sah unser ’ Landsmann, der Tourist,
und Künstler Fürst Alexis Saltikow, dort im Jahre 1841 in noch halbwegs, königlichen Verhältnissen.
Der Radscha sass unter einem Baldachin auf einem Throne Von Elfenbein, zu beiden
Seiten Bogen, Köcher und Pfeile; er prunkte mit einer Kleidung aus Goldbrokat, besass noch
vierzig Elefanten und einen Harem von dreihundert Frauen. Während der Empfangsstunden
fächelten ihm Diener mit Pfauenfedern, zündeten auf den Stufen dieses einem Spielzeug gleichenden
Thrones Weihrauch an und besangen laut die erhabene Macht, Schönheit und die übrigen Vorzüge
ihres Fürsten... In Gedanken versunken lauschte er den plumpen Schmeichelreden; seine
Augen glühten zuweilen von stolzen Träumen, von müssiger Selbstüberhebung auf, aber heller
noch leuchtete der gewaltige. Smaragd, der nach mahrattischer Sitte vorn auf dem Turban befestigt
war und tief auf die Stirne hinunterreichte. Die Enkelin Scharfodschi’s ist nicht mehr am Leben.
Ihr Mann, viel weniger vornehm als sie, verwandelte seinen Wohnsitz.in ein Lager von bric-
à-brac-Gegenständen. Die beklemmende Luft in der Wohnung, der dichte Staub überall, die
knarrenden, losen Dielenbretter unter den Füssen, welche Ironie, auch das noch eine Sehenswürdigkeit
Tandschors zu nennen ! . . . .
Orientreise. II. 18