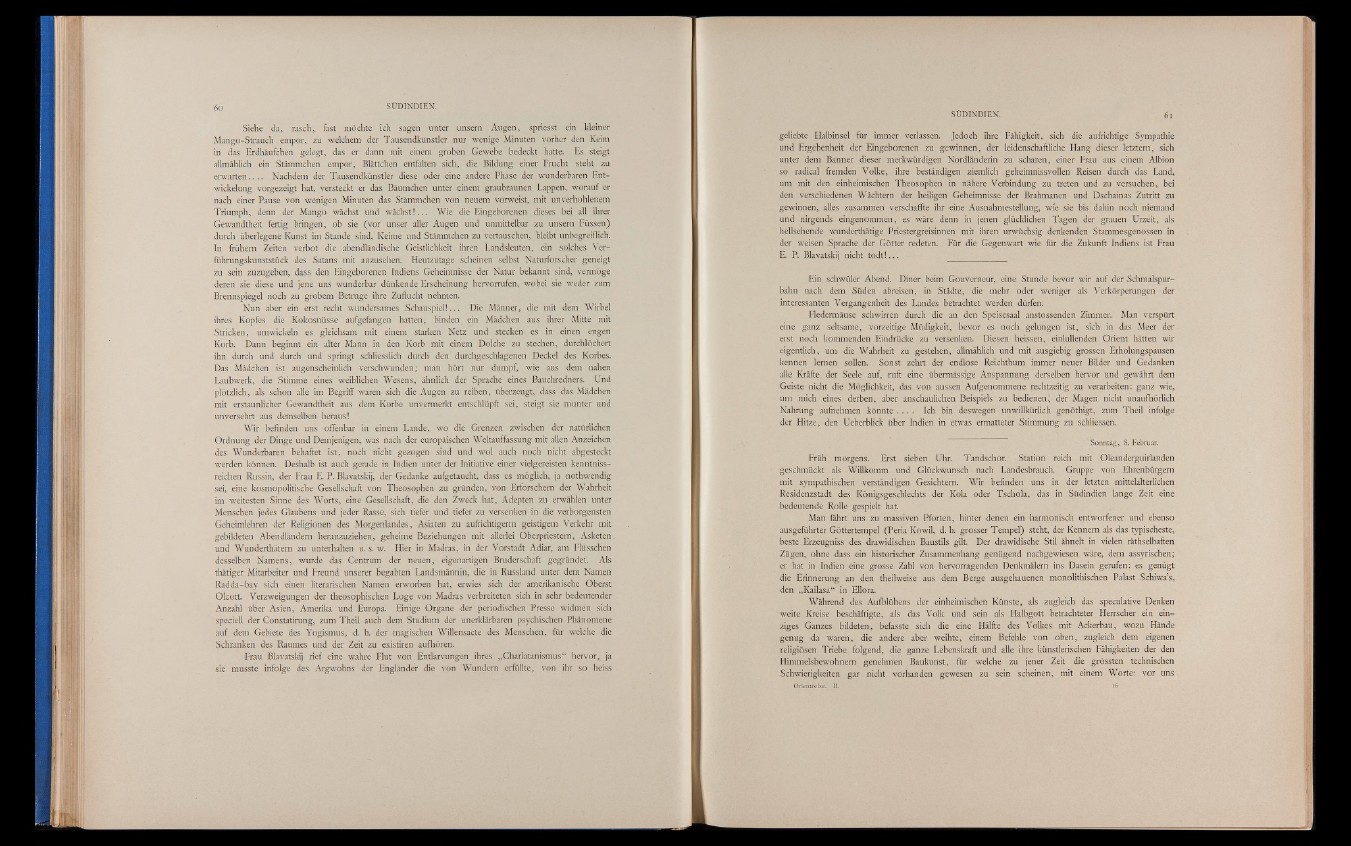
Siehe da, rasch, fast möchte ich sagen unter unsern Augen, spriesst ein kleiner
Mango-Strauch empor, zu welchem der Tausendkünstler nur wenige Minuten vorher den Keim
in das Erdhäufchen gelegt, das er dann mit einem groben Gewebe bedeckt hatte. Es steigt
allmählich ein Stämmchen empor, Blättchen entfalten sich, die Bildung einer Frucht steht zu
erwarten Nachdem der Tausendkünstler diese oder eine andere Phase der wunderbaren Entwickelung
vorgezeigt hat, versteckt er das Bäumchen unter einem graubraunen Lappen, worauf er
nach einer Pause von wenigen Minuten das Stämmchen von neuem vorweist, mit unverhohlenem
Triumph, denn der Mango wächst und wächst!... Wie die Eingeborenen dieses bei all ihrer
Gewandtheit fertig bringen, ob sie (vor unser aller Augen und unmittelbar zu unsern Füssen)
durch überlegene Kunst im Stande sind, Keime und Stämmchen zu vertauschen, bleibt unbegreiflich.
In frühem Zeiten verbot die abendländische Geistlichkeit ihren Landsleuten, ein solches Verführungskunststück
des Satans mit anzusehen. Heutzutage scheinen selbst Naturforscher geneigt
zu sein zuzugeben, dass den Eingeborenen Indiens Geheimnisse der Natur bekannt sind, vermöge
deren sie diese und jene uns wunderbar dünkende Erscheinung hervorrufen, wobei sie weder zum
Brennspiegel noch zu grobem Betrüge ihre Zuflucht nehmen.
Nun aber ein erst recht wundersames Schauspiel!. . . Die Männer, die mit dem Wirbel
ihres Kopfes die Kokosnüsse aufgefangen hatten, binden ein Mädchen aus ihrer Mitte mit
Stricken, umwickeln es gleichsam mit einem starken Netz und stecken es in einen engen
Korb. Dann beginnt ein alter Mann in den Korb mit einem Dolche zu stechen, durchlöchert
ihn durch und durch und springt schliesslich durch den durchgeschlagenen Deckel des Korbes.
Das Mädchen ist augenscheinlich verschwunden; man hört nur dumpf, wie aus dem nahen
Laubwerk, die Stimme eines weiblichen Wesens, ähnlich der Sprache eines Bauchredners. Und
plötzlich, als schon alle im Begriff waren sich die Augen zu reiben, überzeugt, dass das Mädchen
mit erstaunlicher Gewandtheit aus dem Korbe unvermerkt entschlüpft sei, steigt sie munter und
unversehrt aus demselben heraus!
Wir befinden uns offenbar in einem Lande, wo die Grenzen zwischen der natürlichen
Ordnung der Dinge und Demjenigen, was nach der europäischen Weltauffassung mit allen Anzeichen
des Wunderbaren behaftet ist, noch nicht gezogen sind und wol auch noch nicht abgesteckt
werden können. Deshalb ist auch gerade in Indien unter der Initiative einer vielgereisten kenntniss-
reichen Russin, der Frau E. P. Blavatskij, der Gedanke aufgetaucht, dass es möglich, ja nothwendig
sei, eine kosmopolitische Gesellschaft von Theosophen zu gründen, von Erforschern der Wahrheit
im weitesten Sinne des Worts, eine Gesellschaft, die den Zweck hat, Adepten zu erwählen unter
Menschen jedes Glaubens und jeder Rasse, sich tiefer und tiefer zu versenken in die verborgensten
Geheimlehren der Religionen des Morgenlandes, Asiaten zu aufrichtigerm geistigem Verkehr mit
gebildeten Abendländern heranzuziehen, geheime Beziehungen mit allerlei Oberpriestern, Asketen
und Wunderthätern zu unterhalten u. s. w. Hier in Madras, in der Vorstadt Adiar, am Flüsschen
desselben Namens, wurde das Centrum der neuen, eigenartigen Bruderschaft gegründet. Als
thätiger Mitarbeiter und Freund unserer begabten Landsmännin, die in Russland unter dem Namen
Radda-bay sich einen literarischen Namen erworben hat, erwies sich der amerikanische Oberst
Olcott Verzweigungen der theosophischen Loge von Madras verbreiteten sich in sehr bedeutender
Anzahl über Asien, Amerika und Europa. Einige Organe der''periodischen Presse widmen sich
speciell der Constatirung, zum Theil auch dem Studium der unerklärbaren psychischen Phänomene
auf dem Gebiete des Yogismus, d. h. der magischen Willensacte des Menschen, für welche die
Schranken des Raumes und der Zeit zu existiren aufhören.
Frau Blavatskij rief eine wahre Flut von Entlarvungen ihres „Charlatanismus“ hervor, ja
sie musste infolge des Argwohns der Engländer die von Wundern erfüllte, von ihr so heiss
geliebte Halbinsel für immer verlassen. Jedoch ihre Fähigkeit, sich die aufrichtige Sympathie
und Ergebenheit der Eingeborenen zu gewinnen, der leidenschaftliche Hang dieser letztem, sich
unter dem Banner dieser merkwürdigen Nordländerin zu scharen, einer Frau aus einem Albion
so radical fremden Volke, ihre beständigen ziemlich geheimnissvollen Reisen durch das Land,
um mit den einheimischen Theosophen in nähere Verbindung zu treten und zu versuchen, bei
den verschiedenen Wächtern der heiligen Geheimnisse der Brahmanen und Dsehainas Zutritt zu
gewinnen, alles zusammen verschaffte ihr eine Ausnahmestellung, wie sie bis dahin noch niemand
und nirgends eingenommen, es wäre denn in jenen glücklichen Tagen der grauen Urzeit, als
hellsehende wunderthätige Priestergreisinnen mit ihren urwüchsig denkenden Stammesgenossen in
der weisen Sprache der Götter redeten. Für die Gegenwart wie für die Zukunft Indiens ist Frau
E. P. Blavatskij nicht todt!....
Ein schwüler Abend. Diner beim Gouverneur, eine Stunde bevor wir auf der Schmalspurbahn
nach dem Süden abreisen, in Städte, die mehr oder weniger als Verkörperungen der
interessanten Vergangenheit des Landet betrachtet werden dürfen.
Fledermäuse schwirren durch die an den Speisesaal anstossenden Zimmer.- Man verspürt
eine ganz seltsame, vorzeitige Müdigkeit, bevor es noch gelungen ist, sich in das Meer der
erst noch kommenden Eindrücke zu versenken. Diesen heissen, einlullenden Orient hätten wir
eigentlich, um die Wahrheit zu gestehen, allmählich und mit ausgiebig grossen Erholungspausen
kennen lernen sollen. Sonst zehrt der endlose Reichthum immer neuer Bilder und Gedanken
alle Kräfte der Seele auf, ruft- eine übermässige Anspannung derselben hervor und gewährt dem
Geiste nicht die Möglichkeit, das von aussen Aufgenommene rechtzeitig zu verarbeiten: ganz wie,
um mich eines derben, aber anschaulichen Beispiels zu bedienen, der Magen nicht unaufhörlich
Nahrung aufnehmen könnte . . . . Ich bin deswegen unwillkürlich genöthigt, zum Theil infolge
der Hitze, den Ueberblick über Indien in etwas ermatteter Stimmung zu schliessen.
Sonntag, 8. Februar.
Früh morgens. Erst sieben Uhr. Tandschor. Station reich mit Oleanderguirlanden
geschmückt als Willkomm und Glückwunsch nach Landesbrauch. Gruppe von Ehrenbürgern
mit sympathischen verständigen Gesichtern. Wir befinden uns in der letzten mittelalterlichen
Residenzstadt des Königsgeschlechts der Kola oder Tschola, das in Südindien lange Zeit eine
bedeutende Rolle gespielt hat.
Man fährt uns zu massiven Pforten, hinter denen ein harmonisch entworfener und ebenso
ausgeführter Göttertempel (Peria Kowil, d. h. grösser Tempel) steht, der Kennern als das typischeste,
beste. Erzeugniss des drawidischen Baustils gilt. Der drawidische Stil ähnelt in vielen räthselhaften
Zügen, ohne dass ein historischer Zusammenhang genügend nachgewiesen, wäre, dem assyrischen;
er hat in Indien eine grosse Zahl von hervorragenden Denkmälern ins Dasein gerufen: es genügt
die Erinnerung an den theilweise aus dem Berge ausgehauenen monolithischen Palast Schiwa’s,
den „Kailasa“ in Ellora.
Während des Aufblühens der einheimischen Künste, als zugleich das speculative Denken
weite Kreise beschäftigte, als das Volk und sein als Halbgott betrachteter Herrscher ein einziges
Ganzes bildeten, befasste sich die eine Hälfte des Volkes mit Ackerbau, wozu Hände
genug da waren, die andere aber weihte, einem Befehle von oben, zugleich dem eigenen
religiösen Triebe folgend, die ganze Lebenskraft und alle ihre künstlerischen Fähigkeiten der den
Himmelsbewohnern genehmen Baukunst, für welche zu jener Zeit die grössten technischen
Schwierigkeiten gar nicht vorhanden gewesen zu sein scheinen, mit einem Worte: vor uns
Orientreise. II. ' ./ .: . ' l 6