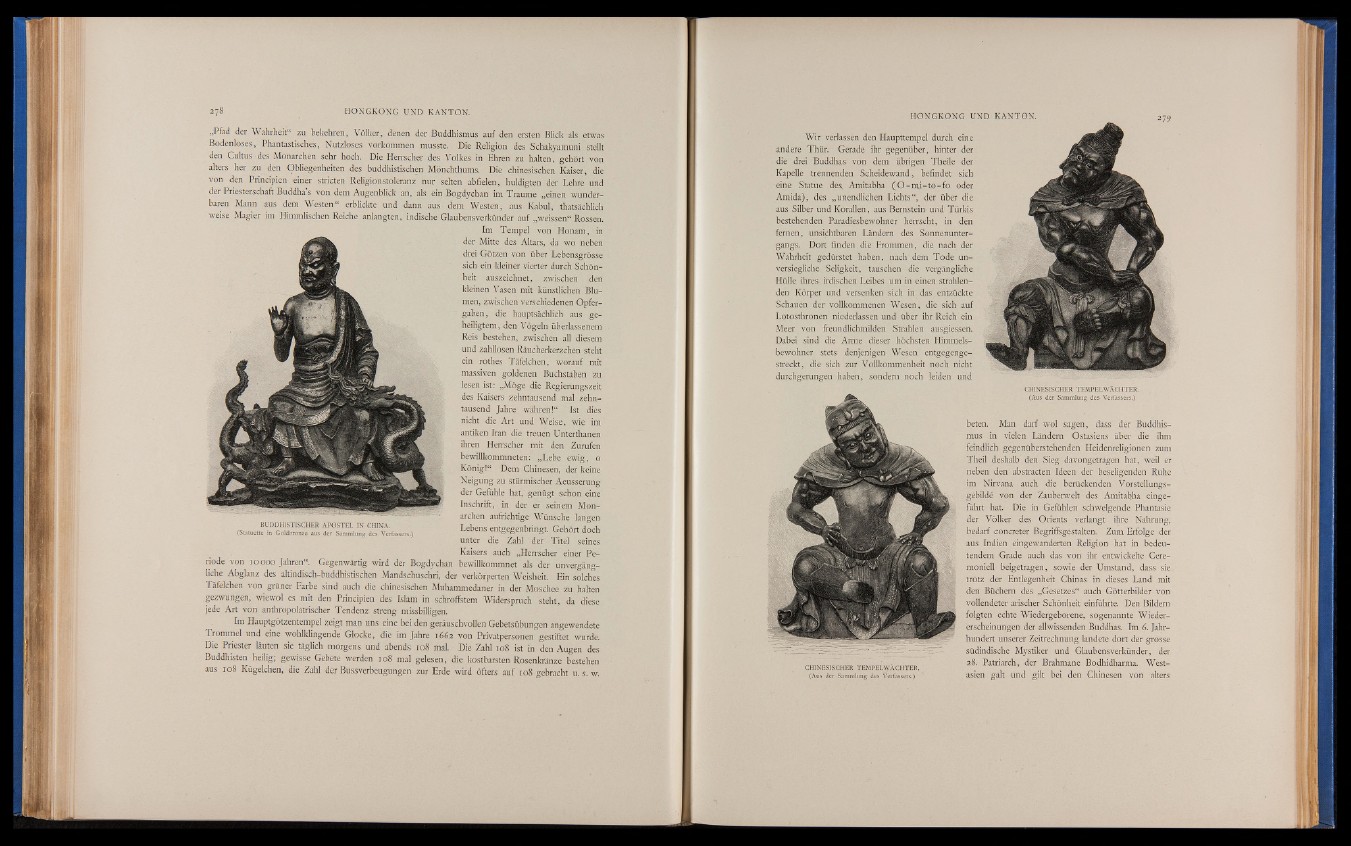
„Pfad der Wahrheit“ zu bekehren, Völker, denen der Buddhismus auf den ersten Blick als etwas
Bodenloses, Phantastisches, Nutzloses Vorkommen musste. Die Religion des Schakyamuni stellt
den Cultus - des Monarchen sehr hoch. Die Herrscher des Volkes in Ehren zu halten, gehört von
alters her zu den Obliegenheiten des buddhistischen Mönchthums. Die chinesischen Kaiser, die
von den Principien einer stricten Religionstoleranz nur selten abiielen, huldigten der Lehre und
der Priesterschaft Buddha s von dem Augenblick an, als ein Bogdychan im Traume „einen wunderbaren
Mann aus dem Westen“ erblickte und dann aus dem Westen, aus Kabul, thatsächlich
weise Magier im Himmlischen Reiche anlangten, indische Glaubensverkünder auf „weissen“ Rossen.
Im Tempel von Honam, in
der Mitte des Altars, da wo neben
drei Götzen von über Lebensgrösse
sich ein kleiner vierter durch Schönheit
auszeichnet, zwischen den
kleinen Vasen mit künstlichen Blumen,
zwischen verschiedenen Opfergaben
, die hauptsächlich aus • geheiligtem,
den Vögeln überlassenem
Reis bestehen, zwischen all diesem
und zahllosen Räucherkerzchen steht
ein rothes Täfelchen, worauf mit
massiven goldenen Buchstaben zu
lesen ist: „Möge die Regierungszeit
des Kaisers zehntausend mal zehntausend
Jahre* währen!“ Ist dies
nicht die Art und Weise, wie im
antiken Iran die treuen Unterthanen
ihren Herrscher mit den Zurufen
bewillkommneten: „Lebe ewig, o
König!“ Dem Chinesen, der keine
Néigung zu stürmischer Aeusserung
der Gefühle hat, genügt' schon eine
Inschrift, in der er seinem Monarchen
aufrichtige Wünsche langen
- 'v ^:;Leb«is'en^»mbm^'^rtdódi
unter die Zahl der Titel seines
Kaisers auch „Herrscher einer Periode
von ioooo Jahren“ . Gegenwärtig wird der Bogdychan bewillkommnet als der unvergängliche
Abglanz des altindisch-buddhistischen Mandschuschri, der verkörperten Weisheit; Ein solches
Täfelchen von grüner Farbe sind auch die chinesischen Muhammedaner in der Moschee zu halten
gezwungen, wiewol es mit den Principien des Islam in schroffstem Widerspruch steht, da diese
jede Art von anthropolatrischer Tendenz streng missbilligen.
Im Hauptgötzentempel zeigt man uns eine bei den geräuschvollen Gebetsübungen angewendete
Trommel und eine wohlklingende Glocke, die im Jahre 1662 von Privatpersonen gestiftet wurde.
Die Priester läuten sie täglich morgens und abends 108 mal. Die Zahl 108 ist in den Augen des
Buddhisten heilig; gewisse Gebete werden 108 mal gelesen, die kostbarsten Rosenkränze bestehen
aus 108 Kügelchen, die Zahl der Bussverbeugungen zur Erde wird öfters auf 108 gebracht u. s. w.
Wir verlassen den Haupttempel durch eine
andere Thür. Gerade ihr gegenüber, hinter der
die drei Buddhas von dem übrigen Theile der
Kapelle trennenden Scheidewand, befindet sich
eine Statue des Amitabha (O -m i- to - fo oder
Amida), des „unendlichen Lichts“ , der über die
aus Silber und Korallen, aus Bernstein und Türkis
bestehenden Paradiesbewohner herrscht, in den
fernen, unsichtbaren Ländern des Sonnenuntergangs.
Dort finden die Frommen, die nach der
Wahrheit gedürstet haben, nach dem Tode un-
versiegliche Seligkeit, tauschen die vergängliche
Hülle ihres irdischen Leibes um in einen strahlenden
Körper und versenken sich in das entzückte
Schauen der vollkommenen Wesen, die sich auf
Lotosthronen niederlassen und über ihr Reich ein
Meer von freundlichmilden Strahlen ausgiessen.
Dabei sind die Arme dieser höchsten Himmelsbewohner
stets denjenigen Wesen entgegengestreckt,
die sich zur Vollkommenheit noch nicht
durchgerungen haben, sondern noch leiden und
CHINESISCHER TEMPELWÄCHTER.
(Aus der Sammlung des Verfassers.)
CHINESISCHER TEMPEL WÄCHTER.
(Aus der^Sämmlung des Verfassers.)
beten. Man darf wol sagen, dass der Buddhismus
in vielen Ländern Ostasiens über die ihm
feindlich gegenüberstehenden Heidenreligionen zum
Theil deshalb den Sieg davongetragen hat, weil er
neben den abstracten Ideen der beseligenden Ruhe
im Nirvana auch die berückenden Vorstellungsgebilde
von der Zauberwelt des Amitabha eingeführt
hat. Die in Gefühlen schwelgende Phantasie
der Völker des Orients verlangt ihre Nahrung,
bedarf concreter Begriffsgestalten. Zum Erfolge der
aus Indien eingewanderten Religion hat in bedeutendem
Grade auch das von ihr entwickelte Cere-
moniell beigetragen, sowie der Umstand, dass sie
trotz der Entlegenheit Chinas in dieses Land mit
den Büchern des „Gesetzes“ auch Götterbilder von
vollendeter arischer Schönheit einführte. Den Bildern
folgten echte Wiedergeborene, sogenannte Wiedererscheinungen
der allwissenden Buddhas; Im 6. Jahrhundert
unserer Zeitrechnung landete dort der grosse
südindische Mystiker und Glaubensverkünder, der
28. Patriarch, der Brahmane Bodhidharma. Westasien
galt und gilt bei den Chinesen von alters