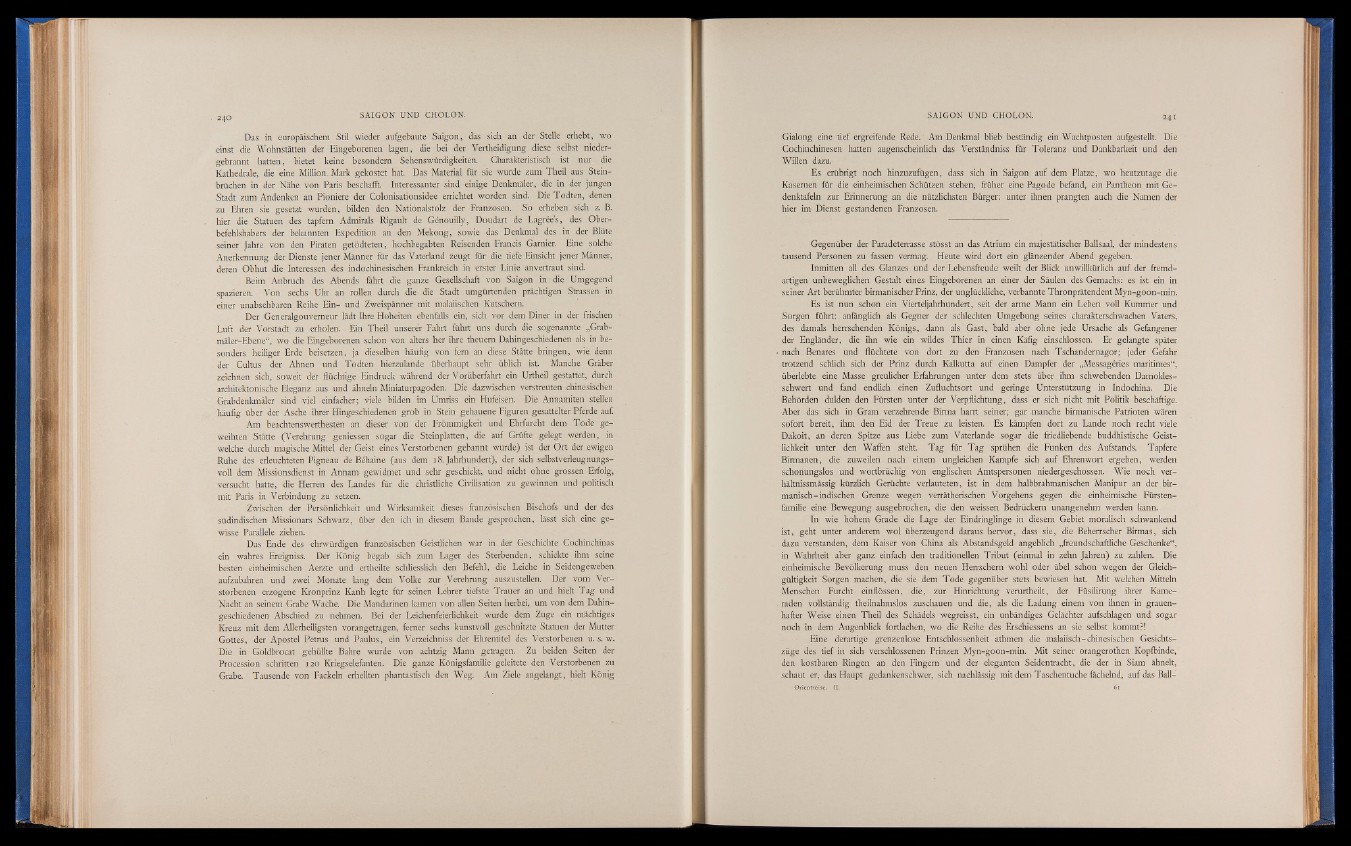
Das in europäischem Stil wieder aufgebaute Saigon, das sich an der Stelle erhebt, wo
einst die Wohnstätten der Eingeborenen lagen, die bei der Vertheidigung diese selbst niedergebrannt
hatten, bietet keine besondern Sehenswürdigkeiten. Charakteristisch ist nur die
Kathedrale, die eine Million-Mark gekostet hat. Das Material für sie wurde zum Theil aus Steinbrüchen
in der Nähe von Paris beschafft Interessanter sind einige Denkmäler, die in der jungen
Stadt zum Andenken an Pioniere der Colonisationsidee errichtet worden sind. Die Todten, denen
zu Ehren sie gesetzt wurden, bilden den Nationalstolz der Franzosen. So erheben sich z. ß.
hier die Statuen des tapfern Admirals Rigault de G£nouilly, Doudart de Lagr^e’s , des Oberbefehlshabers
der bekannten Expedition an den Mekong, sowie das Denkmal des in der Blüte
seiner Jahre von den Piraten getödteten, hochbegabten Reisenden Francis Garnier. Eine solche
Anerkennung der Dienste jener Männer für das Vaterland zeugt für die tiefe Einsicht jener Männer,
deren Obhut die Interessen des indochinesischen Frankreich in erster Linie anvertraut sind.
Beim Anbruch des Abends fährt die ganze Gesellschaft von Saigon in die Umgegend
spazieren. Von sechs Uhr an rollen durch die die Stadt umgürtenden prächtigen Strassen in
einer unabsehbaren Reihe Ein- und Zweispänner mit malaiischen Kutschern.
Der Generalgouverneur lädt Ihre Hoheiten ebenfalls ein, sich vor dem Diner in der frischen
Luft der Vorstadt zu erholen. Ein Theil unserer Fahrt führt uns durch die sogenannte „Grab-
mäler-Ebene“ , wo die Eingeborenen schon von alters her ihre theuern Dahingeschiedenen als in besonders
heiliger Erde beisetzen, ja dieselben häufig von fern an diese Stätte bringen, wie denn
der Cultus der Ahnen und Todten hierzulande überhaupt sehr üblich ist Manche Gräber
zeichnen sich, soweit der flüchtige Eindruck während der Vorüberfahrt ein Urtheil gestattet, durch
architektonische Eleganz aus und ähneln Miniaturpagoden: Die dazwischen verstreuten chinesischen
Grabdenkmäler sind viel einfacher; viele bilden im Umriss ein Hufeisen. Die Annamiten stellen
häufig über der Asche ihrer Hingeschiedenen grob in Stein gehauene Figuren gesattelter Pferde, auf.
Am beachtenswerthesten an dieser von der Frömmigkeit und Ehrfurcht dem Tode geweihten
Stätte (Verehrung geniessen sogar die Steinplatten, die auf Grüfte gelegt werden, in
welche durch magische Mittel der Geist eines Verstorbenen gebannt wurde) ist der Ort der ewigen
Ruhe des erleuchteten Pigneau de Behaine (aus dem 18. Jahrhundert), der sich selbstverleugnungsvoll
dem Missionsdienst in Annam gewidmet und sehr geschickt, und nicht ohne grossen Erfolg,
versucht hatte, die Herren des Landes für die christliche Civilisation zu gewinnen und politisch
mit Paris in Verbindung zu setzen.
Zwischen der Persönlichkeit und Wirksamkeit dieses französischen Bischofs und der des
südindischen Missionars Schwarz, über den ich in diesem Bande gesprochen, lässt sich eine gewisse
Parallele ziehen.
Das Ende des ehrwürdigen französischen Geistlichen war in der Geschichte Cochinchinas
ein -wahres Ereigniss. Der König begab sich zum Lager des Sterbenden, schickte ihm seine
besten einheimischen Aerzte und ertheilte schliesslich den Befehl, die Leiche in Seidengeweben
aufzubahren und zwei Monate lang dem Volke zur Verehrung auszustellen. Der vom Verstorbenen
erzogene Kronprinz Kanh legte für seinen Lehrer tiefste Trauer an und hielt Tag und
Nacht an seinem Grabe Wache. Die Mandarinen kamen von allen Seiten herbei, um von dem Dahingeschiedenen
Abschied zu nehmen. Bei der Leichenfeierlichkeit wurde dem Zuge ein mächtiges
Kreuz mit dem Allerheiligsten vorangetragen, ferner sechs kunstvoll geschnitzte Statuen der Mutter
Gottes, der Apostel Petrus und Paulus, ein Verzeichniss der Ehrentitel des Verstorbenen u. s. w.
Die in Goldbrocat gehüllte Bahre wurde von achtzig Mann getragen. Zu beiden Seiten der
Procession schritten 120 Kriegselefanten. Die ganze Königsfamilie geleitete den Verstorbenen zu
Grabe. Tausende von Fackeln erhellten phantastisch den Weg. Am Ziele angelangt, hielt König
Gialong eine tief ergreifende Rede. Am Denkmal blieb beständig ein Wachtposten aufgestellt. Die
Cochinchinesen hatten augenscheinlich das Verständniss für Toleranz und Dankbarkeit und den
Willen dazu.
Es erübrigt noch hinzuzufügen, dass sich in Saigon auf dem Platze, wo heutzutage die
Kasernen für die einheimischen Schützen stehen, früher eine Pagode befand, ein Pantheon mit Gedenktafeln
zur Erinnerung an die nützlichsten Bürger: unter ihnen prangten auch die Namen der
hier im Dienst gestandenen Franzosen.
Gegenüber der Paradeterrasse stösst an das Atrium ein majestätischer Ballsaal, der mindestens
tausend Personen zu fassen vermag. Heute wird dort ein glänzender Abend gegeben.
Inmitten all des Glanzes und der Lebensfreude weilt der Blick unwillkürlich auf der fremdartigen
unbeweglichen Gestalt eines Eingeborenen an einer der Säulen des Gemachs: es ist ein in
seiner Art berühmter birmanischer Prinz, der unglückliche, verbannte Thronprätendent Myn-goon-min.
Es ist nun schon ein Vierteljahrhundert, seit der arme Mann ein Leben voll Kummer und
Sorgen führt: anfänglich als Gegner der schlechten Umgebung seines charakterschwachen Vaters,
des damals herrschenden Königs, -dann als Gast, bald aber ohne jede Ursache als Gefangener
der Engländer, die ihn wie ein wildes Thier in einen Käfig einschlossen. Er gelangte später
nach Benares und flüchtete voii dort zu den Franzosen nach rTschandernagor; jeder Gefahr
trotzend schlich sich der Prinz durch Kalkutta auf einen Dampfer der „Messag^ries maritimes“ ,
überlebte eine Masse greulicher Erfahrungen unter dem stets über ihm schwebenden Damoklesschwert
und fand endlich einen Zufluchtsort und geringe Unterstützung in Indochina. Die
Behörden dulden den Fürsten unter der Verpflichtung, dass er sich nicht mit Politik beschäftige.
Aber das sich in Gram verzehrende Birma harrt seiner; gar manche birmanische Patrioten wären
sofort bereit, ihm den Eid der Treue zu leisten. Es kämpfen dort zu Lande noch recht viele
Dakoit, an deren Spitze aus Liebe zum Vaterlande sogar die friedliebende buddhistische Geistlichkeit
unter den Waffen steht Tag für Tag sprühen die Funken des Aufstands. Tapfere
Birmanen, die zuweilen nach einem ungleichen Kampfe sich auf Ehrenwort ergeben, werden
schonungslos und wortbrüchig von englischen Amtspersonen niedergeschossen. Wie noch ver-
hältnissmässig kürzlich Gerüchte verlauteten, ist in dem halbbrahmanischen Manipur an der birmanisch
indischen Grenze wegen verrätherischen Vorgehens gegen die einheimische Fürstenfamilie
eine Bewegung ausgebrochen, die den weissen Bedrückern unangenehm werden kann.
In wie hohem Grade die Lage der Eindringlinge in diesem Gebiet moralisch schwankend
ist, geht unter anderem wol überzeugend daraus hervor, dass sie, die Beherrscher Birmas, sich
dazu verstanden, dem Kaiser von China als Abstandsgeld angeblich „freundschaftliche Geschenke“,
in Wahrheit aber ganz einfach den traditionellen Tribut (einmal in zehn Jahren) zu zahlen. Die
einheimische Bevölkerung muss den neuen Herrschern wohl oder übel schon wegen der Gleichgültigkeit
Sorgen machen, die sie dem Tode gegenüber stets bewiesen hat Mit welchen Mitteln
Menschen Furcht einflössen, die, zur Hinrichtung verurtheilt, der Füsilirung ihrer Kameraden
vollständig theilnahmslos zuschauen und die, als die Ladung einem von ihnen in grauenhafter
Weise einen Theil des Schädels wegreisst, ein unbändiges Gelächter aufschlagen und sogar
noch in dem Augenblick fortlachen, wo die Reihe des Erschiessens an sie selbst kommt?!
Eine derartige grenzenlose Entschlossenheit athmen die malaiisch-chinesischen Gesichtszüge
des tief in sich verschlossenen Prinzen Myn-goon-min. Mit seiner orangerothen Kopfbinde,
den kostbaren Ringen ari den Fingern und der eleganten Seidentracht, die der in Siam ähnelt,
schaut er, das Haupt gedankenschwer, sich nachlässig mit dem Taschentuche fächelnd, auf das Ball-
Orientreise. 11. - - 61