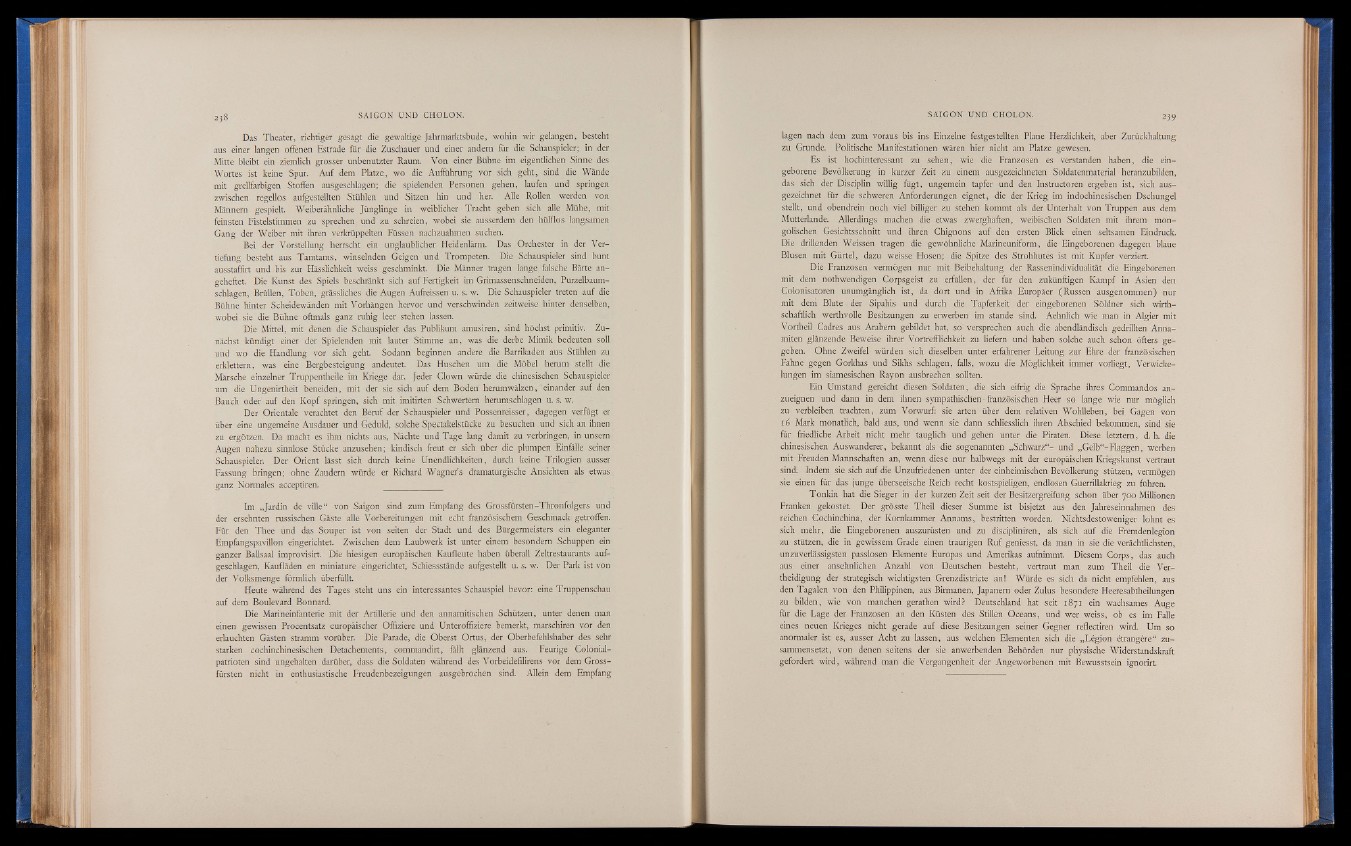
Das Theater, richtiger gesagt die gewaltige Jahrmarktsbude, wohin wir gelangen, besteht
aus einer langen offenen Estrade für die Zuschauer und einer ändern für die Schauspieler; in der
Mitte bleibt ein ziemlich grösser unbenutzter Raum. Von einer Bühne im eigentlichen Sinne des
Wortes ist keine Spur. Auf dem Platze, wo die Aufführung vor sich geht, sind die Wände
mit grellfarbigen Stoffen ausgeschlagen; die spielenden Personen gehen, laufen und springen
zwischen regellos aufgestellten Stühlen und Sitzen hin und her. Alle Rollen werden von
Männern gespielt. Weiberähnliche Jünglinge in weiblicher Tracht geben sich alle Mühe, mit
feinsten Fistelstimmen zu sprechen und zu schreien, wobei sie ausserdem den hülflos langsamen
Gang der Weiber mit ihren verkrüppelten Füssen nachzuahmen suchen.
Bei der Vorstellung herrscht ein unglaublicher Heidenlärm. Das Orchester in der Vertiefung
besteht aus Tamtams, winselnden Geigen und Trompeten. Die Schauspieler sind bunt
ausstaffirt und bis zur Hässlichkeit weiss geschminkt. Die Männer tragen lange falsche Bärte angeheftet
Die Kunst des Spiels. beschränkt sich auf Fertigkeit im Grimassenschneiden, Purzelbaumschlagen,
Brüllen, Toben, grässliches die Augen Aufreissen u. s. w. Die Schauspieler treten auf die
Bühne hinter Scheidewänden mit Vorhängen hervor und verschwinden zeitweise hinter denselben,
wobei sie die Bühne oftmals ganz ruhig leer stehen lassen.
Die Mittel, mit denen die Schauspieler das Publikum amusiren, sind höchst primitiv. Zunächst
kündigt einer der Spielenden mit lauter Stimme an, was die derbe Mimik bedeuten soll
und wo die Handlung vor sich geht Sodann beginnen andere die Barrikaden aus Stühlen zu
erklettern, was eine Bergbesteigung andeutet Das Huschen um die Möbel herum stellt die
Märsche einzelner Truppentheile im Kriege dar. Jeder Clown würde die chinesischen Schauspieler
um die Ungenirtheit beneiden, mit der sie sich auf dem Boden herumwälzen, ‘einander auf den
Bauch oder auf den Kopf springen, sich mit imitirten Schwertern herumschlagen u. s. w.
Der Orientale verachtet den Beruf der Schauspieler und Possenreisser, dagegen verfügt er
über eine ungemeine Ausdauer und Geduld, solche Spectakelstücke zu besuchen und sich an ihnen
zu ergötzen. Da macht es ihm nichts aus, Nächte und Tage lang damit zu verbringen, in unsern
Augen nahezu sinnlose Stücke anzusehen; kindisch freut er sich über die plumpen Einfälle- seiner
Schauspieler. Der Orient lässt sich durch keine Unendlichkeiten, durch keine Trilogien ausser
Fassung bringen; ohne Zaudern würde er Richard Wagners dramaturgische Ansichten als etwas;
ganz Normales acceptiren.
Im „Jardin de ville“ von Saigon sind zum Empfang des Grossfürsten -Thronfolgers und
der ersehnten russischen Gäste alle Vorbereitungen mit echt französischem Geschmack- getroffen.
Für den Thee und das Souper ist von seiten der Stadt und des Bürgermeisters ein eleganter
Empfangspavillon eingerichtet. Zwischen dem Laubwerk ist unter einem besondern Schuppen ein
ganzer Ballsaal improvisirt. Die hiesigen europäischen Kaufleute haben überall Zeltrestaurants aufgeschlagen,
Kaufläden en miniature eingerichtet, Schiessstände aufgestellt u. s. w. Der Park ist von
der Volksmenge förmlich überfüllt.
Heute während des Tages steht uns ein interessantes Schauspiel bevor: eine Truppenschau
auf dem Boulevärd Bonnard.
Die Marineinfanterie mit der Artillerie und den annamitischen Schützen, unter denen man
einen gewissen Procentsatz europäischer Offiziere und Unteroffiziere bemerkt, marschiren vor den
erlauchten Gästen stramm vorüber. Die Parade, die Oberst Ortus, der Oberbefehlshaber des sehr
starken cochinchinesischen Detachements, commandirt, fällt glänzend aus. Feurige Colönial-
patrioten sind ungehalten darüber, dass die Soldaten während des Vorbeidefilirens vor dem Grossfürsten
nicht in enthusiastische Freudenbezeigungen ausgebrochen sind. Allein dem Empfang
lagen nach dem zum voraus bis ins Einzelne festgestellten Plane Herzlichkeit, aber Zurückhaltung
zu Grunde. Politische Manifestationen wären hier nicht am Platze gewesen.
Es ist hochinteressant zu Sehen, wie die Franzosen es verstanden haben, die eingeborene
Bevölkerung in kurzer Zeit zu einem ausgezeichneten Soldatenmaterial heranzubilden,
das sich der Disciplin willig fügt, ungemein tapfer und den Instructoren ergeben ist, sich ausgezeichnet
für die schweren Anforderungen eignet, die der Krieg im indochinesischen Dschungel
stellt, und obendrein noch viel billiger zu stehen kommt als der Unterhalt von Truppen aus dem
Mutterlande. Allerdings machen die etwas zwerghäften, weibischen Soldaten mit ihrem mongolischen
Gesichtsschnitt und ihren Chignons auf den ersten Blick einen seltsamen Eindruck.
Die drillenden Weissen tragen die. gewöhnliche Marineuniform, die Eingeborenen dagegen blaue
Blusen mit Gürtel, dazu weisse Hosen; die Spitze des Strohhutes ist mit Kupfer verziert.
Die Franzosen vermögen nur mit Beibehaltung der Rassenindividualität die Eingeborenen
mit dem nothwendigen Corpsgeist zu erfüllen, der für den zukünftigen Kampf in Asien den
Colonisatoren unumgänglich ist, da dort und in Afrika Europäer (Russen ausgenommen) nur
mit dem Blute der Sipahis und durch die Tapferkeit der eingeborenen Söldner sich wirth-
sehaftlich werthvolle Besitzungen zu erwerben im Stande sind. Aehnlich wie man in Algier mit
Vortheil Cadres aus Arabern gebildet hat, so'versprechen auch die abendländisch gedrillten Anna-
miten glänzende Beweise ihrer Vörtrefflichkeit zu liefern und haben solche auch schon öfters gegeben.
Ohne Zweifel würden sich dieselben unter erfahrener Leitung zur Ehre der französischen
Fahne gegen Gorkhas und Sikhs schlagen, falls, wozu die Möglichkeit immer vorliegt, Verwickelungen
im siamesischen Rayon ausbrechen sollten.
Ein Umstand gereicht diesen Soldaten, die sich eifrig die Sprache ihres Commandos anzueignen
und dann in dem ihnen sympathischen - französischen Heer so. lange wie nur möglich
zu verbleiben trachten, zum Vorwurf: sie arten über dem relativen Wohlleben, bei Gagen von
16 Mark monatlich, bald aus, und wenn sie dann schliesslich ihren Abschied bekommen, sind sie
für friedliche Arbeit nicht mehr tauglich und gehen unter die Piraten. Diese letztem, d. h. die
chinesischen Auswanderer, bekannt als die sogenannten „Schwarz“ - und „Gelb“ -Flaggen, werben
mit Freuden Mannschaften an, wenn diese nur halbwegs mit der europäischen Kriegskunst vertraut
sind. Indem sie sich auf die Unzufriedenen unter der einheimischen Bevölkerung stützen, vermögen
sie einen für das junge überseeische Reich recht kostspieligen, endlosen Guerrillakrieg zu führen.
Tonkin hat die Sieger in der kurzen Zeit seit der Besitzergreifung schon über 700 Millionen
Franken gekostet. Der grösste Theil dieser Summe ist bisjeizt aus den Jahreseinnahmen des
reichen Cochinchina, der Kornkammer Annams, bestritten worden. Nichtsdestoweniger lohnt es
sich .mehr, die Eingeborenen auszurüsten und zu discipliniren, als sich auf die Fremdenlegion
zu stützen, die in gewissem Grade einen traurigen Ruf geniesst, da man in sie die verächtlichsten,
unzuverlässigsten passlosen Elemente Europas und Amerikas aufnimmt. Diesem Corps, das auch
aus einer ansehnlichen Anzahl von Deutschen besteht, vertraut man zum Theil die Verteidigung
der strategisch wichtigsten Grenzdistricte an! Würde es sich da nicht empfehlen, aus
den Tagalen von den Philippinen, aus Birmanen, Japanern oder Zulus besondere Heeresabtheilungen
zu bilden, wie von manchen gerathen wird? Deutschland hat seit 18 7 1 ein wachsames Auge
für die Lage der Franzosen an den Küsten des Stillen Océans, und wer weiss, ob es im Falle
eines neuen Krieges nicht gerade auf diese Besitzungen seiner Gegner reflectiren wird. Um so
anormaler ist es, ausser Acht zu lassen, aus welchen Elementen sich die „Légion étrangère“ zusammensetzt,
von denen seitens der sie anwerbenden Behörden nur physische Widerstandskraft
gefordert wird, während man die Vergangenheit der Angeworbenen mit Bewusstsein ignorirt.