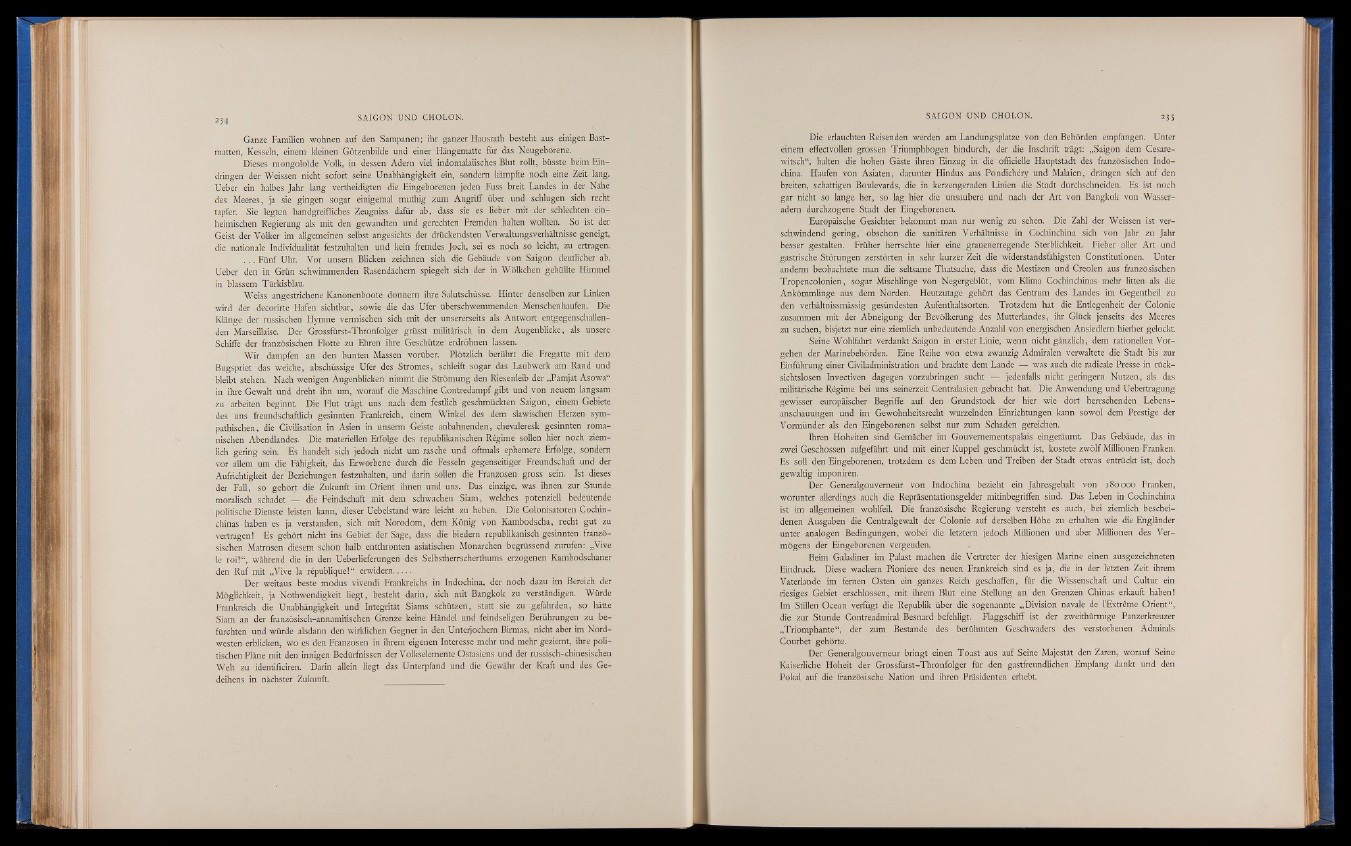
Ganze Familien wohnen auf den Sampanen; ihr ganzer Hausrath besteht aus einigen Bastmatten,
Kesseln, einem kleinen Götzenbilde und einer Hängematte für das Neugeborene.
Dieses mongoloïde Volk, in dessen Adern viel indomalaiisches Blut rollt, büsste beim Eindringen
der Weissen nicht sofort seine Unabhängigkeit ein, sondern kämpfte noch eine Zeit lang.
Ueber ein halbes Jahr lang vertheidigten die Eingeborenen jeden Fuss breit Landes in der Nähe
des Meeres, ja sie gingen sogar einigemal muthig zum Angriff über und schlugen sich recht
tapfer. Sie legten handgreifliches Zeugniss dafür ab, dass sie es lieber mit der schlechten einheimischen
Regierung als mit den gewandten und gerechten Fremden halten wollten. So ist der
Geist der Völker im allgemeinen selbst angesichts der drückendsten Verwaltungsverhältnisse geneigt,
die nationale Individualität festzuhalten und kein fremdes Joch, sei es noch so leicht, zu ertragen.
. . . Fünf Uhr. Vor unsern Blicken zeichnen sich die Gebäude von Saigon deutlicher ab.
Ueber den in Grün schwimmenden Rasendächern spiegelt sich der in Wölkchen gehüllte Himmel
in blassem Türkisblau.
Weiss angestrichene Kanonenboote donnern ihre Salutschüsse. Hinter denselben zur Linken
wird der decorirte Hafen sichtbar, sowie die das Ufer überschwemmenden Menschenhaufen. Die
Klänge der russischen Hymne vermischen sich mit der unsererseits als Antwort entgegenschallenden
Marseillaise. Der Grossfürst-Thronfolger grüsst militärisch in dem Augenblicke, als unsere
Schiffe der französischen Flotte zu Ehren ihre Geschütze erdröhnen lassen.
Wir dampfen an den bunten Massen vorüber. Plötzlich berührt die Fregatte mit dem
Bugspriet das weiche, abschüssige Ufer des Stromes, schleift sogar das Laubwerk am Rand und
bleibt stehen. Nach wenigen Augenblicken nimmt die Strömung den Riesenleib der „Pamjat Asowa“
in ihre Gewalt und dreht ihn um, worauf die Maschine Contredampf gibt und von neuem langsam
zu arbeiten beginnt. Die Flut trägt uns nach dem festlich geschmückten Saigon, einem Gebiete
des uns freundschaftlich1 gesinnten Frankreich, einem Winkel des dem slawischen Herzen sympathischen,
die Civilisation in Asien in unserm Geiste anbahnenden, chevaleresk gesinnten romanischen
Abendlandes. Die materiellen Erfolge des republikanischen Régime sollen hier noch ziemlich
gering sein. Es handelt sich jedoch nicht um rasche und oftmals ephemere Erfolge, sondern
vor allem um die Fähigkeit, das Erworbene durch die Fesseln gegenseitiger Freundschaft und der
Aufrichtigkeit der'Beziehungen festzuhalten, und darin sollen die Franzosen gross sein. Ist dieses
der Fall, so gehört die Zukunft im Orient ihnen und uns. Das einzige, was ihnen zur Stunde,
moralisch schadet — die Feindschaft mit dem schwachen Siam, welches potenziell bedeutende
politische Dienste leisten kann, dieser Uebelstand wäre leicht zu heben. Die Colonisatoren Cochin-
chinas haben es ja verstanden, sich mit Norodom, dem König von Kambodscha, recht gut zu
vertragen! Es gehört nicht ins Gebiet der Sage, dass die biedern republikanisch gesinnten französischen
Matrosen diesem schon halb entthronten asiatischen Monarchen begrüssend zurufen: „Vive
le roü“ , während die in den Ueberliefeningen des Selbstherrscherthums erzogenen Kambodschaner
den Ruf mit „Vive la république!“ erwidern........
Der weitaus beste modus vivendi Frankreichs in Indochina, der noch dazu im Bereich der
Möglichkeit, ja Nothwendigkeit liegt, besteht darin, sich mit Bangkok zu verständigen. Würde
Frankreich die Unabhängigkeit und Integrität Siams schützen, statt sie zu 'gefährden, so hätte
Siam an der französisch-annamitischen Grenze keine Händel und feindseligen Berührungen zu befürchten
und würde alsdann den wirklichen Gegner in den Unterjochern Birmas, nicht aber im Nordwesten
erblicken, wo es den Franzosen in ihrem eigenen Interesse mehr und mehr geziemt, ihre politischen
Pläne mit den innigen Bedürfnissen der Volkselemente Ostasiens und der russisch-chinesischen
Welt zu identificiren. Darin allein liegt das Unterpfand und die Gewähr der Kraft und des Gedeihens
in nächster Zukunft. ____________
Die erlauchten Reisenden werden am Landungsplätze von den Behörden empfangen. Unter
einem effectvollen grossen Triumphbogen hindurch, der die Inschrift trägt: „Saigon dem Cesare-
witsch“ , halten die hohen Gäste ihren Einzug in' die officielle Hauptstadt des französischen Indochina.
Haufen von Asiaten, darunter Hindus aus Pondichéry und Malaien, drängen sich auf den
breiten, schattigen Boulevards, die in kerzengeraden Linien die Stadt durchschneiden. Es ist noch
gar nicht sö lange her, so lag hier die unsaubere und nach der Art von Bangkok von Wasseradern
durchzogene Stadt der Eingeborenen.
Europäische Gesichter bekommt man nur wenig zu sehen. Die Zahl der Weissen ist verschwindend
gering, obschon die sanitären Verhältnisse in Cochinchina sich von Jahr zu Jahr
besser gestalten. Früher herrschte hier eine grauenerregende Sterblichkeit. Fieber aller Art und
gastrische Störungen zerstörten in sehr kurzer Zeit die widerstandsfähigsten Constitutionen. Unter
anderm beobachtete man die seltsame Thatsaçhe, dass die Mestizen und Creolen aus französischen
Tropencolonien, sogar Mischlinge von Negergeblüt, vom Klima Cochinchinas mehr litten als die
Ankömmlinge aus dem Norden. Heutzutage gehört das Centrum des Landes im Gegentheil zu
den verhältnissmässig gesündesten Aufenthaltsorten. Trotzdem hat die Entlegenheit der Colonie
zusammen mit der Abneigung der Bevölkerung des Mutterlandes, ihr Glück jenseits des Meeres
zu suchen, bisjetzt nur eine ziemlich unbedeutende Anzahl von energischen Ansiedlern hierher gelockt
Seine Wohlfahrt verdankt Saigon in erster Linie, wenn nicht gänzlich, dem rationellen Vorgehen
der Marinebehörden. Eine Reihe von etwa zwanzig Admiralen verwaltete die Stadt bis zur
Einführung einer Civiladministration und brachte dem Lande — was auch die radicale Presse in rücksichtslosen
Invectiven dagegen vorzubringen sucht — jedenfalls nicht geringem Nutzen, als das
militärische Régime bei uns seinerzeit Centralasien gebracht hat Die Anwendung und Uebertragung
gewisser europäischer Begriffe auf den Grundstock der hier wie dort herrschenden Lebensanschauungen
und im Gewohnheitsrecht wurzelnden Einrichtungen kann sowol dem Prestige der
Vormünder als den Eingeborenen selbst nur zum Schaden gereichen.
Ihren Hoheiten sind Gemächer im Gouvernementspalais eingeräümt Das Gebäude, das in
zwei Geschossen aufgeführt und mit einer Kuppel geschmückt ist, kostete zwölf Millionen Franken.
Es soll den Eingeborenen, trotzdem es dem Leben und Treiben der Stadt etwas entrückt ist, doch
gewaltig imponiren.
Der Generalgouverneur von Indochina bezieht ein Jahresgehalt von 180000 Franken,
worunter allerdings auch die Repräsentationsgelder mitinbegriffen sind. Das Leben in Cochinchina
ist im allgemeinen wohlfeil. Die französische Regierung versteht es auch, bei ziemlich bescheidenen
Ausgaben die Centralgewalt der Colonie auf derselben Höhe zu erhalten wie die Engländer
unter analogen Bedingungen, wobei die letztem jedoch Millionen und aber Millionen des Vermögens
der Eingeborenen vergeuden.
Beim Galadiner im Palast machen die Vertreter der hiesigen Marine einen ausgezeichneten
Eindruck. Diese wackern Pioniere des neuen Frankreich sind es ja, die in der letzten Zeit ihrem
Vaterlande im fernen Osten ein ganzes Reich geschaffen, für die Wissenschaft und Cultur ein
riesiges Gebiet erschlossen, mit ihrem Blut eine Stellung an den Grenzen Chinas erkauft haben!
Im Stillen Ocean verfügt die Republik über die sogenannte „Division navale de l’Extrême Orient“ ,
die zur Stunde Contreadmiral Besnard befehligt. Flaggschiff ist der zweithürmige Panzerkreuzer
„Triomphante“ , der zum Bestände des berühmten Geschwaders des verstorbenen Admirals
Courbet gehörte.
Der Generalgouverneur bringt einen Toast aus auf Seine Majestät den Zaren, worauf Seine
Kaiserliche Hoheit der Grossfürst-Thronfolger für den gastfreundlichen Empfang dankt und den
Pokal auf die französische Nation und ihren Präsidenten erhebt.