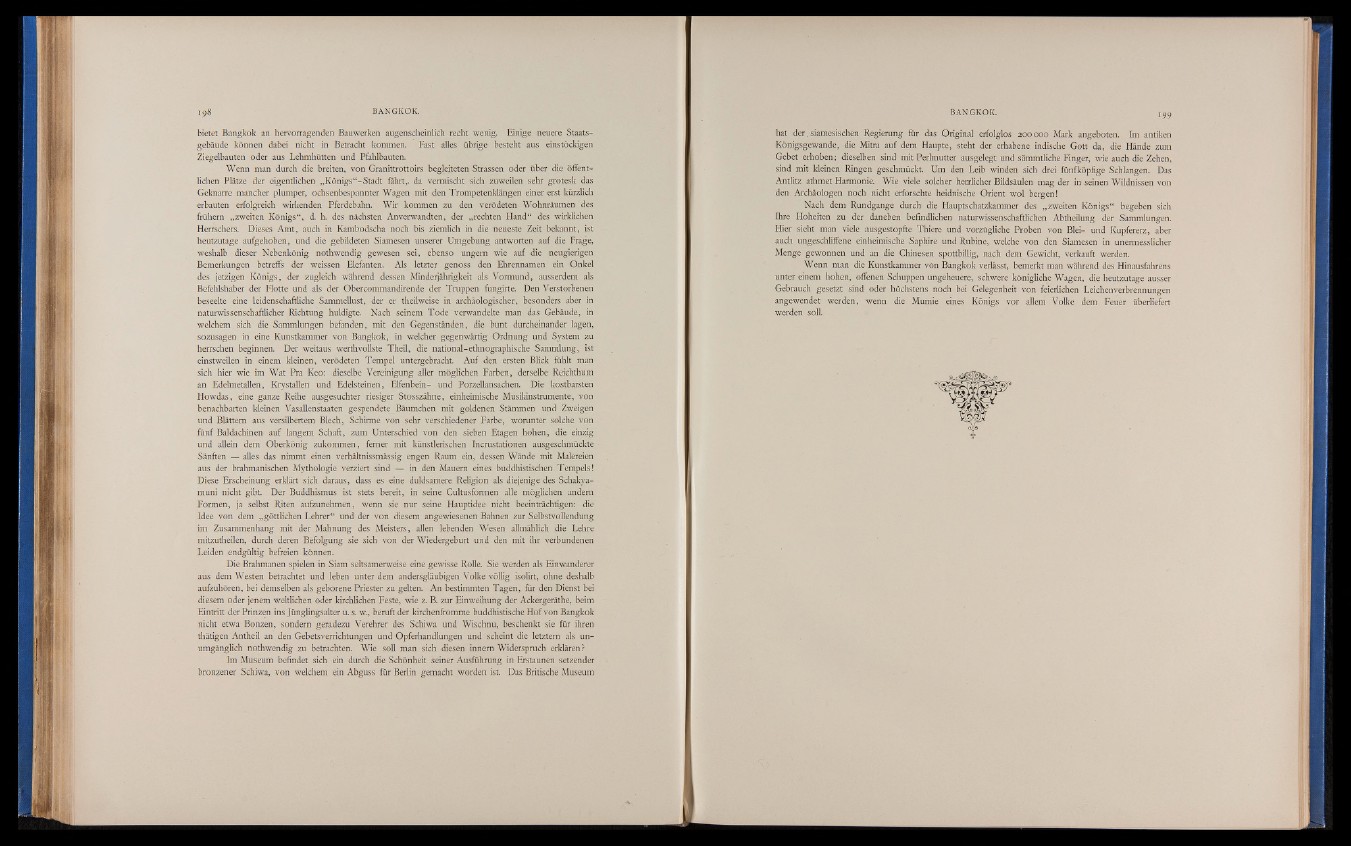
bietet Bangkok an hervorragenden Bauwerken augenscheinlich recht wenig. Einige neuere Staats^
gebäude können dabei nicht in Betracht kommen. Fast alles übrige besteht aus einstöckigen
Ziegelbauten oder aus Lehmhütten und Pfahlbauten.
Wenn man durch die breiten, von Granittrottoirs begleiteten Strassen oder über die öffentlichen
Plätze der eigentlichen „Königs“ -Stadt fährt,, da vermischt sich zuweilen sehr grotesk das
Geknarre mancher plumper, ochsenbespannter Wagen mit den Trompetenklängen einer erst kürzlich
erbauten erfolgreich wirkenden Pferdebahn. Wir kommen zu den verödeten Wohnräumen des
frühem „zweiten Königs“ , d. h. des nächsten Anverwandten, der „rechten Hand“ des wirklichen
Herrschers. Dieses Amt, auch in Kambodscha noch bis ziemlich in die neueste Zeit bekannt, ist
heutzutage aufgehoben, und die gebildeten Siamesen unserer Umgebung antworten auf die Frage,
weshalb dieser Nebenkönig nothwendig gewesen sei, ebenso ungern wie auf die neugierigen
Bemerkungen betreffs der weissen Elefanten. Als letzter genoss den Ehrennamen ein Onkel
des jetzigen Königs, der zugleich während dessen Minderjährigkeit als Vormund, ausserdem als
Befehlshaber der Flotte und als der Obercommandirende der Truppen fungirte. Den Verstorbenen
beseelte eine leidenschaftliche Sammellust, der er theilweise in archäologischer, besonders aber in
naturwissenschaftlicher Richtung huldigte. Nach seinem Tode verwandelte man das Gebäude, in
welchem sich die Sammlungen befanden, mit den Gegenständen, die bunt durcheinander lagen,
sozusagen in eine Kunstkammer von Bangkok, in welcher gegenwärtig Ordnung und System zu
herrschen beginnen. Der weitaus werthvollste Theil, die national-ethnographische Sammlung, ist
einstweilen in einem kleinen, verödeten Tempel untergebracht. Auf den ersten Blick fühlt man
sich hier wie im Wat Pra Keo: dieselbe Vereinigung aller möglichen Farben, derselbe Reichthum
an Edelmetallen, Krystallen und Edelsteinen, Elfenbein- und Porzellansachen. Die kostbarsten
Howdas, eine ganze Reihe ausgesuchter riesiger Stosszähne, einheimische Musikinstrumente, von
benachbarten kleinen Vasallenstaaten gespendete Bäumchen mit goldenen Stämmen und Zweigen
und Blättern aus versilbertem Blech, Schirme von sehr verschiedener Farbe, worunter solche von
fünf Baldachinen auf langem Schaft, zum Unterschied von den sieben Etagen hohen, die einzig
und allein dem Oberkönig zukommen, ferner mit künstlerischen Incrustationen ausgeschmückte
Sänften alles das nimmt einen verhältnissmässig engen Raum ein, dessen Wände mit Malereien
aus der brahmanischen Mythologie verziert sind — in den Mauern eines buddhistischen Tempels!
Diese Erscheinung erklärt sich daraus, dass es eine duldsamere Religion als diejenige des Schakya-
muni nicht gibt. Der Buddhismus ist stets bereit, in seine Cultusformen alle möglichen ändern
Formen, ja selbst Riten aufzunehmen, wenn sie nur seine Hauptidee nicht beeinträchtigen: die
Idee von dem „göttlichen Lehrer“ und der von diesem angewiesenen Bahnen zur Selbstvollendung
im Zusammenhang mit der Mahnung des Meisters, allen lebenden Wesen allmählich die Lehre
mitzutheilen, durch deren Befolgung sie sich von der Wiedergeburt und den mit ihr verbundenen
Leiden endgültig befreien können.
Die Brähmanen spielen in Siam seltsamerweise eine gewisse Rolle. Sie werden als Einwanderer
aus dem Westen betrachtet und leben unter dem andersgläubigen Volke völlig isolirt, ohne deshalb
aufzuhören, bei demselben als geborene Priester zu gelten. An bestimmten Tagen, für den Dienst bei
diesem oder jenem weltlichen oder kirchlichen Feste, wie z. B. zur Einweihung der Ackergeräthe, beim
Eintritt der Prinzen ins Jünglingsalter u. s. w., beruft der kirchenfromme buddhistische Hof von Bangkok
nicht etwa Bonzen, sondern geradezu Verehrer des Schiwa und Wischnu, beschenkt sie für ihren
thätigen Antheil an den Gebetsverrichtungen und Opferhandlungen und scheint die letztem als unumgänglich
nothwendig zu betrachten. Wie soll man sich diesen innern Widerspruch erklären?
Im Museum befindet sich ein durch die Schönheit seiner Ausführung in Erstaunen setzender
bronzener Schiwa, von welchem ein Abguss für Berlin gemacht worden ist. Das Britische Museum
hat der.siamesischen Regierung für das Original erfolglos 200000 Mark angeboten. Im antiken
Königsgewande, die Mitra auf dem Haupte, steht der erhabene indische Gott da, die Hände zum
Gebet erhoben; dieselben sind mit Perlmutter ausgelegt und sämmtliche Finger, wie auch die Zehen,
sind mit kleinen Ringen geschmückt. LJm den Leib winden sich drei fünfköpfige Schlangen. Das
Antlitz athmet Harmonie. Wie viele solcher herrlicher Bildsäulen mag der in seinen Wildnissen von
den Archäologen noch nicht erforschte heidnische Orient wol bergen!
Nach dem Rundgange durch die Hauptschatzkammer des „zweiten Königs“ begeben sich
Ihre Hoheiten zii der daneben befindlichen naturwissenschaftlichen Abtheilung der Sammlungen.
Hier sieht man viele ausgestopfte Thiere und vorzügliche Proben von Blei- und Kupfererz, aber
auch ungeschliffene einheimische Saphire und Rubine, welche von den Siamesen in unermesslicher
Menge gewonnen und an die Chinesen spottbillig, nach dem Gewicht, verkauft werden.
Wenn man die Kunstkammer von Bangkok verlässt, bemerkt man während des Hinausfahrens
unter einem hohen, offenen Schuppen ungeheuere, schwere königliche Wagen, die heutzutage ausser
Gebrauch gesetzt sind oder höchstens noch bei Gelegenheit von feierlichen Leichenverbrennungen
angewendet werden, wenn die Mumie eines Königs vor allem Volke dem Feuer überliefert
werden soll.