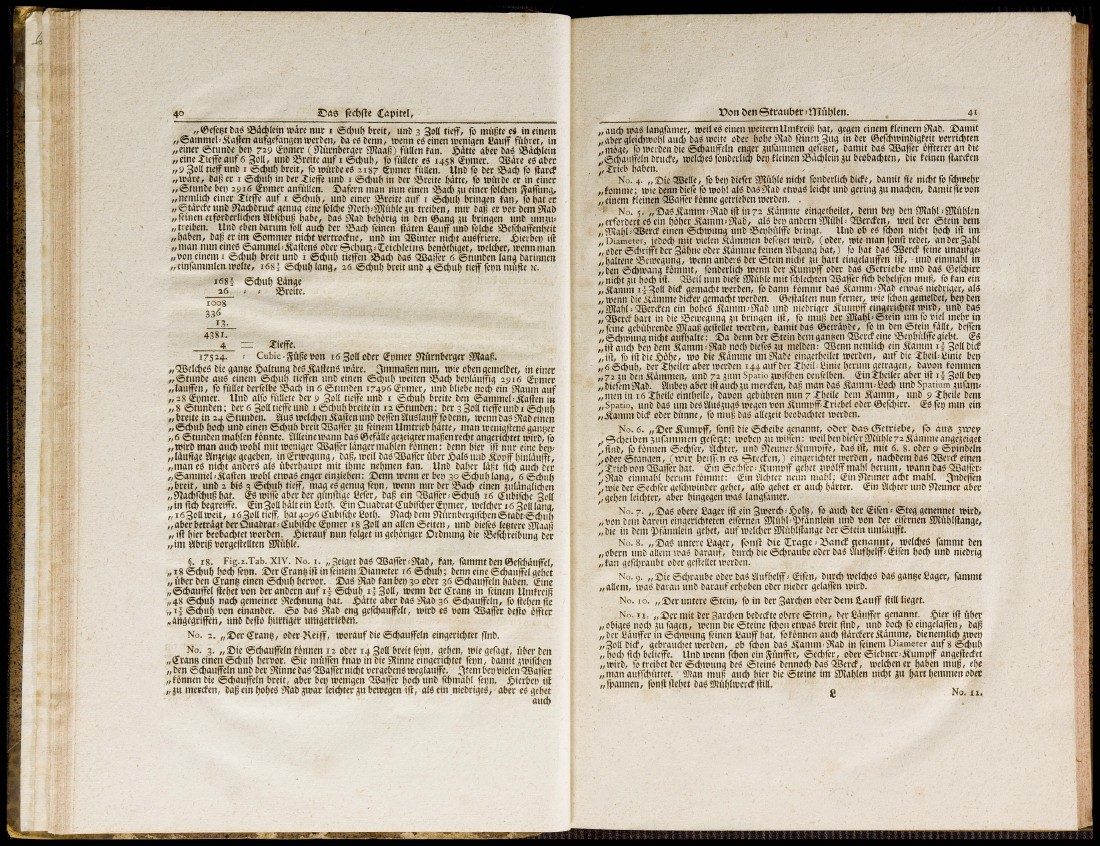
40 ©«8 fcc^lîc £(ipit<l, Don öc i iStMt iber i tTïnl j let t . 41
„ «cfcgt t)a6 SSdeSIcin icarc mi t i ®cl)ul) breit, imC 3 30a (tcff, fo mftlitc cä in einem
„6ammcl'Äa|lenaufgefangcnwcr6cn, Da es Denn, wenn es einen »enigen Caiiff fi'iljrct, in
„einer ©tunDe bei) 7 19 (Jumer (sni'irnbet!;er SD?aa(i) Ritten fim. ^ät tc aber Daä SSädjIeiti
,,cinc Jicffe auf 6 Sott, iinD SBreite auf i ©cjul ) , fo füttete eä 1458 gijmer. ®ä r e cä aber
• Sijmev ffiHen. UnD fo Der ®ad) (0 Uarcf
;) in Der sSreitc I)dtte, fo ttii'ivDc er in einer
, - , , . n nun einen SSacf) sn einer folet)cn Salfiimj,
„nenilid) einer Xitffe auf i ©cfciit), iinD einer »rei te auf i ©djul; bringen (an, fo tjat er
„ e t d r c f c nnD ««adjDrucf genug eine foldje snotlj^SKftWe jii treiben, nur Daß er »or Dem 9?aD
„feinen eiforDerlicfeen abfcl)u6 babe, Daä 95aD bel)irig in Den ©ang ju bringen unD iimnu
„treiben. UnD eben Darum fott auc() Der »ac() feinen ildten Sauff unD foldje »efdjaffcnbeit
„baben. Daß er im ©ommer nicfct »crtrocfne, iinD im SfBinter nicfct ausfriere. Jpieibei) i|t
„man nun eines ©ammel.-ÄaflcnS oDer ©cbn^^iCcicbleiiiö ben6tf)iget, »eldjer, wenn man
„von einem I ödjuf ) breit unD i ©d)u() ticffen iBad) Das Oßatfer 6 ©timDen lang Darinnen
„cinfammlentpolte, l e s i ©c()h6 lang, 26 ©dml) breit unD 4 ©d)ul) tieff fci)n mfifie k.
i«8J ©d)ul) Sänge
' > SSrcitc.
löog
336
4 _ = »e f f e.
17524. ! Cu b i c - g ö ß cwn i6 3oHcDer gi)mer Sli'irnberger SHaaß.
„ ®e(ct)eS Die gan^c ©altnng Des Saf fens wäre. 3in>naßen nun, wie oben gemelDet, in einet
„©tunDe aus einem ©cbu() ticffen unD einen ©®ul) ireiten ®ad) beijläuifig 2916 giimcr
„ l a u f e n , fo füttet Dcrfclbe aSad) in 6 ©tiinDen 17496 S-nmer, unD bliebe ncd) ein 9{aum auf
„ 1 8 ©;mcr. UnD alfo fiilletc Der 9 'icffe unD i ed)u( ) breite Den ©ammcl 'Äal fen in
„ 8 ©tunDen; Der 6 Sott tiefe unD i©dnil ) breite in i i S t u nDe n ; Der 3 Soff tiefe miDiSdjuI )
„ toite in 24 ©tunDen. J l u S «)e(d)cnÄaj}cn unD Dcfcn auSl auf fo Denn, wenn Das 9?aD einen
„©c()uf) unD einen ©ctmb breit®a()er ju feinem IlmtriebIjättc, man trcniglicnSganBcr
„ 6 ©tunDen maf)Ien fónntc. äKeineu'ann Das ©efdffe gejeigtet maßen tcdjt angerid)tet wirD, fo
„teirD man aiid) »ol j l mit tttcnigcr 3 ß a f c t längermaljien fonncn: Denn Ijier i|i nur eine bei>-
„läufige Sfnjeige gegeben, inCirwegung, Daß, weil DaSCD3afer i'ibet ß a l s unD Ä o p f Ijinläufft,
„man es niftt anDcrS als i'iberijaupt mit ibme neljmen fan. UnD Dat)ct läßt fid) and; Dct
„©ammcl'Mafien woljl etwas enger einjieben: ©cnn wenn er bei) .^o©c6ul) lang, 6©d)iil)
„breit, unD 2 bis 3 ©rfjul) t ief , mag es genug fet)n, wenn nur Der ®ad) einen julanglicfcen
„S)lad)fd)uß bat. gs wi f e aber Der güniligc Cefer, Dag ein ®afet . -©d)ub 16 giibifi^e Soff
„ i n fïd) begreife, g in Soff bält ein Sotl). ginDuaDrat!gubifd)ergi)mer, we ldj eneSof f lang,
„lóSotttucif, i63ct t tieff, l)at4o96g'HbifcbeeotI). 3ïad)Dem 9Jiirnbergifd)en©taDt-©d)irt)
„aber beträgt Der DnaDratigubifcpe gpmer 18 Soff an äffen Se i t en, nnD DiefcS (entere SKaaß
„ i(l I)ier bccbac()tet werten, hierauf mm folget in gcljoriger DrDnung Die aSefdjreibnna Der
„ im abriß »otgcfletttcn SBÏuble.
§. 18. Fig.z.Tab. XIV. No. i. „Sciget Das ®afer<3!aD, fan, fammt Den©efd)äuffcl,
„ 18 ©cfcufi bod) feD.n. ®er (Jran^ ifl in feinem SianKt e t 16 ©e^ul); Denn eine ©djaufel gebet
„ ftber Den Siran? einen @d)ul) beroor. ®as 9!aD fan bei) 30 ober 3s ©diaufeln baben. gine
„ ©d)auffel |iel)ct »on Der anDcrn auf l i ®d)ul) l i SdH, wenn Der (ïrané in feinem Umfreiß
„48 ©d)ub nad» gemeinet iScd)nung bat. .©dttc aber Das 3?aD 36 ©djanfeln, fo liefen fie
„ I i ©( tub von cinanDcr. ©0 Das 9?aD eng gefd)auffelt, witD es »om ®a| fer Deflo é f t e t
„angegriffen, unD Deffo l)urtiget umgetrieben.
No. 2. „ S e t g t a n $ , oDerJveiff, worauf Die ©ejanffcln eingetid)tet flnD.
No. 3. „©i e ©d)aufelnfönncn 12 oDet 14 Sott breit le^n, geben, wicgefagt, über Den
„(ïrans einen ©ebub l)cr»or. ©ie mi'tfen fna» in Die 9iinnc eingctid)tet feyn. Damit jwifdjen
„ Den ©Itauffeln unD Der JKinne Das casafer nid)t vergebens weglaufe, ^teni bcD Bielen QfBafet
„fónncn Die ©cbaufeln breit, aber bei) wenigen Qßafer b.ocb unD fd)mai)l fcDn. hierbei) ift
„äumctcfen, Daß ein boI)eS9?aD3W«rIeid>terju bewegen i(}, als ein nicDrigeS, aber cS gebet
aud)
„ and» was langfainer, weil eS einen wcitcrnUinfreiß bat, gegen einem fleinern 9îaD. S ami t
,, aber glcid)wobl aud) Das weite oDec bolje SîaD feinen Sug iii Der ©efdiwinDigfeit Bctrid)tert
,m6ge, fo werDen Die ©ibaufcln enger jufainmen gefeßct. Damit Das ®a f e c öfterer an Die
,,©ifaiifeln Dtucfe, welches fonDevlid) bei)fleinen®ad)lcinäubeobad)ten. Die feinen ffarefen
, , î r t cb baben. ,
No. 4. „SieCSBcffe, fobeDDiefcrSOÎiiI)lemd)t fonDerlid)Dicfc, Damit lîe nicbt fofd)webr
„fomnic; wie Denn Diefe fo wobl als DasSîaD etwas lcid)t unD gering ju mad)en, Damit fie »on
„ einem (leinen Cfficifer fonnc getrieben werDen. .
' No. 5. „ 3 aSÄamnn9? aD i|i in72 Ädmme eingctbeilet, Denn bei; Den S!Sat)^gRiil)len
„ctfcvDcrtescin böberÄamm'sHaD, alSbei)anDetn.sBî£fbli®etcfcn, »»eilDer ©tein Dem
„?Ka[)l'®crcf einen ê d ) » u n g unD !8ei)biilffe bringt. UnD ob es fd)on nid»t b^d) ift im
„ Diameter, jeDocb mit Bielen Ädmmcn befeget wirD, (oDcr, wie man fonfi reDet, anDerSabl
„ oDer ©ditifft Der Sdbnc oDct Ädmme feinen abgang bat, ) fo bat Das QBercf feine unaufgc!
„balteiie»ciBcgnng, wenn anDerS Der ©tein nid)t ju bart eingelaufen i f l , unD einmabl in
„Den ©d)wan8 fôihmt, fonDerlid) wenn Der S ump f oDer Das (Betriebe unD Das ©cfd)itc
„ nidtt jii bcd) ift- aBtil nun Diefe SOÎiible mit fti)Ied)ten Sßaffcr fid) bcl)elffcn muß, fo f«n ein
„Äamm i l S o l l Dief gemadit trcrDen, fo Dann fómnit Das Samm--SîaD etwas nicDrigcr, als
„ wenn Die Sämme Dicfer gcmad)t werDen. ©eflalten nun ferner, wie féon gemelDet, bei) Den
„!5)fabl'®etcfen ein bofteä Äamm<9?aD nnD nieDriger S ump f cingcricbtetwicD, unD Das
„®erdt)art in Die SSewcgiing s« bringen ift, fo muß Der 3RabI '©t«n um fo Biel mebrin
„feine gebûbrenDc SDiaaß geflellet werDen, Damit Das ©eträi)Dc, foin Den ©tein fallt, DcfTen
„ ©d)iBung nicbt aufhalte : ® a Denn Der ©tein Dem ganeen ®ercf eine ® ei)biilfe giebt. gS
„ i f l aud) b£i)DemSamm--9îaDnod)DicfcSsu mcIDen: CSSenn ncmlid) ein S amm ré Soff Dief
„ift, fo ifl Die ®ôf)e, wo Die Sdmme im SHate eingctbeilet werDen, auf Die Xbeil--^inie bei)
„6Scbub, Der îbeiler aber werDen 144 aufDct îbei l^einicbcnim getragen, DaBon fommen
„ 7 2 jn Den Sdmmen, unD 72 jum Spatio jwifd;cn oeiifelbcn. ginïbe i l c r aber ifl i j Soll bei)
„ Diefem DîaD. Snbei) aber ifl aud) ju mercfcn, Daß man Das Sa inm ! Cod) unD Spatium jufanv
„men in 16 îbei lc eintbeile, DaBon gcbübren nun 7 ^bcile Dem S amm, unD 9 îbeile Dem
„Spatio, unD Das um Desausjugs wegen Bon S n m p f Xricbel oDer ©efd)irr. gs fep nun ein
„ S a mm Dicf oDet Dfinne, fo muß Das attejeit beobad)tet werben.
No.fi. „©e r S ump f , fonfl Die ©*eibc genannt, o&er (Betriebe, fo mi« $wey
,©d)eibcii5Hfjmmcn gefegt ; wobei) äu witlcn: weilbei)DiefcrSDiüble72Äämmeangejciget
',finD, fo f6nncn ©ecbfer, ad)tet, unD ineunec^Sumpffe, Das ifl, mit 6. 8. oDer 9 ©pinDeln
,oDet©tanacn, ( t»iv bei f f tnco StecCcn, ) eingerid)tet werDen, nacbDemDas®evif einen
',XriebBon CSBaffer bat. g in ©c.t)ei-< S ump f gebet jwö l f mabl bevum, wann Das ®afcr=
' 9?aD einmabl bernm fommt: g in ad)ter neun mabi; Sin sneimer ad)t mabl. 3nDefcrt
icr gebet, alfo gebet et aud» bdrtcr. g in äd)',ipieDet@ed)fetgefd)WinD( ^ , .. . ter unD 9leunet aber
geben leid)ter, aber Ijingegen was langfamet.
N0.7. „©a s obere Sager ifl ein 3werd) ;$oI^, fo and) Der gifen > ©tcg gencnnct wirb,
„BonDcin Darein cingetid)tcten cifcrnen gjjftbl'^fannlcin unD Bon Der eifcrnen SWftbIflange,
„Die in Dem'Pfdnnlein ge[)et, auf )crSKiibliiange Der ©tein umlauf t .
;enßnnt, tt)eld)es fammt Den
itfbelff'gifen bod) unD nicDtig
No. 8. „®a S untere Säger, fonf l &ie C r a g e »mt c E
„„ Obern unD attcm was Daraul . Dsird) Die ©ertaube oDer Das
„fan gefd)raubt oDer gcflcttet werDen.
No. 9. „ S i e ©d)raitbe oDer Das Slufbclff > gifcn, Durd) weltfecs Das gange Saget, fammt
„attcm, was Daran unD Darauf erbeben oDer nicDer gelaffcn wirD.
No. 1 o. „ ©er untere ©tein, fo in Der Sarcfccn oDer öem t a u f f fliff lieget.
N o . i i . „ ©er mit Der 3ard)enbcDecftc obere ©tein, Der Säufer genannt. Jpiet i f löbet
„obiges nod) jn tagen, wenn Die Steine fcbon etwas breit (liiD, unD Dod) focingelafen. Daß
„Der Sauf e t in ©dtwung feinen S a u f bat, fofönnen aud) tlärcfcreSamme, Dienemlid) jwei)
„Soff Dicf, gcbraud)et wetDen, ob f èon Das Samm-SHaD in feinem Diameter auf8 ©d)ul)
„bod) fïd) bclieffc. UnD wenn fi^on ein Si'mfer, ©cd)fer, oDer ©iebner^Sumpf angcflecfet
„WirD, fo treibet Der ©djwimg Des ©tcinS Dennod) Das ®c r c f , wcldtcner baben muß, el)e
„man anfféfittet. ®an muß aud) biet Die Steine im SDîablen nid)t ä« Ijart bemmenoDcc
„fpanncn, fonflflebet DaS5!Rul)lwecct|liff.
C No. I I .